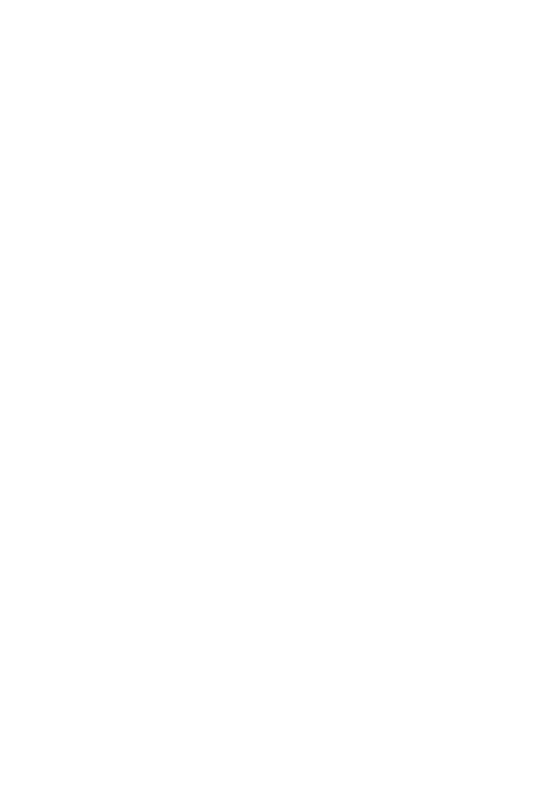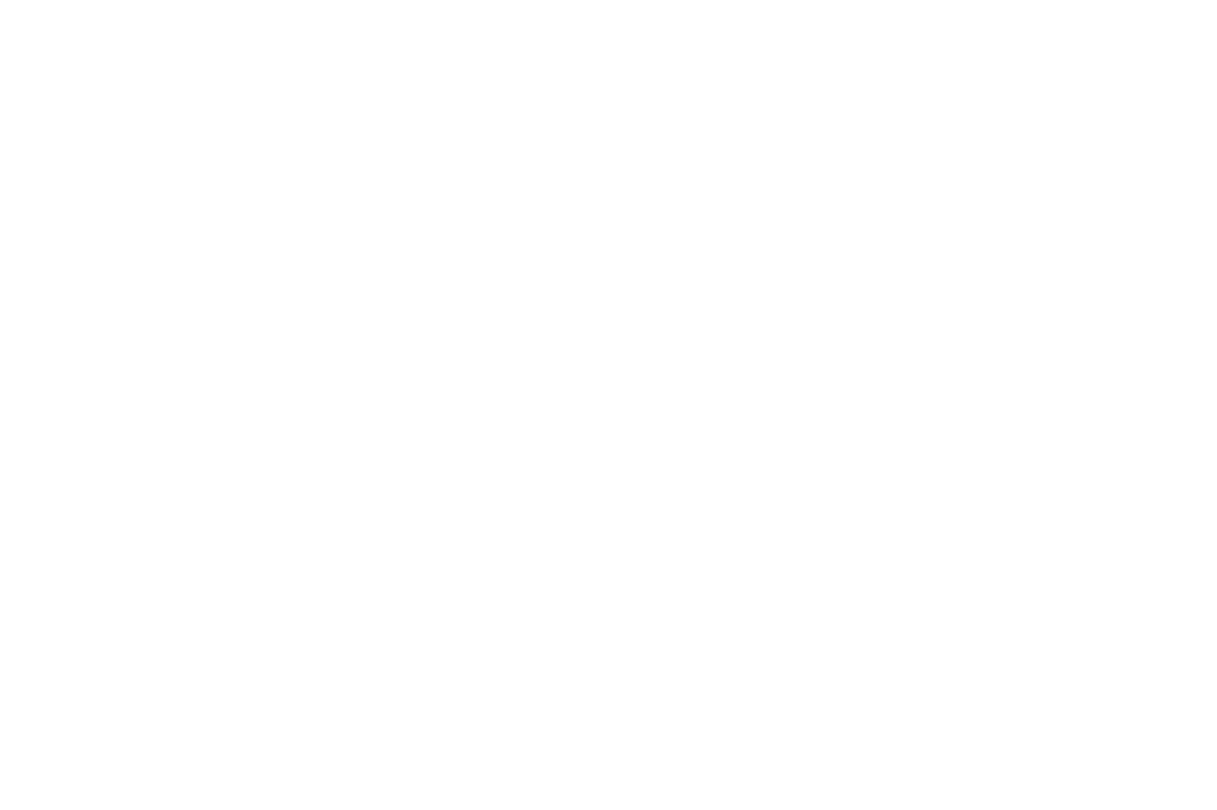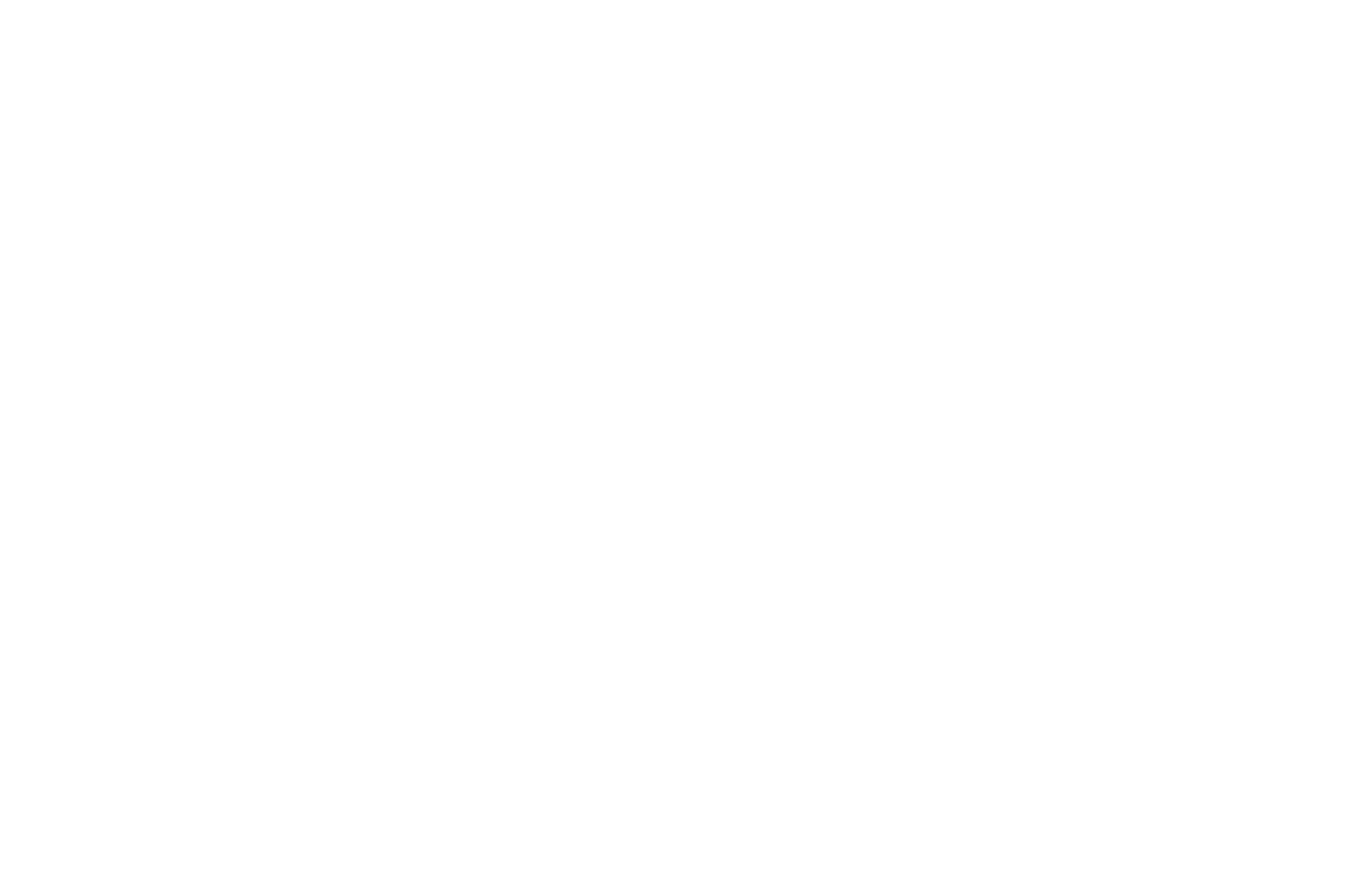Premiere 29.04.2010
› Schauspielhaus
Sein oder Nichtsein
Komödie von Nick Whitby
nach dem Film „To Be or Not to Be“ von Ernst Lubitsch, Edwin Justus Mayer und Melchior Lengyel
nach dem Film „To Be or Not to Be“ von Ernst Lubitsch, Edwin Justus Mayer und Melchior Lengyel
Handlung
Warschau, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs: Eine Schauspielertruppe probt in Nazikostümen für die Politkomödie „Gestapo“, als die polnische Regierung die Aufführung verbieten lässt, um nicht mit dem Hitlerregime in Konflikt zu geraten. Um ein Stück für den Abend zu haben, wird „Hamlet“ gegeben – mit dem selbstverliebten Starschauspieler Josef Tura in der Titelrolle. Während des großen Hamletmonologs hat seine Ehefrau Maria in ihrer Garderobe ein Stelldichein mit dem attraktiven Fliegerleutnant Stanislaw Sobinsky. Kurz darauf bricht der Zweite Weltkrieg aus, und der Flieger warnt das Ensemble vor einem feindlichen Spion, der im Begriff sei, eine Liste mit den Namen der polnischen Widerstandskämpfer an die Nazis zu übergeben. Um dies zu verhindern, verwandelt sich das Theater in das Gestapo-Hauptquartier, und das Ensemble nimmt die Rollen der deutschen Besatzer an. Es beginnt eine wahnwitzige Komödie der Verstellung, in der alle Darsteller um ihr Leben spielen.
Berühmt geworden ist „Sein oder Nichtsein“ durch den grandiosen Film von 1942 in der Regie von Ernst Lubitsch. Den Theaterabend inszeniert Thomas Birkmeir, Künstlerischer Leiter am „Theater der Jugend“ in Wien. Er hat u. a. an der dortigen Staatsoper und am Schauspiel Hannover inszeniert und ist ein Spezialist für musikalische und komödiantische Stoffe.
Berühmt geworden ist „Sein oder Nichtsein“ durch den grandiosen Film von 1942 in der Regie von Ernst Lubitsch. Den Theaterabend inszeniert Thomas Birkmeir, Künstlerischer Leiter am „Theater der Jugend“ in Wien. Er hat u. a. an der dortigen Staatsoper und am Schauspiel Hannover inszeniert und ist ein Spezialist für musikalische und komödiantische Stoffe.
Besetzung
Regie
Thomas Birkmeir
Bühne
Jörg Kiefel
Kostüme
Irmgard Kersting
Musik
Klaus-David Erharter
Licht
Michael Gööck
Dramaturgie
Josef Tura
Maria Tura
Stanislaw Sobinsky
Sascha Göpel
Dowasz, Schauspieldirektor
Thomas Braungardt
Anna, Garderobiere, Souffleuse, gute Seele
Vera Irrgang
Bronski
Günter Kurze
Grünberg
Professor Siletzky
Gruppenführer Erhardt
Gruppenführer Erhardt alternierend
Tom Quaas
Sturmführer Schulz / Dr. Walowski
Benjamin Pauquet
Wilhelm Kunze
Dominik Frick / Jonathan Schubert
Wachmann
Marcus Horn / Steffen Liebscher
Video
Über das Stück
Über Nazis in der Satire
von Klaus Cäsar Zehrer
von Klaus Cäsar Zehrer
Das Selbstverständliche und Offensichtliche vorweg: Nazis sind nicht komisch. Sind es nie gewesen, werden es nie sein. Nicht die alten, die die Zivilisation auf einen historischen Tiefststand brachten, und nicht die neuen, die davon träumen, es ihnen eines Tages gleichzutun.
Und doch wird über Nazis gelacht, seit sie in den späten 1920er-Jahren zu einer ernst zu nehmenden politischen Kraft aufstiegen. In Kabaretts und Witzblättern spottete man über die geistesarmen Größenwahnsinnigen mit dem kruden Weltbild. Kurt Tucholsky verhöhnte „Joebbels“ 1931 in der „Weltbühne“: „Wat wärst du ohne deine Möbelpacker!/Die stehn, bezahlt un treu, so um dir rum./Dahinter du: een arma Lauseknacker,/een Baritong fort Jachtenpublikum.“ Doch noch vor der Machtergreifung der Nazis stellte er resigniert fest, dass solche Verbalattacken wenig ausrichten können: „Satire hat auch eine Grenze nach unten. In Deutschland etwa die herrschenden faschistischen Mächte. Es lohnt nicht so tief kann man nicht schießen.“ Dessen ungeachtet besang Erich Weinert im Moskauer Exil selbst noch 1942, als die vermeintlichen Knallchargen sich längst als skrupellose Massenmörder ausgezeichnet hatten, Hitler mit kraftvoller Ohnmacht als „Diesen Hindenburgumschwänzler,/Diesen tristen Hampelmann,/Diesen faden Temperenzler,/Ders nicht mal mit Weibern kann,/Diesen Selterwassergötzen,/Dies Friseurmodell auf schön.“
Satire, Spott und Polemik sind die Lieblingswaffen der Pazifisten. Mit ihnen kann man geistige Schlachten bestreiten und Gegner bekämpfen, ohne dass Blut fließt. Aber was, wenn der Feind sich nicht auf Waffengleichheit einlässt? Der Kabaretthistoriker Volker Kühn schreibt über die Endzeit der Weimarer Republik: „Alles, was Hollaenders Chansons im Tingel-Tangel bewirken, wenn etwa vom falschen Zug die Rede ist, der offensichtlich verkehrt verkehrt, weil der Pazifik nach ‚Nazedonien' fährt, ist die Mobilmachung uniformierter Schlägertrupps, die die Kabarettkeller stürmen, Krawall schlagen und die unliebsamen oppositionellen Kabarettisten von der Bühne zerren.“
Gegen rohe Gewalt erwies sich die spitze Feder als wenig wirksames Gegenmittel. Joseph Goebbels konnte 1939 verkünden: „Die politische Witzemacherei ist ein liberales Überbleibsel. Im vergangenen System konnte man damit noch etwas erreichen. Wir sind in diesen Dingen zu gescheit und erfahren, als dass wir sie ruhig weitertreiben ließen.“ Der Kabarettdichter und Anarchist Erich Mühsam war da schon seit fünf Jahren tot, ermordet im KZ Sachsenhausen. Fast schon glücklich schätzen konnte sich, wer, wie Erich Kästner oder Werner Finck, mit Berufsverbot davonkam oder, wie Bertolt Brecht, Walter Mehring oder John Heartfield, im Exil überlebte.
Es ist erstaunlich, wie wenig diese Vorgeschichte die heutigen Spaßmacher entmutigt. Die Zahl der Witzbolde, die sich das Haar streng scheiteln, ein schmales Bärtchen ankleben und vor Publikum oder der Kamera wüst herumbelfern, ist größer denn je. Als ob damit schon etwas bewiesen oder gar gewonnen wäre. Und als ob der blöde Adolf nur ein Bruder des dummen Augusts wäre. Selbst der TV-Comedian Atze Schröder, bislang wenig auffällig als politisch engagierter Künstler, spielte im Jahr 2008 die Hauptrolle in der Filmkomödie „U-900“, in der reihenweise Nazis in ihrer fast schon obligaten Komödienfunktion vorkommen, nämlich als Dummbeutel, Watschenheinis und Schießbudenfiguren. Der Regisseur des Films, Sven Unterwaldt, beantwortet die Frage, ob man „in Deutschland einen Popcornfilm über den Zweiten Weltkrieg“ drehen dürfe, „aus folgendem Grund mit Ja: Weil ich glaube, man darf kein Medium auslassen, um irgendwo ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Und sei es nur: Die Nazis sind doof." Und er ergänzt, dass „ich natürlich genau bei Lubitschs ‚To Be or Not to Be' meine Wurzeln sehe.“
„Darf man das?“, das ist heute nicht mehr, wie noch zu Tucholskys Zeiten, eine vorrangig juristische Frage, sondern eine moralische. Sie tauchte in den vergangenen Jahren zuverlässig auf, wann immer deutsche Satiriker sich aktuell des Themas Nationalsozialismus und speziell der Figur Adolf Hitlers annahmen. Ob es sich um die Cartoonserie „Der Führer privat“ des Karikaturistenduos Greser & Lenz, den Comic „Adolf, die Nazisau“ von Walter Moers, Bühnenanverwandlungen durch Harald Schmidt oder die Komödie „Mein Führer“ von Dani Levy mit Helge Schneider als Hitler handelte: Nie waren öffentlich geäußerte Bedenken fern, ob eine Komisierung nicht eine Banalisierung, eine Verharmlosung des Bösen bedeute.
Und doch wird über Nazis gelacht, seit sie in den späten 1920er-Jahren zu einer ernst zu nehmenden politischen Kraft aufstiegen. In Kabaretts und Witzblättern spottete man über die geistesarmen Größenwahnsinnigen mit dem kruden Weltbild. Kurt Tucholsky verhöhnte „Joebbels“ 1931 in der „Weltbühne“: „Wat wärst du ohne deine Möbelpacker!/Die stehn, bezahlt un treu, so um dir rum./Dahinter du: een arma Lauseknacker,/een Baritong fort Jachtenpublikum.“ Doch noch vor der Machtergreifung der Nazis stellte er resigniert fest, dass solche Verbalattacken wenig ausrichten können: „Satire hat auch eine Grenze nach unten. In Deutschland etwa die herrschenden faschistischen Mächte. Es lohnt nicht so tief kann man nicht schießen.“ Dessen ungeachtet besang Erich Weinert im Moskauer Exil selbst noch 1942, als die vermeintlichen Knallchargen sich längst als skrupellose Massenmörder ausgezeichnet hatten, Hitler mit kraftvoller Ohnmacht als „Diesen Hindenburgumschwänzler,/Diesen tristen Hampelmann,/Diesen faden Temperenzler,/Ders nicht mal mit Weibern kann,/Diesen Selterwassergötzen,/Dies Friseurmodell auf schön.“
Satire, Spott und Polemik sind die Lieblingswaffen der Pazifisten. Mit ihnen kann man geistige Schlachten bestreiten und Gegner bekämpfen, ohne dass Blut fließt. Aber was, wenn der Feind sich nicht auf Waffengleichheit einlässt? Der Kabaretthistoriker Volker Kühn schreibt über die Endzeit der Weimarer Republik: „Alles, was Hollaenders Chansons im Tingel-Tangel bewirken, wenn etwa vom falschen Zug die Rede ist, der offensichtlich verkehrt verkehrt, weil der Pazifik nach ‚Nazedonien' fährt, ist die Mobilmachung uniformierter Schlägertrupps, die die Kabarettkeller stürmen, Krawall schlagen und die unliebsamen oppositionellen Kabarettisten von der Bühne zerren.“
Gegen rohe Gewalt erwies sich die spitze Feder als wenig wirksames Gegenmittel. Joseph Goebbels konnte 1939 verkünden: „Die politische Witzemacherei ist ein liberales Überbleibsel. Im vergangenen System konnte man damit noch etwas erreichen. Wir sind in diesen Dingen zu gescheit und erfahren, als dass wir sie ruhig weitertreiben ließen.“ Der Kabarettdichter und Anarchist Erich Mühsam war da schon seit fünf Jahren tot, ermordet im KZ Sachsenhausen. Fast schon glücklich schätzen konnte sich, wer, wie Erich Kästner oder Werner Finck, mit Berufsverbot davonkam oder, wie Bertolt Brecht, Walter Mehring oder John Heartfield, im Exil überlebte.
Es ist erstaunlich, wie wenig diese Vorgeschichte die heutigen Spaßmacher entmutigt. Die Zahl der Witzbolde, die sich das Haar streng scheiteln, ein schmales Bärtchen ankleben und vor Publikum oder der Kamera wüst herumbelfern, ist größer denn je. Als ob damit schon etwas bewiesen oder gar gewonnen wäre. Und als ob der blöde Adolf nur ein Bruder des dummen Augusts wäre. Selbst der TV-Comedian Atze Schröder, bislang wenig auffällig als politisch engagierter Künstler, spielte im Jahr 2008 die Hauptrolle in der Filmkomödie „U-900“, in der reihenweise Nazis in ihrer fast schon obligaten Komödienfunktion vorkommen, nämlich als Dummbeutel, Watschenheinis und Schießbudenfiguren. Der Regisseur des Films, Sven Unterwaldt, beantwortet die Frage, ob man „in Deutschland einen Popcornfilm über den Zweiten Weltkrieg“ drehen dürfe, „aus folgendem Grund mit Ja: Weil ich glaube, man darf kein Medium auslassen, um irgendwo ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Und sei es nur: Die Nazis sind doof." Und er ergänzt, dass „ich natürlich genau bei Lubitschs ‚To Be or Not to Be' meine Wurzeln sehe.“
„Darf man das?“, das ist heute nicht mehr, wie noch zu Tucholskys Zeiten, eine vorrangig juristische Frage, sondern eine moralische. Sie tauchte in den vergangenen Jahren zuverlässig auf, wann immer deutsche Satiriker sich aktuell des Themas Nationalsozialismus und speziell der Figur Adolf Hitlers annahmen. Ob es sich um die Cartoonserie „Der Führer privat“ des Karikaturistenduos Greser & Lenz, den Comic „Adolf, die Nazisau“ von Walter Moers, Bühnenanverwandlungen durch Harald Schmidt oder die Komödie „Mein Führer“ von Dani Levy mit Helge Schneider als Hitler handelte: Nie waren öffentlich geäußerte Bedenken fern, ob eine Komisierung nicht eine Banalisierung, eine Verharmlosung des Bösen bedeute.
Anlässlich des letztgenannten Beispiels behauptete der deutsche Bischof Gebhard Fürst: „Nur die Opfer könnten uns das Recht zugestehen, über Hitler zu lachen.“ Ein Satz, der die ganze merkwürdige Verkrampftheit der Debatte illustriert. Das natürliche Lachen ist die spontane Körperreaktion auf ein komisches Erlebnis. Eine Instanz zu benennen, die das Recht auf Lachen zugestehen oder verweigern könnte, ist so unsinnig, wie einem Erkälteten das Niesen erlauben oder verbieten zu wollen. Dieselbe verkrampfte Befangenheit ist leider auch vielen Satiren auf den Nationalsozialismus anzumerken. Ihren Machern scheint mehr daran gelegen zu sein, „irgendwo ein Zeichen gegen Rechts zu setzen“, als das komische Potenzial ihres Themas möglichst wirkungsvoll auszuspielen. Zu lachen gibt es dementsprechend eher wenig. Wenn das Publikum trotzdem demonstrativ lacht, dann wohl in erster Linie weil es gleichfalls irgendwo ein Zeichen gegen Rechts setzen möchte.
Bedenkt man, um welche barbarischen Mörderhorden es sich handelt, denen mit der bescheidenen satirischen Waffenkraft entgegengetreten wird, nimmt sich die Frage Darf man das? ohnehin merkwürdig verzärtelt, ja fast weltentrückt aus. Sehr viel irdischer ist da schon die Frage: Bringt das was? Oder auch: Was bringt das? Was bringt es, auf launige Weise die Botschaft zu verbreiten, dass Nazis doof sind? Doofe pflegen sich nun einmal gerne mit dem unbekümmerten Gegenargument „Selber doof“ zu verteidigen. Auf diesem Niveau ist nicht viel auszurichten.
Es gilt zu beachten, dass nicht in jeder Satire, in der Nazis vorkommen, diese auch das eigentliche Angriffsziel sind. Denken wir etwa an die allseits beliebte Diffamierungstechnik des Nazivergleichs. Das ist wie bei den Nazis ist im heute üblichen Sprachgebrauch nur eine andere Formulierung für „Das ist sehr, sehr verwerflich". Wenn einem Politiker, sei es mit komischen oder mit unkomischen rhetorischen Mitteln, unterstellt wird, seine Taten, Äußerungen oder Absichten hätten Gemeinsamkeiten mit denen der Nazis, so wird dieser keinesfalls antworten, dass gewisse Parallelen in der Tat unverkennbar seien, sondern er wird sich vehement über diesen ungeheuerlichen Vergleich empören und eine unverzügliche Entschuldigung fordern. Denn wenn es (außerhalb des braunen Lagers natürlich) ein gesellschaftliches Einverständnis gibt, dann jenes, dass Nazis das Allerletzte sind, das absolut Schlechte.
Aus diesem Grund sind Satiren, die zum Lernziel haben, dass die Nazis doof sind, müßig, denn diese Einsicht des Zuschauers kann getrost vorausgesetzt werden. Bedeutet das, dass Nazis als Personal für satirische Werke ungeeignet sind? Ganz im Gegenteil. Der Sozialphilosoph Theodor W. Adorno bemerkte über die Satire: „Sie hebt sich auf, sobald sie das auslegende Wort hinzufügt. Dabei setzt sie die Idee des Selbstverständlichen voraus. Nur wo ein zwingender Consensus der Subjekte angenommen wird, ist subjektive Reflexion, der Vollzug des begrifflichen Akts überflüssig.“ Das bedeutet: Satire basiert auf Übereinkunft, damit sie überhaupt verstanden werden kann.
Satiren sind keine komplexen Charakterstudien ambivalenter Protagonisten, sie arbeiten mit schnell und leicht zu entschlüsselnden Zuschreibungen. Aus diesem Grund sind Nazis für Satireautoren so unwiderstehlich. Sobald der Mann mit der Hakenkreuzbinde auftaucht, weiß das Publikum: Hier kommt der Böse. Der auch der Gefährliche ist, so dass zugleich für ein Spannungselement gesorgt ist. Gelungene Satiren zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese eindeutig negative Zuschreibung weder relativieren noch als das Ergebnis ihrer erzählerischen Bemühungen herausstellen, sondern die dramaturgischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, geschickt und gewitzt ausschöpfen.
Wie das gehen kann, zeigt seit 1942 Ernst Lubitschs Filmmeisterwerk „Sein oder Nichtsein“, das sich auf Melchior Lengyels Theaterkomödie „Noch ist Polen nicht verloren“ gründet. Angesichts der Zeitumstände, unter denen das Stück entstanden ist, wäre auch ein recht grob gestricktes antifaschistisches Propagandastück verzeihlich gewesen. Dass Autor und Regisseur dennoch mehr Wert auf fein angelegte Erzähltechnik als auf plumpe Effekte gesetzt haben, ist ein kleines Wunder, ja mehr als das: Es ist große Satirekunst. Mag sein, dass der Film nur wenig dazu beigetragen hat, den Zweiten Weltkrieg zu entscheiden. Aber er beweist uns Nachgeborenen eindrucksvoll, dass die Guten gewonnen haben. Und das, immerhin, vermag die Satire.
Dr. Klaus Cäsar Zehrer lebt als freier Autor und Herausgeber in Berlin. Er schreibt unter anderem Humorkritiken für das Satiremagazin Titanic und hat zum Thema Dialektik der Satire promoviert.
Bedenkt man, um welche barbarischen Mörderhorden es sich handelt, denen mit der bescheidenen satirischen Waffenkraft entgegengetreten wird, nimmt sich die Frage Darf man das? ohnehin merkwürdig verzärtelt, ja fast weltentrückt aus. Sehr viel irdischer ist da schon die Frage: Bringt das was? Oder auch: Was bringt das? Was bringt es, auf launige Weise die Botschaft zu verbreiten, dass Nazis doof sind? Doofe pflegen sich nun einmal gerne mit dem unbekümmerten Gegenargument „Selber doof“ zu verteidigen. Auf diesem Niveau ist nicht viel auszurichten.
Es gilt zu beachten, dass nicht in jeder Satire, in der Nazis vorkommen, diese auch das eigentliche Angriffsziel sind. Denken wir etwa an die allseits beliebte Diffamierungstechnik des Nazivergleichs. Das ist wie bei den Nazis ist im heute üblichen Sprachgebrauch nur eine andere Formulierung für „Das ist sehr, sehr verwerflich". Wenn einem Politiker, sei es mit komischen oder mit unkomischen rhetorischen Mitteln, unterstellt wird, seine Taten, Äußerungen oder Absichten hätten Gemeinsamkeiten mit denen der Nazis, so wird dieser keinesfalls antworten, dass gewisse Parallelen in der Tat unverkennbar seien, sondern er wird sich vehement über diesen ungeheuerlichen Vergleich empören und eine unverzügliche Entschuldigung fordern. Denn wenn es (außerhalb des braunen Lagers natürlich) ein gesellschaftliches Einverständnis gibt, dann jenes, dass Nazis das Allerletzte sind, das absolut Schlechte.
Aus diesem Grund sind Satiren, die zum Lernziel haben, dass die Nazis doof sind, müßig, denn diese Einsicht des Zuschauers kann getrost vorausgesetzt werden. Bedeutet das, dass Nazis als Personal für satirische Werke ungeeignet sind? Ganz im Gegenteil. Der Sozialphilosoph Theodor W. Adorno bemerkte über die Satire: „Sie hebt sich auf, sobald sie das auslegende Wort hinzufügt. Dabei setzt sie die Idee des Selbstverständlichen voraus. Nur wo ein zwingender Consensus der Subjekte angenommen wird, ist subjektive Reflexion, der Vollzug des begrifflichen Akts überflüssig.“ Das bedeutet: Satire basiert auf Übereinkunft, damit sie überhaupt verstanden werden kann.
Satiren sind keine komplexen Charakterstudien ambivalenter Protagonisten, sie arbeiten mit schnell und leicht zu entschlüsselnden Zuschreibungen. Aus diesem Grund sind Nazis für Satireautoren so unwiderstehlich. Sobald der Mann mit der Hakenkreuzbinde auftaucht, weiß das Publikum: Hier kommt der Böse. Der auch der Gefährliche ist, so dass zugleich für ein Spannungselement gesorgt ist. Gelungene Satiren zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese eindeutig negative Zuschreibung weder relativieren noch als das Ergebnis ihrer erzählerischen Bemühungen herausstellen, sondern die dramaturgischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, geschickt und gewitzt ausschöpfen.
Wie das gehen kann, zeigt seit 1942 Ernst Lubitschs Filmmeisterwerk „Sein oder Nichtsein“, das sich auf Melchior Lengyels Theaterkomödie „Noch ist Polen nicht verloren“ gründet. Angesichts der Zeitumstände, unter denen das Stück entstanden ist, wäre auch ein recht grob gestricktes antifaschistisches Propagandastück verzeihlich gewesen. Dass Autor und Regisseur dennoch mehr Wert auf fein angelegte Erzähltechnik als auf plumpe Effekte gesetzt haben, ist ein kleines Wunder, ja mehr als das: Es ist große Satirekunst. Mag sein, dass der Film nur wenig dazu beigetragen hat, den Zweiten Weltkrieg zu entscheiden. Aber er beweist uns Nachgeborenen eindrucksvoll, dass die Guten gewonnen haben. Und das, immerhin, vermag die Satire.
Dr. Klaus Cäsar Zehrer lebt als freier Autor und Herausgeber in Berlin. Er schreibt unter anderem Humorkritiken für das Satiremagazin Titanic und hat zum Thema Dialektik der Satire promoviert.