Premiere 29.03.2018
› Schauspielhaus
Erniedrigte und Beleidigte
nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewski
unter Verwendung der Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz
unter Verwendung der Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz
Handlung
Eingeladen zum Berliner Theatertreffen 2019
„… aber was soll ich tun, wenn ich bestimmt weiß, dass die Grundlage aller menschlichen Tugenden der größte Egoismus bildet.“
Dostojewski lässt in seinem Roman, erschienen 1861, den fiktiven Autor Iwan Petrowitsch auf den Zyniker Fürst Walkowski treffen, dem es Vergnügen bereitet, alles Gerede über Altruismus und selbstaufopfernde Liebe als bloße Illusion zu verspotten. Beide begegnen sich eines Abends im von Dostojewski als düsterer Großstadtmoloch geschilderten Petersburg. Walkowski hat seinen Sohn, den willensschwachen, kindlichen Aljoscha, bei seinem Verwalter und dessen Familie, den Ichmenews, untergebracht, bei denen auch der junge Dichter aufwuchs. Die Tochter der Ichmenews, Natascha, verliebt sich und verlässt mit Aljoscha die Familie. Walkowski verklagt seinen Verwalter und bezichtigt ihn der Intrige. In rasanter Folge gehen die Liebesverwirrungen sowie deren skrupellose Instrumentalisierung und der soziale Abstieg ganzer Familien ineinander über. Despotisch ist nicht nur der Fürst, sondern alle Figuren sind von ihrem verletzten Selbst und der Sucht nach Genugtuung getrieben. Hinter den großen Emotionen aber geht es schlicht um Vermögensanteile: „Das Leben ist ein Handelsgeschäft; werfen sie ihr Geld nicht umsonst weg“, rät Walkowski dem mittellosen Dichter.
„… aber was soll ich tun, wenn ich bestimmt weiß, dass die Grundlage aller menschlichen Tugenden der größte Egoismus bildet.“
Dostojewski lässt in seinem Roman, erschienen 1861, den fiktiven Autor Iwan Petrowitsch auf den Zyniker Fürst Walkowski treffen, dem es Vergnügen bereitet, alles Gerede über Altruismus und selbstaufopfernde Liebe als bloße Illusion zu verspotten. Beide begegnen sich eines Abends im von Dostojewski als düsterer Großstadtmoloch geschilderten Petersburg. Walkowski hat seinen Sohn, den willensschwachen, kindlichen Aljoscha, bei seinem Verwalter und dessen Familie, den Ichmenews, untergebracht, bei denen auch der junge Dichter aufwuchs. Die Tochter der Ichmenews, Natascha, verliebt sich und verlässt mit Aljoscha die Familie. Walkowski verklagt seinen Verwalter und bezichtigt ihn der Intrige. In rasanter Folge gehen die Liebesverwirrungen sowie deren skrupellose Instrumentalisierung und der soziale Abstieg ganzer Familien ineinander über. Despotisch ist nicht nur der Fürst, sondern alle Figuren sind von ihrem verletzten Selbst und der Sucht nach Genugtuung getrieben. Hinter den großen Emotionen aber geht es schlicht um Vermögensanteile: „Das Leben ist ein Handelsgeschäft; werfen sie ihr Geld nicht umsonst weg“, rät Walkowski dem mittellosen Dichter.
Dauer der Aufführung: ca. 2 Stunden und 45 Minuten.
Keine Pause.
Keine Pause.
Besetzung
Regie und Bühne
Kostüme
Chorleitung
Christine Groß
Bild/Installation
Tilo Baumgärtel
Lichtdesign
Licht
Dramaturgie
Mit
Luise Aschenbrenner, Eva Hüster, Moritz Kienemann, Torsten Ranft, Lukas Rüppel, Fanny Staffa, Nadja Stübiger, Yassin Trabelsi, Viktor Tremmel
Video
Theatertreffen 2019
Am 30. Januar 2019 hat die Theatertreffen-Jury die Auswahl für das 56. Theatertreffen bekannt gegeben.
DAS GROSSE HEFT und ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE sind zwei der 10 besten Stücke der Saison.
„Was bedeutet bemerkenswert im Theater?“ – nach dieser Frage wählt die Jury jedes Jahr 10 Stücke aus, die zum Theatertreffen im Berlin eingeladen sind.
Vom 3. bis 20. Mai 2019 fand das Theatertreffen in Berlin statt, bei dem die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gezeigt werden. Die siebenköpfige Jury besuchte 418 Inszenierungen in 65 deutschsprachigen Städten. 744 Voten gingen ein und die einzelnen Juror*innen haben jeweils zwischen 94 und 121 Inszenierungen gesehen. Insgesamt wurden 39 Inszenierungen vorgeschlagen und diskutiert.
DAS GROSSE HEFT nach dem Roman von Ágota Kristóf, aus dem Französischen von Eva Moldenhauerin in einer Fassung von Ulrich Rasche und Alexander Weise, Regie und Bühne von Ulrich Rasche (Premiere: 11. Februar 2018) und ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewski unter Verwendung der Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz, Regie und Bühne von Sebastian Hartmann (Premiere: 29. März 2018) sind beide nach Berlin eingeladen. „Wir gratulieren den künstlerischen Teams, den Ensembles und den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Produktionen sehr herzlich zu diesem Erfolg!“, so Intendant Joachim Klement. „Beide ausgewählten Produktionen zeigen auf sehr unterschiedliche, aber in beiden Fällen auf äußerst eindrücklichen Weise, wie groß die Spannbreite der ästhetischen Handschriften ist, die in unserem Haus gezeigt werden. Wir freuen uns sehr über die Einladungen zum wichtigsten deutschen Theatertreffen!“.
DAS GROSSE HEFT und ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE sind zwei der 10 besten Stücke der Saison.
„Was bedeutet bemerkenswert im Theater?“ – nach dieser Frage wählt die Jury jedes Jahr 10 Stücke aus, die zum Theatertreffen im Berlin eingeladen sind.
Vom 3. bis 20. Mai 2019 fand das Theatertreffen in Berlin statt, bei dem die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gezeigt werden. Die siebenköpfige Jury besuchte 418 Inszenierungen in 65 deutschsprachigen Städten. 744 Voten gingen ein und die einzelnen Juror*innen haben jeweils zwischen 94 und 121 Inszenierungen gesehen. Insgesamt wurden 39 Inszenierungen vorgeschlagen und diskutiert.
DAS GROSSE HEFT nach dem Roman von Ágota Kristóf, aus dem Französischen von Eva Moldenhauerin in einer Fassung von Ulrich Rasche und Alexander Weise, Regie und Bühne von Ulrich Rasche (Premiere: 11. Februar 2018) und ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewski unter Verwendung der Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz, Regie und Bühne von Sebastian Hartmann (Premiere: 29. März 2018) sind beide nach Berlin eingeladen. „Wir gratulieren den künstlerischen Teams, den Ensembles und den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Produktionen sehr herzlich zu diesem Erfolg!“, so Intendant Joachim Klement. „Beide ausgewählten Produktionen zeigen auf sehr unterschiedliche, aber in beiden Fällen auf äußerst eindrücklichen Weise, wie groß die Spannbreite der ästhetischen Handschriften ist, die in unserem Haus gezeigt werden. Wir freuen uns sehr über die Einladungen zum wichtigsten deutschen Theatertreffen!“.
Statement der Jury zu DAS GROSSE HEFT
Ulrich Rasches Chorkunst ist auf Erhabenheit angelegt, auf Pathos, auf Bildmacht, auf sinnliche Überwältigung auch. Manche sagen: Es riecht nach Rammstein. Das alles stimmt. Aber Rasche bringt dabei wie kaum ein anderer Texte frisch zu Gehör, faltet sie genauestens rhythmisiert vor dem Bewusstsein der Betrachtenden auf, regt das Denken an und auf. So folgt man an diesem Abend in knapp vier Stunden gebannt der großen Kindheitserzählung aus Weltkriegszeiten von Ágota Kristóf. Ein düsteres Werk, voll Gewalt und sexuellen Obsessionen, in kühler behavioristischer Erzählkunst vorgetragen. Rasche zeichnet es mit Muße und bedrückender Intensität nach, mit Männerchören, die auf zwei riesigen rotierenden Drehscheiben schreiten, angetrieben von der minimalistischen Mantra-Klangkunst Monika Roschers. Es ist der Blick in eine faschistoide, militaristische, von Moral bereinigte Kindheitswelt, ein Gang ins Walzwerk der aufkeimenden Männerfantasien.
Statement der Jury zu ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE
Nebel dräut, aufwühlende Musik erklingt, Menschen stürmen an die Rampe. Sie schleppen Leitern auf die Bühne, fangen an, mit schwarzer und weißer Farbe ein riesiges Bild zu malen, hoch und höher, Schicht über Schicht. Davor kreist ein fahrbares Klinikbett, und Spieler*innen mit raschelnden Krinolinen und schwarzen Zylindern zeigen scheinbar zusammenhanglose, mitunter auch sich wiederholende Szenen aus Dostojewskis Fortsetzungsroman „Erniedrigte und Beleidigte“ rund um einen selbstsüchtigen Patriarchen, im Stich gelassene Kinder und erdrückende Schuldenberge. Es dauert eine ganze Weile, bis sich das Publikum in den Improvisationsmodulen von Sebastian Hartmanns Dresdner Inszenierung zu orientieren lernt. Geradezu programmatisch gerät sie durch die Verschaltung mit Wolfram Lotzʼ Hamburger Poetikvorlesung, die ein neues Theater entwirft und von Yassin Trabelsi mit großem Soundgefühl versprechtanzt wird. Denn Hartmanns Arbeit zielt nicht auf die lineare Nacherzählung des Romanstoffs, sondern – wie schon bei Dostojewski angelegt – auf die ekstatische Auflösung von Sinn und Logos, so wie sie in Krankheit, Liebe und hier tatsächlich auch in der Kunst erfahrbar werden.
Ulrich Rasches Chorkunst ist auf Erhabenheit angelegt, auf Pathos, auf Bildmacht, auf sinnliche Überwältigung auch. Manche sagen: Es riecht nach Rammstein. Das alles stimmt. Aber Rasche bringt dabei wie kaum ein anderer Texte frisch zu Gehör, faltet sie genauestens rhythmisiert vor dem Bewusstsein der Betrachtenden auf, regt das Denken an und auf. So folgt man an diesem Abend in knapp vier Stunden gebannt der großen Kindheitserzählung aus Weltkriegszeiten von Ágota Kristóf. Ein düsteres Werk, voll Gewalt und sexuellen Obsessionen, in kühler behavioristischer Erzählkunst vorgetragen. Rasche zeichnet es mit Muße und bedrückender Intensität nach, mit Männerchören, die auf zwei riesigen rotierenden Drehscheiben schreiten, angetrieben von der minimalistischen Mantra-Klangkunst Monika Roschers. Es ist der Blick in eine faschistoide, militaristische, von Moral bereinigte Kindheitswelt, ein Gang ins Walzwerk der aufkeimenden Männerfantasien.
Statement der Jury zu ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE
Nebel dräut, aufwühlende Musik erklingt, Menschen stürmen an die Rampe. Sie schleppen Leitern auf die Bühne, fangen an, mit schwarzer und weißer Farbe ein riesiges Bild zu malen, hoch und höher, Schicht über Schicht. Davor kreist ein fahrbares Klinikbett, und Spieler*innen mit raschelnden Krinolinen und schwarzen Zylindern zeigen scheinbar zusammenhanglose, mitunter auch sich wiederholende Szenen aus Dostojewskis Fortsetzungsroman „Erniedrigte und Beleidigte“ rund um einen selbstsüchtigen Patriarchen, im Stich gelassene Kinder und erdrückende Schuldenberge. Es dauert eine ganze Weile, bis sich das Publikum in den Improvisationsmodulen von Sebastian Hartmanns Dresdner Inszenierung zu orientieren lernt. Geradezu programmatisch gerät sie durch die Verschaltung mit Wolfram Lotzʼ Hamburger Poetikvorlesung, die ein neues Theater entwirft und von Yassin Trabelsi mit großem Soundgefühl versprechtanzt wird. Denn Hartmanns Arbeit zielt nicht auf die lineare Nacherzählung des Romanstoffs, sondern – wie schon bei Dostojewski angelegt – auf die ekstatische Auflösung von Sinn und Logos, so wie sie in Krankheit, Liebe und hier tatsächlich auch in der Kunst erfahrbar werden.
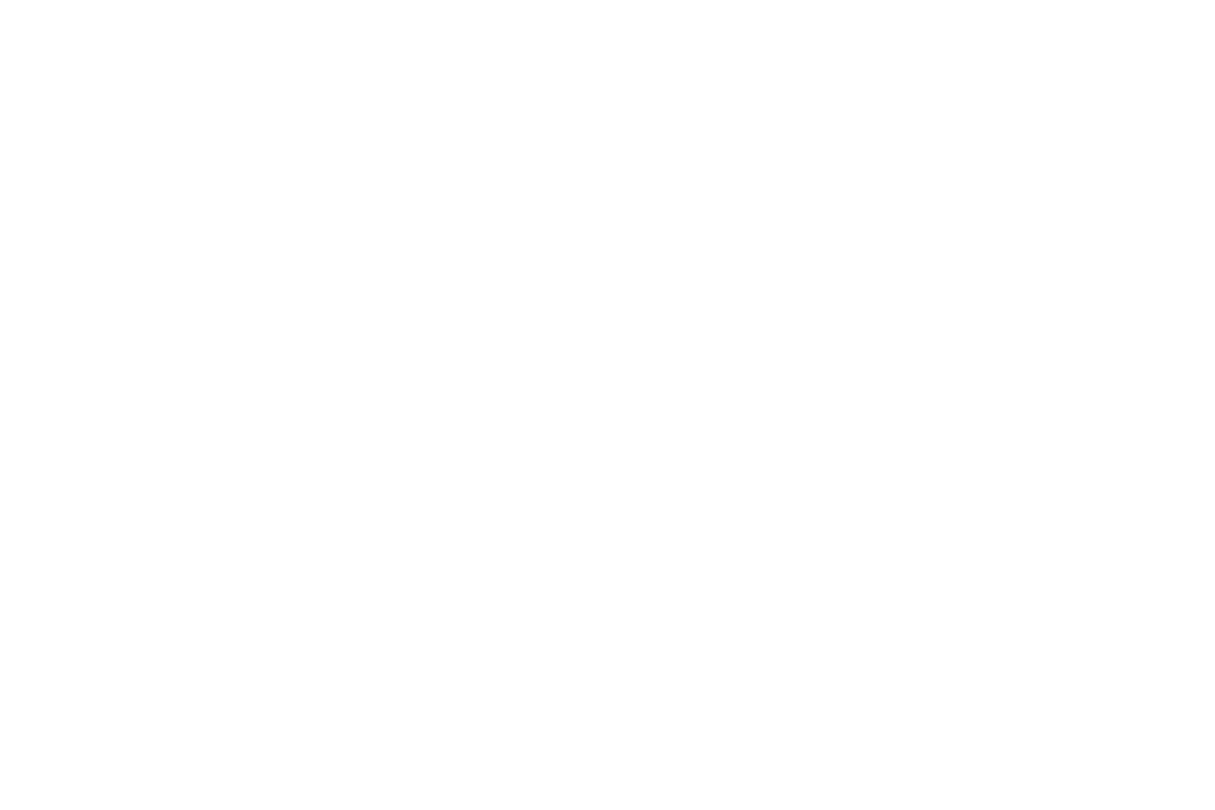


Aus Leipzig kommend, möchte man den Dresdnern, auch denen, die vorzeitig den Saal verlassen und denen, die am Ende nach Kräften gebuht haben, zurufen: Jauchzet, frohlocket, denn jetzt habt auch ihr einen echten Hartmann. Jetzt könnt ihr selbst erleben, wie es sein kann, das Theater, wenn es die Konventionen sprengt, frei und wild, respektlos und verrückt und, ja, auch anstrengend. Was wirklich ganz und gar nicht hämisch gemeint ist, im Gegenteil.
Gesamtkunstwerk klingt seltsam, ist kaum aussprechbar, trifft es aber. Diese Inszenierung ist, gibt man sich ihr hin, wie eine Droge. Tut man es nicht, kann sie einem, zugegeben, ziemlich auf die Nerven gehen.
Sebastian Hartmann scheint zum Publikum zu sprechen, teils mit der Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz, teils ganz direkt. Sinnlich will er verstanden werden und nicht mit dem Verstand, hören wir. Nicht um den Roman geht es, sondern um die Zuspitzung von Alltagserfahrungen, nicht um die Handlung, sondern um den Sound.
Vor allem um den Sound! Hier soll keine Geschichte erzählt werden, hier werden Konventionen gebrochen. Die Metaebenen jagen einander. Exkurse über Exkurse, die – folgt man ihnen – ein Manifest des Hartmannschen Theaters ergeben. Surrealismus, Psychoanalyse, Dramaturgie, die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft, die ‚Sozialfunktion des Asozialen‘. Alles hat mit allem zu tun, Dostojewski wird ‚denaturalisiert‘ und einem ‚Wirklichkeitsbombardement‘ unterzogen. Auch selbstironisch geht es zu: immer mal wieder fallen Sätze, die das Ganze auf die Schippe nehmen. ‚Wollen wir dieser Szene nicht ein Ende machen?‘ (zustimmender Szenenapplaus).
Für alles zusammen aber gilt: der will nur spielen, und zwar ganz und gar. Dafür ist er gebucht, und also macht er es. Der hat auch Selbstzweifel, das klingt an, aber er bezwingt sie. Kompromisslos. Wahrscheinlich ist diese gedankliche Freiheit wirklich nur mit einer Portion Größenwahn zu erreichen. Nichts anderes ist es, was in Dresden zu sehen war, vor den Augen vieler Fans aus Berlin und Leipzig: großes, größenwahnsinniges Theater. Apropos, Frank Castorf saß Reihe 10 Mitte, sozusagen platzhaltend auf dem Regieplatz. Hätte er noch ein Theater und suchte er eine neue Sophie Rois – Nadja Stübiger wäre sicher auf der Liste. Torsten Ranft, um im Bilde zu bleiben, agierte streckenweise hübchenhaft. Wie überhaupt das Ensemble auf der Bühne einfach nur sehr sehenswert war. Sehr!
Das beste Sinnbild für diesen Abend aber ist das Gemälde von Tilo Baumgärtel, das auf der anfangs leeren Leinwand entsteht. Es wird gesprayt und gemalt, dann immer wieder übermalt und verfeinert. Schicht für Schicht wird aufgetragen, mit Projektionen aufgefüllt – bis alles einen Sinn ergibt. Erst am Ende ist es ein fertiges Bild, das hin- und hergeschoben und gedreht wird, als suche es seinen Platz auf der Welt(bühne) und schließlich ganz vorne an der Rampe zu stehen kommt. So wie auch das Stück erst am Ende und in all seinen Schichten und Übermalungen und Exkursen als Stück erkennbar ist. Einer der letzten Sätze, die gesprochen werden, ist eine Frage: ‚Was ist das?‘ – Kein Dostojewski, ein Hartmann.
Dresden hat eine neue Sehenswürdigkeit.“
Der ‚Sound‘ dieser Inszenierung, also der Grundton, ist eine Art hastig erregter Überdruck: Der Regisseur überträgt die Seins-, Habens- und Liebesproblematik der Vorlage praktisch in die Grundaufgeregtheit eines nervösen Zeitalters, das vielleicht sogar unseres ist.
Worte werden hier eher stakkatohaft hervorgestoßen als erfühlt, abgeschmeckt und wohlartikuliert versendet. Dazu kreiert Hartmann, der auch wieder sein eigener Bühnenbildner ist, im Zusammenspiel mit Adriana Braga Peretzkis grandiosen, in Schwarz-Weiß gehaltenen Kostümen suggestive Bilder – von ewigen Kreisläufen, von Permanenz-Überblendung und mithin Dauerüberforderung, von Beschleunigung und bewusstem Stillstand. Es gibt Exkurse über Exkurse, von der Liebe über den Surrealismus bis zum Schauspiel im Allgemeinen und Besonderen und wieder zurück.
Wenn man den finalen Publikumsreaktionswiderstreit zum Maßstab nimmt, ist dieser Dresdner Hartmann so gelungen wie lange kein Theaterabend mehr: Passionierter Jubel und ebenso leidenschaftliche ‚Buh, Geld zurück‘-Rufe halten sich die Waage. So ein Hallo erlebt man tatsächlich nicht mehr oft im Theater. Und auch sonst hat das Staatsschauspiel Dresden mit diesen fast dreistündigen, pausenlosen ‚Erniedrigten und Beleidigten‘ einen außergewöhnlichen Abend in seinem Programm. Einen wirklich in jeder Hinsicht hundertprozentig ‚Tatort‘-fernen.“
Um Handlung und die Handlung bebildernden Realismus geht es Sebastian Hartmann nicht, auch nicht um die Zeitfolge des Romans, vielmehr um ‚Tollhausgeschwätz‘ und ‚Aufregungssound‘, den er aus dem Roman destilliert. ‚Das ist kein Dostojewski mehr!‘, gibt Schauspieler Viktor Tremmel plötzlich im Finale zum Besten und hält dann im breitesten österreichischen Dialekt einen längeren Vortrag über Surrealismus und Dadaismus. Und dennoch kommt die Aufführung Dostojewski sehr nahe.
Polyfon, choreografisch, oft in sich wiederholenden Textschleifen, doch vor allem mit geradezu selbstverleugnendem, bewundernswertem schauspielerischen Einsatz, oft dabei sehr komödiantisch: die Schauspieler, etwa Torsten Ranft als Fürst Valkovskij oder Nadja Stübiger als Mutter. Eindrucksvoll auch, wie aufgeregt tänzerisch Yassin Trabelsi über Realismus (nach Wolfram Lotz) zu dozieren weiß.
Egoismus als eigentlicher Altruismus, verdrängte und dadurch offenkundige Todesängste, Egoismus des Leidens, Zynismus als Humanismus: Dostojewskis Paradoxa entfalten so theatralische Kraft: als epileptische Anfälle, Hysterien, bisweilen als polyphones Konzert. Besonders unter die Haut dabei Nellys Schilderung ihres sexuellen Missbrauchs (Luise Aschenbrenner).
Faszinierend, mit welcher Energie die Schauspieler sich in die einzelnen Rollen, in diese Überdrehtheit, hineingeworfen haben.“
Eigentlich könnte man sich zurücklehnen. Man könnte den Verstand ausschalten und sich dem Sound, den Bildern und der Wucht hingeben. Ab und an könnte man den Fokus auf eine der strampelnden Figuren auf der Bühne richten, sich das Kämpfen ansehen und man könnte weinen vor Ergriffenheit. Natürlich könnte man sich auch ärgern über das Chaos und die Abwesenheit einer nachvollziehbaren Erzählung, man könnte laut protestieren oder vorzeitig den Saal verlassen. All das ist möglich, all das ist passiert. Was ganz sicher nicht geht an diesem Theaterabend: Sich hübsch unterhalten fühlen und auf dem Rückweg in der Straßenbahn über das Wetter plaudern.
Regie führte der ehemalige Leipziger Theaterintendant Sebastian Hartmann, der damit erstmals eine Arbeit für Dresden ablieferte. Sowas gibt es leider selten an diesem Haus: drei Stunden Bilderrausch. Ohne Pause.
Dostojewskis Roman ‚Erniedrigte und Beleidigte‘ ist eine Abhandlung über Kunst, über die Sehnsucht nach Begegnung und die Angst vor dem Absturz. Wird denn eine Geschichte erzählt? Oh ja, und ob. Sie bildet den Rhythmus, den Grundpuls des Abends. Wanja, ein erfolgloser Autor im St. Petersburg des 19. Jahrhunderts, verzweifelt an der Liebe, begehrt Natascha, die aber Aljoscha versprochen ist und doch nicht von Wanja lassen kann. Zudem hadert er mit seinem Selbstwertgefühl. Typische Neuzeit-Probleme halt.
Moritz Kienemann hatte schon in der Ausnahme-Inszenierung ‚Das große Heft‘ beeindruckt, hier spielt er nun mit ungeheurem Druck diesen Wanja. Natascha wird wunderbar flirrig gespielt von Fanny Staffa. Luise Aschenbrenner ist eine besorgniserregend schmale Nelly. Sie leidet unter epileptischen Anfällen, doch wenn sie zuckend am Boden liegt, wird sie begrabscht und missbraucht. Lukas Rüppel ist ein starker, hadernder Aljoscha. Torsten Ranft spielt Fürst Walkowski, der schon nach fünf Minuten nackt auf die Bühne kommt und klagt: ‚Ich habe so ein Geltungsbedürfnis!‘ In der Tat, er ist der Despot, der sein Ego nie zurückstellen kann. Sebastian Hartmanns künstlerische Herkunft ist die Berliner Volksbühne. Man merkt das, wenn die erzählten Geschichten ironisch durchgeschüttelt werden.
Hartmanns ganz eigenes Erkennungszeichen jedoch sind die Stimmungsflächen, in denen die Musik anschwillt, Nebel den Saal flutet oder das Licht gleißt. Der Bass dröhnt bis in den Bauch, vielleicht muss man sich kurz die Ohren zuhalten. Hier verdichtet sich die Geschichte in einem zutiefst poetischen Moment: in blanker Verzweiflung, bodenloser Freude oder dem Bewusstwerden des Scheiterns. Theater wie diesem wird ja oft vorgeworfen, es schätze den Ursprungstext nicht wert. Dabei nimmt wahrscheinlich kaum jemand die Essenz des Stoffs so ernst wie Hartmann.
Alles ist zerrüttet, und doch hören die Menschen nicht auf, nach Halt in der Liebe zu suchen, nach Kontakt und Reibung. Es ist im Grunde auch das, was Hartmann in seinen Theaterkunstwerken tut: Er fahndet nach dem, was das Leben hält – und das kann eben niemals stringent, vielleicht nicht mal nachvollziehbar geschehen.
Es hat lange nicht mehr einen so wütenden Applaus am Dresdner Staatsschauspiel gegeben. Jubel trifft auf ‚Buh! Geld zurück!‘-Rufe. Aber wie gesagt: Gut so. Wer sich ärgert, spürt wenigstens etwas.“
Neun fulminante Spieler, die durch den Roman preschen. Düster, undurchsichtig, heiterst, schrill, hilflos, aufgeheizt, selbstvernichtend, beladen nachdenklich.
Zum Premierenschluss ein Bravo-Sturm, auch Kontra-Chöre. Wunderbar aufgebracht alle. Und Schönheit also: Wo nach Wahrheit getastet wird, da muss ein Wirrwahr her, der uns peinigt. Bravo!“
Die ist, bei allen dem Eingeweihten ersichtlichen Anspielungen und Bezügen und trotz aller unauflösbar schillernden Ironie, insgesamt alles andere als eine Parodie, sondern im Grunde die geniale Extraktion eines Schlüsselwerkes aus dem 19. Jahrhundert ins 21.
Postdramatisches Theater also, Collage, Event, Spektakel, Party, einerseits mit allem zur Genüge strapazierten Beiwerk, andererseits konsequent und diszipliniert.“
Hartmann bietet expressionistisches Theater. Einen atemlosen Mix aus Inszenierung und Improvisation, der oft nur ahnen lässt, wo die Grenze verläuft. Die Kostüme sind angelehnt ans Zeitgenössische. Das Stück kommt mit wenigen Requisiten aus, darunter ein rollbares Bett und eine übergroße mobile Leinwand. Darauf entstehend über die Dauer der Aufführung ein von den Schauspielern erstelltes düsteres schwarz-weißes Gemälde.
Das famose neunköpfige Ensemble ist unentwegt in Bewegung, monologisiert und brüllt, nicht selten durcheinander.
Es fordert volle Konzentration, den gewittrigen Gedankenströmen zu folgen, die anderen Text ins Stück mit hineinnehmen (Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz).
Hartmanns Inszenierung ist lebendiges, vor Kraft fast berstendes Theater, so dramatisch wie selbstironisch, wenn etwa die Schauspieler selbst in Frage stellen, was sie tun. Ein multimediales Spektakel, das die Zuschauer gleichzeitig überwältigt und zurückstößt. Wer sich nicht zurückstoßen lässt, erlebt fiebriges, großartiges Theater.“
Hartmann empfängt das Publikum fast besinnlich mit waberndem Nebel und musikalischen Klängen. Doch schnell wird deutlich: Aus dem Dickicht herausfinden müssen die Zuschauer selbst.
Im Mittelpunkt des Spiels steht eine riesige Leinwand, die Zentimeter um Zentimeter mit Graffitis besprüht, durch Projektionen ergänzt, immer wieder hin- und hergeschoben wird. Mit seiner Installation liefert Tilo Baumgärtel ein beeindruckendes Kunstwerk, das seinen tieferen Sinn erst spät offenbart.
Erzähler nehmen sie mit auf ihre Reise in die irreale Welt. Doch der Regisseur lässt die Kommentatoren immer wieder zurückkehren zu Dostojewski.
Es ist lange her, dass eine Inszenierung so polarisiert hat. Reichlich diskutiert wurde schon nach der Premiere im Foyer. So soll Theater sein.“
Ein Perpetuum Mobile wie dieser Abend, der sich im Kreis dreht wie das Krankenhausbett und die fahrbare Leinwand, wie der Text, der sich in endlosen Wiederholungsschleifen verloopt, der nur deshalb nicht immer wieder an seinem Anfang landet, weil es diesen nicht gibt, weil alles Gegenwart und Jetzt und Anfang und Mitte und Ende ist. Immer. Keine Atempause, Gegenwart wird gemacht, der Nebel durchbrochen und erneuert. Dieses Theater entgrenzt sich, weil es Leben und Welt und Menschsein meint. Und bleibt doch Theater, weil es das sonst nicht könnte. Welch ein Rausch, welch ein Kater.“
Dieses Mal lässt er uns eintauchen in die allmähliche Verfertigung von Figuren, Gedanken, Geschichten und Bildern. Wie bei einem Puzzle setzt sich das nach und nach zusammen, und was anfangs ein verworrenes Knäuel von Erzählfäden war, dröselt sich auf.
Hier sind die Schauspieler ständig in Bewegung, rennen in Kreisen und Spiralen umeinander, erklimmen Leitern vor einer hohen Leinwand, schleppen Farbeimer, ziehen sich an und aus. Statt Konzentration und Engführung der Gedanken ist hier Zerstreuung und Simultanität das Prinzip. Eine dramatische Landschaft in Schwarz-Weiß entsteht, sich wieder und wieder verändernd, auf der Leinwand, ein einsames Kind im Mittelpunkt.
Die Theaterfiguren tänzeln davor in schwarzen und weißen Kleidern, Charaktere schälen sich langsam heraus, der junge Dichter, der nach einem neuen Realismus sucht, der selbstsüchtige Vater, der seinen Sohn an eine reiche Braut verheiraten will, verlassene Töchter, sterbende Waisenkinder, verwirrte Exhibitionisten.
Am Ende bekommt man vier, fünf Geschichten auf Reihe, Episoden aus dem Roman, oder auch nicht. Aber selbst dann ist man eingetaucht in einen Prozess der Erfindung von Bildern und Figuren, die sich in ständigem Abgleich mit existenziellen und philosophischen Fragen nicht auf einen Punkt bringen lassen, sondern abirren, sich verlaufen, neu entwerfen. Das ist, als schaue man in den offenen Schädel eines Dichters, der sich seiner Sache nicht sicher ist.“