Premiere 14.09.2012
› Schauspielhaus
Die Dreigroschenoper
Ein Stück mit Musik in einem Vorspiel und acht Bildern von Bertolt Brecht
nach John Gays „The Beggar’s Opera“
Übersetzt aus dem Englischen von Elisabeth Hauptmann
Musik von Kurt Weill
nach John Gays „The Beggar’s Opera“
Übersetzt aus dem Englischen von Elisabeth Hauptmann
Musik von Kurt Weill
Handlung
1928 begann am Berliner Schiffbauerdamm die Geschichte eines Welterfolgs: Mackie Messer und seine Verbrecherbande, der korrupte Polizist Tiger Brown, der Bettlerkönig Peachum samt Frau und Tochter, die Bettler, Huren und Gauner gehören seither zu den Berühmtheiten des deutschen Theaters und bringen soziale und wirtschaftliche Missstände des Kapitalismus unterhaltsam und bitterböse aufs Tapet.
Zwar basiert der Erfolg des Frühwerks zum Teil auf einem Missverständnis: Eigentlich wollte Brecht vorführen, dass „die Ideenwelt und das Gefühlsleben der Straßenbanditen ungemein viel Ähnlichkeit mit der Ideenwelt und dem Gefühlsleben des soliden Bürgers haben“, es scheint aber, dass das Publikum weniger der Gesellschaftskritik applaudierte als vielmehr den Songs Kurt Weills (die bald schon zu regelrechten Gassenhauern avancierten), der romantischen Handlung und der Liebesgeschichte: Mackie Messer, der Verbrecher mit den Gamaschen, den weißen Glacéhandschuhen und der Narbe am Hals, heiratet Polly Peachum, die Tochter des Bettlerkönigs Jonathan Peachum. Dieser macht das große Geld, indem er die Bettler der Stadt ausstaffiert, um das Mitleid der Bürger zu erregen. Er und seine Frau sehen durch die Heirat Pollys das Fundament ihres Gewerbes bedroht und liefern Mackie ans Messer. Mackie wird von Jenny und den Huren verraten, von denen er aus lieber Gewohnheit nicht lassen mag und steigt am Ende doch wieder vom Galgen herunter.
Regie führt Friederike Heller. Am Staatsschauspiel Dresden entstanden unter ihrer Regie bereits Goethes WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE und Peter Weiss' MARAT / SADE.
Zwar basiert der Erfolg des Frühwerks zum Teil auf einem Missverständnis: Eigentlich wollte Brecht vorführen, dass „die Ideenwelt und das Gefühlsleben der Straßenbanditen ungemein viel Ähnlichkeit mit der Ideenwelt und dem Gefühlsleben des soliden Bürgers haben“, es scheint aber, dass das Publikum weniger der Gesellschaftskritik applaudierte als vielmehr den Songs Kurt Weills (die bald schon zu regelrechten Gassenhauern avancierten), der romantischen Handlung und der Liebesgeschichte: Mackie Messer, der Verbrecher mit den Gamaschen, den weißen Glacéhandschuhen und der Narbe am Hals, heiratet Polly Peachum, die Tochter des Bettlerkönigs Jonathan Peachum. Dieser macht das große Geld, indem er die Bettler der Stadt ausstaffiert, um das Mitleid der Bürger zu erregen. Er und seine Frau sehen durch die Heirat Pollys das Fundament ihres Gewerbes bedroht und liefern Mackie ans Messer. Mackie wird von Jenny und den Huren verraten, von denen er aus lieber Gewohnheit nicht lassen mag und steigt am Ende doch wieder vom Galgen herunter.
Regie führt Friederike Heller. Am Staatsschauspiel Dresden entstanden unter ihrer Regie bereits Goethes WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE und Peter Weiss' MARAT / SADE.
Besetzung
Regie
Friederike Heller
Musikalische Leitung
Bühne
Sabine Kohlstedt
Kostüme
Ulrike Gutbrod
Live-Zeichnungen
Jens Besser
Animation
Stefan Schwarzer
Licht
Michael Gööck
Ton
Torsten Staub, Marion Reiz
Dramaturgie
Felicitas Zürcher
Jonathan Jeremiah Peachum, Chef einer Bettlerplatte
Frau Peachum
Antje Trautmann
Polly, Peachums Tochter
Sonja Beißwenger
Macheath, Chef einer Platte von Straßenbanditen
Brown, Polizeichef von London
Lucy, Browns Tochter
Christine-Marie Günther
Spelunkenjenny, Hure
Sebastian Wendelin
Filch, einer von Peachums Bettlern / Smith, erster Konstabler
Thomas Braungardt
Piano
Baß
Tom Götze
Gitarre, Banjo
Marc Dennewitz
Trompete
Christian Rien
Saxophon, Klarinette
Friedemann Seidlitz
Schlagzeug
Heiko Jung
Schlagzeug alternierend
Sascha Mock
Klarinette
Thomas Seibig
Klarinette alternierend
Dittmar Trebeljahr
Posaune
Christoph Hermann
Video
Gedanken zum Stück
Gedanken zu Brechts „Dreigroschenoper“
von Tobi Müller
von Tobi Müller
Den berühmtesten Song von Bertolt Brecht und Kurt Weill verdanken wir der Eitelkeit eines Schauspielers. Kurz vor der Uraufführung der „Dreigroschenoper“ befand der Darsteller des Macheath, seine Figur sei ungenügend eingeführt. Eine typische Probenkrise. Heutzutage würde der Regisseur, wenn er ein alter Meister ist, einen Wutanfall kriegen. Ein jüngerer Regisseur hingegen würde den Schauspieler zur Seite nehmen und verständnisvoll mit ihm reden. Konsequenzen hätte beides keine. In beiden Fällen müsste anschließend die Dramaturgin dem Schauspieler erklären, warum alles beim Alten bleibt. Nicht so Brecht, der Praktiker, der immer gerne hinhörte, wenn jemand eine gute Idee hatte (wie wir wissen, gilt das auch für viele der Ideen seiner „Mitarbeiterin“ Elisabeth Hauptmann, für Verse von François Villon und vieles mehr). Brecht hörte auch dieses Mal hin, schrieb ein paar Verse, Weill vertonte über Nacht. Zack. „Die Moritat von Mackie Messer“ eröffnete das Stück. Der Schauspieler war zufrieden. Und Brecht hatte einen Welthit, 1928 in Berlin, im Theater am Schiffbauerdamm.
„Und der Haifisch …“: Man hat es sofort im Ohr, dieses Intervall, das dies fordert und nicht ruht (es ist die große Sexte). Vielleicht hat der Haifisch über die Jahrzehnte ein paar Zähne verloren. Vielleicht hat man sich an das ungewöhnliche Intervall gewöhnt. Vielleicht wurde die „Dreigroschenoper“ ein paarmal zu oft von teuer geschmückten Damen und gerade erst wieder aufgewachten Herren beklatscht. Wie kann man heute noch etwas von der sozialen Energie dieses Werkes vermitteln? 1928, Berlin, ein Privattheater. Ein noch immer junger Stückeschreiber und ein Komponist sollen es richten, aber der Komponist ist bestenfalls für atonale Musik berühmt, und der Autor hat wenig in der Hand außer einer Ideenskizze. Eine Schauspielerin wird ständig ohnmächtig bei den Proben, ein anderer springt ab, und Lotte Lenya, Darstellerin der Jenny und auch noch die Frau des Komponisten, wird auf dem Besetzungszettel vergessen. Ein großes Chaos, Erfolg muss man auch zulassen können. Dagegen wirkt der heutige Theaterbetrieb wie eine organisierte Kunstmaßnahme.
Ich möchte aber behaupten, dass das möglich ist: etwas von der vergnüglichen wie bösen Energie von 1928 freizusetzen, und zwar gerade mit der „Dreigroschenoper“. Und ich möchte die These vertreten, dass der Königsweg über den Rhythmus führt. Das kann jetzt vieles heißen. Stille, Pausen, Sprache, Musik. Welches Bild schnell inszeniert wird, welches eher langsam, welche Details Raum kriegen – und Brecht war versessen auf Details, auf Requisiten zum Beispiel und den konkreten Umgang mit ihnen, das wird manchmal vergessen. Ich will hier keine eigene Inszenierung entwerfen, das wäre albern. Aber ich kann Ihnen Friederike Heller, welche die „Dreigroschenoper“ in Dresden inszenieren wird, ans Herz legen als eine Regisseurin, die wie kaum eine zweite ihrer Generation die Verzahntheit von Sprache, Rhythmus und Musik kennt. Heller ist eine musikalische Regisseurin, und das heißt nicht, dass alle ständig säuselnd singen oder dass in den Umbaupausen coole Musik läuft. Es heißt, dass sie weiß, was Rhythmuswechsel bedeuten.
Das Tempo kann Entscheidungen fällen, die alles umdrehen. Wer die ganze Fabel zu langsam oder zu getragen erzählt, sucht die Tragödie. Wer hindurchhüpft, hält sich am Witz und an den Songs fest und legt die reine Komödie nahe. Wenn man das Stück nach langer Zeit wieder einmal liest (gesehen habe ich es sehr lange nicht mehr), merkt man aber sofort, dass man mit reinen Stilmitteln, die heute viele Regisseure für die Wiedererkennbarkeit ihrer Kunst benutzen, dass man mit einem durchgehenden Tempo hier nicht durchkommt.
„Und der Haifisch …“: Man hat es sofort im Ohr, dieses Intervall, das dies fordert und nicht ruht (es ist die große Sexte). Vielleicht hat der Haifisch über die Jahrzehnte ein paar Zähne verloren. Vielleicht hat man sich an das ungewöhnliche Intervall gewöhnt. Vielleicht wurde die „Dreigroschenoper“ ein paarmal zu oft von teuer geschmückten Damen und gerade erst wieder aufgewachten Herren beklatscht. Wie kann man heute noch etwas von der sozialen Energie dieses Werkes vermitteln? 1928, Berlin, ein Privattheater. Ein noch immer junger Stückeschreiber und ein Komponist sollen es richten, aber der Komponist ist bestenfalls für atonale Musik berühmt, und der Autor hat wenig in der Hand außer einer Ideenskizze. Eine Schauspielerin wird ständig ohnmächtig bei den Proben, ein anderer springt ab, und Lotte Lenya, Darstellerin der Jenny und auch noch die Frau des Komponisten, wird auf dem Besetzungszettel vergessen. Ein großes Chaos, Erfolg muss man auch zulassen können. Dagegen wirkt der heutige Theaterbetrieb wie eine organisierte Kunstmaßnahme.
Ich möchte aber behaupten, dass das möglich ist: etwas von der vergnüglichen wie bösen Energie von 1928 freizusetzen, und zwar gerade mit der „Dreigroschenoper“. Und ich möchte die These vertreten, dass der Königsweg über den Rhythmus führt. Das kann jetzt vieles heißen. Stille, Pausen, Sprache, Musik. Welches Bild schnell inszeniert wird, welches eher langsam, welche Details Raum kriegen – und Brecht war versessen auf Details, auf Requisiten zum Beispiel und den konkreten Umgang mit ihnen, das wird manchmal vergessen. Ich will hier keine eigene Inszenierung entwerfen, das wäre albern. Aber ich kann Ihnen Friederike Heller, welche die „Dreigroschenoper“ in Dresden inszenieren wird, ans Herz legen als eine Regisseurin, die wie kaum eine zweite ihrer Generation die Verzahntheit von Sprache, Rhythmus und Musik kennt. Heller ist eine musikalische Regisseurin, und das heißt nicht, dass alle ständig säuselnd singen oder dass in den Umbaupausen coole Musik läuft. Es heißt, dass sie weiß, was Rhythmuswechsel bedeuten.
Das Tempo kann Entscheidungen fällen, die alles umdrehen. Wer die ganze Fabel zu langsam oder zu getragen erzählt, sucht die Tragödie. Wer hindurchhüpft, hält sich am Witz und an den Songs fest und legt die reine Komödie nahe. Wenn man das Stück nach langer Zeit wieder einmal liest (gesehen habe ich es sehr lange nicht mehr), merkt man aber sofort, dass man mit reinen Stilmitteln, die heute viele Regisseure für die Wiedererkennbarkeit ihrer Kunst benutzen, dass man mit einem durchgehenden Tempo hier nicht durchkommt.
Aus einem einfachen Grund: weil im Stück bereits so viel gespielt wird. Der Bettlerkönig Peachum verkleidet seine Bettler gegen Geld kunstvoll als Bettler, damit sie mehr Mitleid erregen. Seine Tochter Polly spielt mit dem Verbrecher Macheath eine Kleinbürgerhochzeit im Pferdestall. Und die Huren von Turnbridge evozieren ein „bürgerliches Idyll“, wie es Brechts Regieanweisung will.
Es sind also mehrere Geschwindigkeiten am Werk, noch bevor überhaupt jemand zu singen beginnt. Wie macht man das klar, richtig klar? Denn dass diese Gesellschaft gerade auch ganz unten die Zeichen der Obrigkeit annehmen will, ist zentral für den gänzlich unromantischen Brecht. Gibt es vielleicht eine Geschwindigkeit für den Umgang mit der Bühne und den Requisiten, eine für die Sprache und noch mal eine für die Musik?
Und gibt es eine Geschwindigkeit für die Komödie? Denn eine Komödie ist die „Dreigroschenoper“ sicher, in dem Sinne, als sie belustigt vorführt, welche Geschichten sich die Menschen erzählen, welche lächerlichen Lügen, so verständlich, bei Brecht geradezu notwendig diese auch sein mögen.
Brechts Dramaturgie, wir kennen es auswendig, zielt auf die Veränderung, weshalb er die herrschenden Verhältnisse eine Zeit lang als aussichtslos darstellen muss respektive als derart antagonistisch, dass sich der Zuschauer den Umsturz von allein ausdenkt. Es mag noch so vieles schiefgehen, wir lachen immer über die Einbildungen der Figuren, die uns im Wortsinn vorgeführt werden. Das ist ein Vorgang der Distanzierung (was nicht heißen muss, dass die Schauspieler nicht alles aufbieten, um uns für ihre Figuren einzunehmen). Während die Tragödie das Scheitern auskostet, feiert die Komödie das Gelingen – bei Brecht heißt Gelingen, dass das Publikum die Einbildungen der Figuren erkennt, dass es die sorgsam gemachten Lebenslügen erkennt als Symptom der Verhältnisse. In diesem Sinn ist Brecht ein Komödienautor. Und in diesem Modell hört die Komödie eher auf den Rhythmus der Veränderung, die Tragödie lauscht dagegen der Melodie, die immer auf einer Fermate zur Ruhe kommt.
Dass das bisschen Theatertheorie kein Schwarzbrot sein muss, wusste der einigermaßen junge Brecht der „Dreigroschenoper“, und auch der alte hat es wieder gemerkt. Es war das lange Exil dazwischen, das den Stückeschreiber bisweilen grimmig werden ließ. Ohne Praxis hat es die Strenge immer leichter. Die Verspieltheit und die Zitatwut der Verse, die rumpelnde Mischung aus Moderne und Vaudeville in der Musik, die kontrollierte Anarchie im Rhythmus und der Eigensinn der Melodie entscheiden das Spiel, ob eine Inszenierung gelingt, immer wieder von Neuem. So wie Brecht und Weill spürten, dass der eitle Schauspieler vermutlich recht hatte, muss man spüren können, dass dieses kreative, immer ein Stück weit unkontrollierte Loslassenkönnen in der Musik verborgen liegt. Oder zumindest das Versprechen darauf.
Tobi Müller war in der Schweiz Redakteur bei Zeitungen und beim Fernsehen. Mittlerweile lebt er in Berlin, arbeitet frei für verschiedene Medien und moderiert regelmäßig Veranstaltungen zu Pop- und Theaterthemen. „Rhythm of Change“ schrieb er als Originalbeitrag für das Spielzeitheft 2012.2013.
Es sind also mehrere Geschwindigkeiten am Werk, noch bevor überhaupt jemand zu singen beginnt. Wie macht man das klar, richtig klar? Denn dass diese Gesellschaft gerade auch ganz unten die Zeichen der Obrigkeit annehmen will, ist zentral für den gänzlich unromantischen Brecht. Gibt es vielleicht eine Geschwindigkeit für den Umgang mit der Bühne und den Requisiten, eine für die Sprache und noch mal eine für die Musik?
Und gibt es eine Geschwindigkeit für die Komödie? Denn eine Komödie ist die „Dreigroschenoper“ sicher, in dem Sinne, als sie belustigt vorführt, welche Geschichten sich die Menschen erzählen, welche lächerlichen Lügen, so verständlich, bei Brecht geradezu notwendig diese auch sein mögen.
Brechts Dramaturgie, wir kennen es auswendig, zielt auf die Veränderung, weshalb er die herrschenden Verhältnisse eine Zeit lang als aussichtslos darstellen muss respektive als derart antagonistisch, dass sich der Zuschauer den Umsturz von allein ausdenkt. Es mag noch so vieles schiefgehen, wir lachen immer über die Einbildungen der Figuren, die uns im Wortsinn vorgeführt werden. Das ist ein Vorgang der Distanzierung (was nicht heißen muss, dass die Schauspieler nicht alles aufbieten, um uns für ihre Figuren einzunehmen). Während die Tragödie das Scheitern auskostet, feiert die Komödie das Gelingen – bei Brecht heißt Gelingen, dass das Publikum die Einbildungen der Figuren erkennt, dass es die sorgsam gemachten Lebenslügen erkennt als Symptom der Verhältnisse. In diesem Sinn ist Brecht ein Komödienautor. Und in diesem Modell hört die Komödie eher auf den Rhythmus der Veränderung, die Tragödie lauscht dagegen der Melodie, die immer auf einer Fermate zur Ruhe kommt.
Dass das bisschen Theatertheorie kein Schwarzbrot sein muss, wusste der einigermaßen junge Brecht der „Dreigroschenoper“, und auch der alte hat es wieder gemerkt. Es war das lange Exil dazwischen, das den Stückeschreiber bisweilen grimmig werden ließ. Ohne Praxis hat es die Strenge immer leichter. Die Verspieltheit und die Zitatwut der Verse, die rumpelnde Mischung aus Moderne und Vaudeville in der Musik, die kontrollierte Anarchie im Rhythmus und der Eigensinn der Melodie entscheiden das Spiel, ob eine Inszenierung gelingt, immer wieder von Neuem. So wie Brecht und Weill spürten, dass der eitle Schauspieler vermutlich recht hatte, muss man spüren können, dass dieses kreative, immer ein Stück weit unkontrollierte Loslassenkönnen in der Musik verborgen liegt. Oder zumindest das Versprechen darauf.
Tobi Müller war in der Schweiz Redakteur bei Zeitungen und beim Fernsehen. Mittlerweile lebt er in Berlin, arbeitet frei für verschiedene Medien und moderiert regelmäßig Veranstaltungen zu Pop- und Theaterthemen. „Rhythm of Change“ schrieb er als Originalbeitrag für das Spielzeitheft 2012.2013.





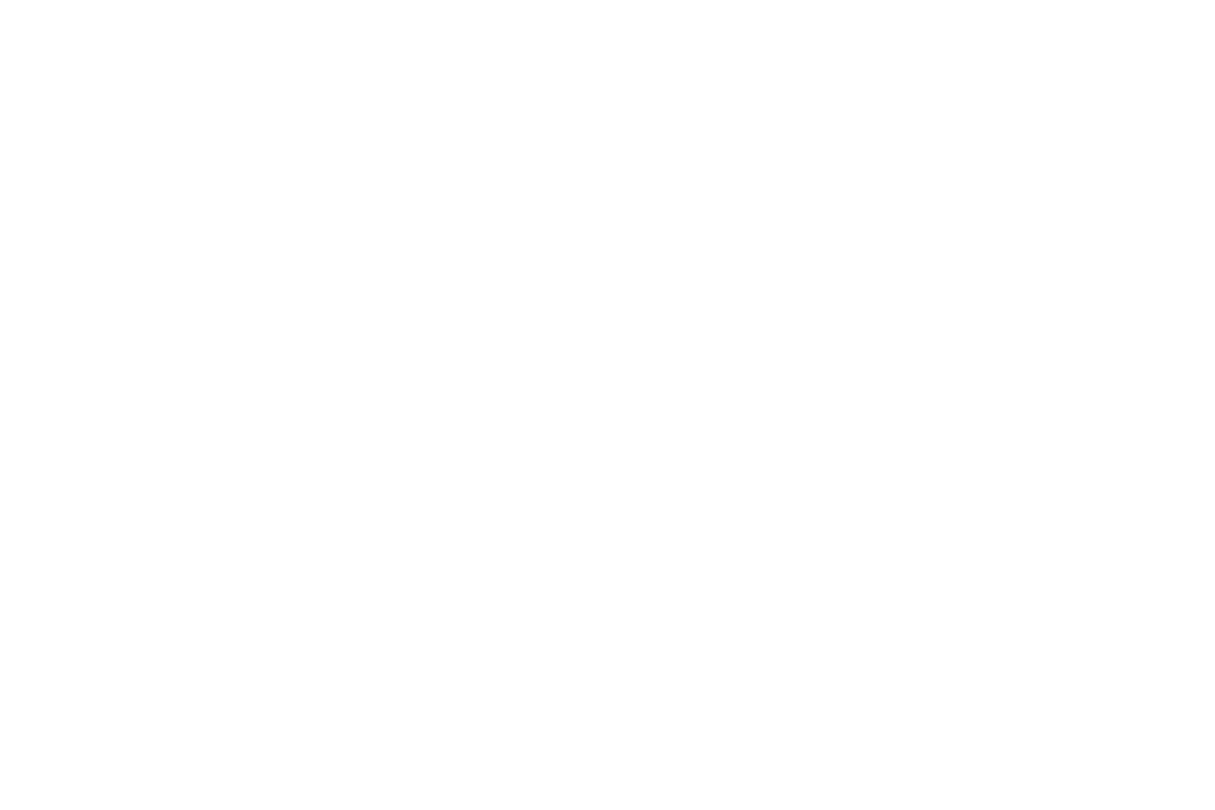

Unterhaltungsoffensive mit konzeptionellem Gütesiegel: Besser hätte die Saisonauftakt-Inszenierung, die gleichzeitig die 100. Spielzeit des Dresdner Schauspielhauses einläutet, kaum ausfallen können.“
Christian Friedel spielt Mackie Messer als weichen Charmeur mit Hang zu beiden Geschlechtern. Sonja Beißwenger steht als edles Showgirl an seiner Seite. Antje Trautmann ist eine wunderbar schnodderig-ordinäre Frau Peachum. Thomas Eisen hat als Bettlerkönig den Appeal eines alten Westernstars. So brutal, wie Benjamin Höppner den korrupten Polizeipräsidenten abliefert, hat man ihn lange nicht gesehen. Dann ist da noch Sebastian Wendelin, als Spelunkenjenny ein magischer Mittelpunkt des Abends, zu dessen Signatur der ‚Salomon-Song‘ als trauriges Lied von den gefallenen Stars wird.“
Ein geschmeidiger, unberechenbarer Macheath ist Christian Friedel, Sonja Beißwenger eine ebenso verführerische wie clevere Polly, Antje Trautmann die verruchte Misses Peachum und Thomas Eisen ihr mit allen Wassern gewaschener Mann.“
Viel Beifall.“
Und das Premierenpublikum lässt sich gerne einwickeln, die Songs sind Selbstläufer, hier und da wird schon mal mit gesummt Unterhaltendes Musiktheater im Dresdner Zentrum – bitte mehr davon!“
Bemerkenswert auch Sebastian Wendelin. Er verleiht als Mann der Hure Spelunkenjenny eine überraschend feminine Eleganz.“