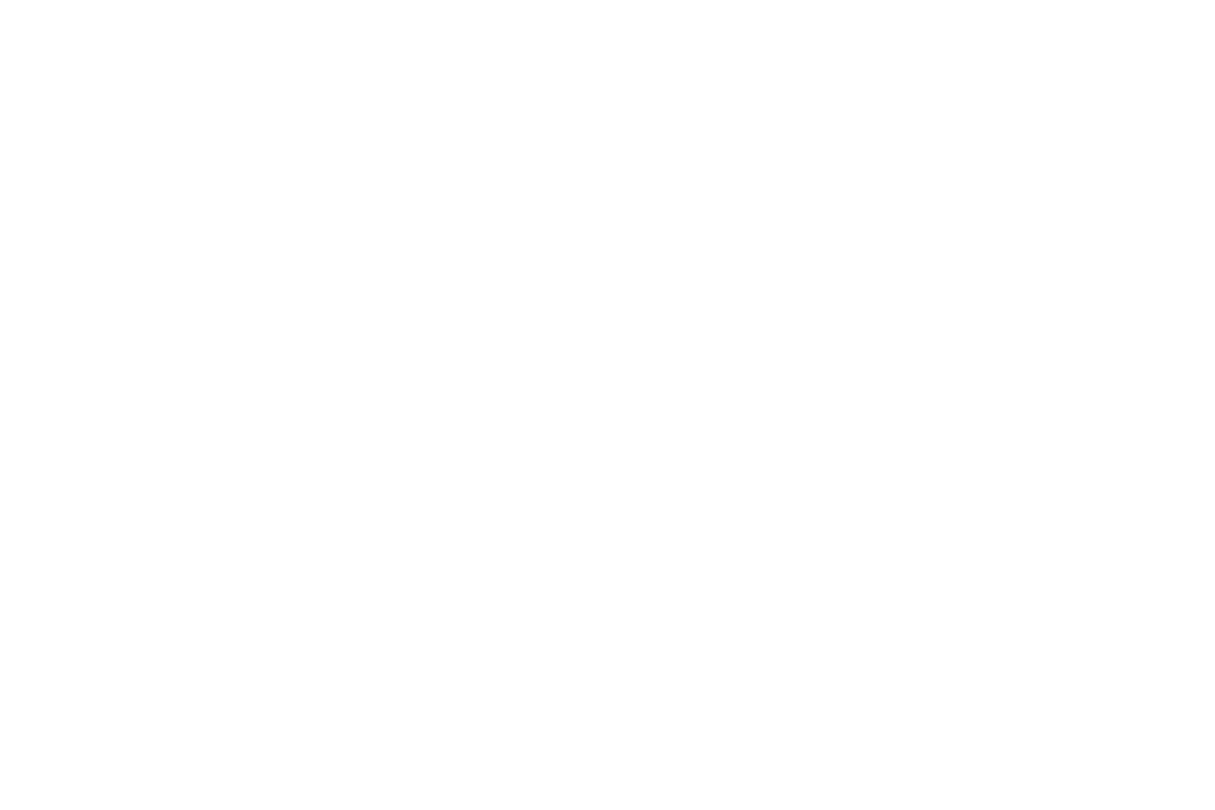Uraufführung 03.10.2014
› Kleines Haus 3
Zwischenspiel
nach dem Roman von Monika Maron
Bühnenfassung von Felicitas Zürcher
Bühnenfassung von Felicitas Zürcher
Handlung
Irgendwie ist dieser Morgen anders. Erst zieht eine einzelne Wolke am Himmel in die entgegengesetzte Richtung, dann sitzt plötzlich die tote Schwiegermutter Olga im Sessel, zu deren Beerdigung Ruth an diesem Tag fahren will. Auf dem Weg zum Friedhof verfährt sie sich denn auch gründlich, und als in dem Park, in dem sie landet, Olga neben ihr auf der Bank Platz nimmt, wundert sie sich eigentlich kaum noch. Im Gespräch mit der Toten, zu der sich bald ein weiterer gesellt, tastet sich Ruth langsam zurück in die Vergangenheit und stellt sich die Fragen nach Schuld und Verantwortung vielleicht zum ersten Mal wirklich – in privatem, künstlerischem und politischem Zusammenhang. Hat auch sie sich vielleicht schuldiger gemacht, als sie dachte? Und wie hätte die richtige Wahl zwischen zwei falschen Entscheidungen ausfallen können?
Mit Klugheit, Sanftmut und feinem Humor schickt Monika Maron ihre Protagonistin auf eine Reise in ihre Vergangenheit und ihr eigenes Unterbewusstes. Die 1941 geborene Autorin, die in der DDR aufwuchs und 1989 in die BRD emigrierte, fragt in ihrem jüngsten Roman nach den Konsequenzen von Entscheidungen und nach der bisweilen gewagten oder geschönten Konstruktion einer eigenen Biografie. 25 Jahre nach dem Ende der DDR kreisen diese Fragen immer noch wie Gespenster um die (Über-)Lebenden, verfolgen sie, prägen sie und lassen sie nicht los. Und 25 Jahre friedliche Revolution, Mauerfall und Wende bieten eine Gelegenheit, sie erneut ins Zentrum zu rücken.
Monika Marons Debüt „Flugasche“ wurde wie ihre folgenden Bücher (u. a. „Das Missverständnis“ und „Stille Zeile Sechs“) vom Fischer Verlag in Frankfurt am Main veröffentlicht, sodass sie bereits vor 1989 auch einem westdeutschen Publikum bekannt wurde. Zuletzt erschienen von ihr „Bitterfelder Bogen. Ein Bericht.“ sowie „Zwei Brüder: Gedanken zur Einheit 1989 – 2009“. Malte Schiller wurde 1983 bei Hamburg geboren. Er studierte Germanistik und Geschichte in Göttingen, wo er erste Theatererfahrungen am Jungen Theater Göttingen und in der Offszene sammelte. Anschließend assistierte er am Deutschen Theater Berlin. Seit der Spielzeit 2012/2013 ist Malte Schiller Regieassistent am Staatsschauspiel Dresden. Hier arbeitete er u. a. mit den Regisseuren Tilmann Köhler, Armin Petras, Barbara Bürk und Thomas Birkmeir zusammen. In der Spielzeit 2013/2014 richtete er E. T. A. Hoffmanns „Der Sandmann“ im Kleinen Haus 3 ein. Außerdem ist er mitverantwortlich für die Theaterreihe „Schund Royal – Bibliothek der billigen Gefühle“.
Mit Klugheit, Sanftmut und feinem Humor schickt Monika Maron ihre Protagonistin auf eine Reise in ihre Vergangenheit und ihr eigenes Unterbewusstes. Die 1941 geborene Autorin, die in der DDR aufwuchs und 1989 in die BRD emigrierte, fragt in ihrem jüngsten Roman nach den Konsequenzen von Entscheidungen und nach der bisweilen gewagten oder geschönten Konstruktion einer eigenen Biografie. 25 Jahre nach dem Ende der DDR kreisen diese Fragen immer noch wie Gespenster um die (Über-)Lebenden, verfolgen sie, prägen sie und lassen sie nicht los. Und 25 Jahre friedliche Revolution, Mauerfall und Wende bieten eine Gelegenheit, sie erneut ins Zentrum zu rücken.
Monika Marons Debüt „Flugasche“ wurde wie ihre folgenden Bücher (u. a. „Das Missverständnis“ und „Stille Zeile Sechs“) vom Fischer Verlag in Frankfurt am Main veröffentlicht, sodass sie bereits vor 1989 auch einem westdeutschen Publikum bekannt wurde. Zuletzt erschienen von ihr „Bitterfelder Bogen. Ein Bericht.“ sowie „Zwei Brüder: Gedanken zur Einheit 1989 – 2009“. Malte Schiller wurde 1983 bei Hamburg geboren. Er studierte Germanistik und Geschichte in Göttingen, wo er erste Theatererfahrungen am Jungen Theater Göttingen und in der Offszene sammelte. Anschließend assistierte er am Deutschen Theater Berlin. Seit der Spielzeit 2012/2013 ist Malte Schiller Regieassistent am Staatsschauspiel Dresden. Hier arbeitete er u. a. mit den Regisseuren Tilmann Köhler, Armin Petras, Barbara Bürk und Thomas Birkmeir zusammen. In der Spielzeit 2013/2014 richtete er E. T. A. Hoffmanns „Der Sandmann“ im Kleinen Haus 3 ein. Außerdem ist er mitverantwortlich für die Theaterreihe „Schund Royal – Bibliothek der billigen Gefühle“.
Besetzung
Regie
Malte Schiller
Bühne
Kostüme
Julia Pommer
Musik
Kriton Klingler-Ioannides
Dramaturgie
Felicitas Zürcher
Licht
Andreas Kunert
Ruth
Olga / Fanny u. a.
Bruno / Bernhard u. a.
Matthias Luckey
Hendrik / Nicki u. a.
Max Rothbart
Video
Pressestimmen
Geistergespräche im Park
Der Literaturredakteur Michael Hametner über „Zwischenspiel“ als Totenbeschwörung
Heiner Müller hat 1988 in einem Gespräch erklärt: „Die Funktion von Drama ist Totenbeschwörung – der Dialog mit den Toten darf nicht abreißen, bis sie herausgeben, was an Zukunft in ihnen begraben worden ist.“ Der Roman von Monika Maron betreibt Totenbeschwörung. Vergangenheit ist, das sieht Monika Maron nicht anders als Heiner Müller, der entscheidende Stoff, aus dem Zukunft wird.
Es beginnt so: Ruth, 61, Mitarbeiterin in einem Museum für bildende Kunst in Berlin, hat an diesem Tag eine Verabredung. Eine von der Art, wie wir sie nicht so gern haben. Ruth will zum Friedhof. Olga, die Neunzigjährige, wäre beinah Ruths Schwiegermutter geworden und hat die letzte Verabredung kurz zuvor abgesagt. Nachgeholt werden kann sie nicht mehr, Olga ist tot. Heute ist ihre Beerdigung. Aber Ruth, die am Vortag Blumen gekauft hat, sich im Büro entschuldigt hat, wird den Friedhof nie erreichen. Schuld ist eine Himmelsbeobachtung. Als sie auf ihrem Balkon eine Zigarette raucht, sieht sie am Himmel Wolken ziehen, alle in eine Richtung, alles normal, wäre da nicht eine kleine Wolke, die in die entgegengesetzte Richtung schwebt. Das überraschende Phänomen beobachtet Ruth etwas zu lange, denn die gleißende Sonne blendet sie. Danach ist ihr Sehen fürs Erste verändert. Eine Sehstörung. Statt des Friedhofs erreicht Ruth einen ihr bisher unbekannten Park. Und dort trifft sie Olga, die tote Olga. Alles eine Sehstörung? Vielleicht. Plötzlich kann das Gespräch mit Olga nachgeholt werden.
Wie kann man mit einer Toten reden? In Monika Marons Roman funktioniert es und ist nicht einmal großer Hokuspokus. Für die Autorin sind es nach außen gewendete Selbstgespräche, und weil Friedhofstag ist, sind es Selbstgespräche mit Toten. Schließlich hat Ruth zurzeit eine Sehstörung, also warum sollte sie Olga nicht neben sich auf der Bank im Park sehen, wo sie doch sowieso im Moment den reinsten und schönsten Pixelimpressionismus vor Augen hat. Jetzt, wo Olga tot ist und trotzdem neben ihr auf der Bank sitzt, muss es doch besprochen werden: Warum ist Ruth nicht Olgas Schwiegertochter geworden? Warum hat sie im letzten Moment den Hochzeitstermin mit Olgas Sohn Bernhard abgesagt? Weil sie nicht zu ihrem eigenen Kind auch noch Bernhards behinderten Sohn miterziehen wollte. Deshalb ist sie geflüchtet. Ruth hat damals ihr Herz hart gemacht, um sich ein Stück Freiheit zu erhalten. Jetzt kann Ruth Olga endlich eingestehen, dass sie sich schuldig gefühlt hat. Und hört von Olga, dass sie Ruth ein Stück für deren Mut bewundert hat. Ja, sagt Olga, man will immer sein, wer man nicht ist … Aber man hat nur ein Leben.
Dass kann Ruth nicht bestätigen. Ruth hatte mehr als ein Leben, vielleicht vier, vielleicht sechs, sagt sie. Und sie kann sich gar nicht mehr an alle Leben erinnern. Sie erkennt nicht, wer plötzlich neben ihr auf der Bank sein Bier trinkt. Bruno? Aber Bruno, der beste Freund von Ruths zweitem Mann Hendrik, ist doch tot.
Es beginnt so: Ruth, 61, Mitarbeiterin in einem Museum für bildende Kunst in Berlin, hat an diesem Tag eine Verabredung. Eine von der Art, wie wir sie nicht so gern haben. Ruth will zum Friedhof. Olga, die Neunzigjährige, wäre beinah Ruths Schwiegermutter geworden und hat die letzte Verabredung kurz zuvor abgesagt. Nachgeholt werden kann sie nicht mehr, Olga ist tot. Heute ist ihre Beerdigung. Aber Ruth, die am Vortag Blumen gekauft hat, sich im Büro entschuldigt hat, wird den Friedhof nie erreichen. Schuld ist eine Himmelsbeobachtung. Als sie auf ihrem Balkon eine Zigarette raucht, sieht sie am Himmel Wolken ziehen, alle in eine Richtung, alles normal, wäre da nicht eine kleine Wolke, die in die entgegengesetzte Richtung schwebt. Das überraschende Phänomen beobachtet Ruth etwas zu lange, denn die gleißende Sonne blendet sie. Danach ist ihr Sehen fürs Erste verändert. Eine Sehstörung. Statt des Friedhofs erreicht Ruth einen ihr bisher unbekannten Park. Und dort trifft sie Olga, die tote Olga. Alles eine Sehstörung? Vielleicht. Plötzlich kann das Gespräch mit Olga nachgeholt werden.
Wie kann man mit einer Toten reden? In Monika Marons Roman funktioniert es und ist nicht einmal großer Hokuspokus. Für die Autorin sind es nach außen gewendete Selbstgespräche, und weil Friedhofstag ist, sind es Selbstgespräche mit Toten. Schließlich hat Ruth zurzeit eine Sehstörung, also warum sollte sie Olga nicht neben sich auf der Bank im Park sehen, wo sie doch sowieso im Moment den reinsten und schönsten Pixelimpressionismus vor Augen hat. Jetzt, wo Olga tot ist und trotzdem neben ihr auf der Bank sitzt, muss es doch besprochen werden: Warum ist Ruth nicht Olgas Schwiegertochter geworden? Warum hat sie im letzten Moment den Hochzeitstermin mit Olgas Sohn Bernhard abgesagt? Weil sie nicht zu ihrem eigenen Kind auch noch Bernhards behinderten Sohn miterziehen wollte. Deshalb ist sie geflüchtet. Ruth hat damals ihr Herz hart gemacht, um sich ein Stück Freiheit zu erhalten. Jetzt kann Ruth Olga endlich eingestehen, dass sie sich schuldig gefühlt hat. Und hört von Olga, dass sie Ruth ein Stück für deren Mut bewundert hat. Ja, sagt Olga, man will immer sein, wer man nicht ist … Aber man hat nur ein Leben.
Dass kann Ruth nicht bestätigen. Ruth hatte mehr als ein Leben, vielleicht vier, vielleicht sechs, sagt sie. Und sie kann sich gar nicht mehr an alle Leben erinnern. Sie erkennt nicht, wer plötzlich neben ihr auf der Bank sein Bier trinkt. Bruno? Aber Bruno, der beste Freund von Ruths zweitem Mann Hendrik, ist doch tot.
Natürlich bin ich tot, sagt Bruno. Bruno hätte Schriftsteller werden können, verzichtete aber darauf, sein Talent zum Schreiben zu benutzen, weil er die Welt nicht mit durchschnittlichen Büchern behelligen wollte. Hendrik aber wurde Schriftsteller. Er nutzte die Treffen mit Bruno, um dessen Weisheiten zu notieren. Bruno war ein klassischer Verweigerer. Er wurde Säufer aus Schuldvermeidung. In den DDR-Verhältnissen, wo Intelligenz keine Chance hatte, wollte er sich nicht einrichten und versoff lieber vorsätzlich seine geistigen Gaben. Damit ersparte er sich Unglück und Anpassung. Hendrik beklaute Bruno und arbeitete die Dialoge mit Bruno in seinen Roman ein. Ruth und Hendrik beantragten die Ausreise und gingen nach Westberlin. Hendrik ohne Bruno als Souffleur schrieb nur noch durchschnittliche Bücher, die Ehe scheiterte. Und Ruth hat Bruno, das versoffene Wrack, vergessen. Wieder ein Stück Schuld aus einem anderen ihrer vier oder sechs Leben.
Wem begegnet sie als Nächstem im Park der Toten? Einem Hund, blond und mit blauen Augen. Ruth, die Hundeliebhaberin, nennt ihn Nicki. Der gibt ein kleines dunkles Grollen von sich, als ein Paar energisch auf sie zusteuert: Margot Honecker mit Erich Honecker im Schlepptau. Aber weder Margot noch Erich sind einsichtig. Sie wissen nichts von Schuld. Für Bruno ist das nur Nicki gestattet!
Wäre Heiner Müller auch im Park der Toten erschienen, hätte er zu Ruth gesagt: „Aber je stärker die Versuche waren, die Toten unter den Teppich zu kehren, je mehr versucht wurde, von ihnen nicht zu sprechen, desto sperriger sind dann ihre Überreste gewesen. Es ist an der Zeit, die Toten unter dem Teppich hervorzuholen und sie auf die Bühne zu bringen.“ Monika Marons Romanfigur Ruth hätte ihm nicht widersprochen, denn der Roman „Zwischenspiel“ bereitet ihnen eine Bühne: für Geistergespräche im Park.
Angesichts all der Toten im Roman, für die eine momentane minimale Sehschwäche ausreicht, sie als Lebende zu sehen, streichelt Ruth den Hund Nicki umso lieber. Mit Nicki wird der Gespenster-Roman zu einer leisen, wenn auch traurigen Komödie. Ein Happy End hat sie im Roman aber nicht. Mitnehmen kann Ruth den Hund aus diesem Park nicht.
Michael Hametner, geboren in Rostock, studierte Journalistik in Leipzig und war u. a. Leiter des Studententheaters der Leipziger Universität. Er ist Theater-, Literatur- und Hörspielkritiker und seit 1994 Literaturredakteur beim MDR. Außerdem ist Hametner als freier Autor und Herausgeber tätig, zuletzt erschien „Einkreisen. Ein Porträt des Malers Sighard Gille“.
Wem begegnet sie als Nächstem im Park der Toten? Einem Hund, blond und mit blauen Augen. Ruth, die Hundeliebhaberin, nennt ihn Nicki. Der gibt ein kleines dunkles Grollen von sich, als ein Paar energisch auf sie zusteuert: Margot Honecker mit Erich Honecker im Schlepptau. Aber weder Margot noch Erich sind einsichtig. Sie wissen nichts von Schuld. Für Bruno ist das nur Nicki gestattet!
Wäre Heiner Müller auch im Park der Toten erschienen, hätte er zu Ruth gesagt: „Aber je stärker die Versuche waren, die Toten unter den Teppich zu kehren, je mehr versucht wurde, von ihnen nicht zu sprechen, desto sperriger sind dann ihre Überreste gewesen. Es ist an der Zeit, die Toten unter dem Teppich hervorzuholen und sie auf die Bühne zu bringen.“ Monika Marons Romanfigur Ruth hätte ihm nicht widersprochen, denn der Roman „Zwischenspiel“ bereitet ihnen eine Bühne: für Geistergespräche im Park.
Angesichts all der Toten im Roman, für die eine momentane minimale Sehschwäche ausreicht, sie als Lebende zu sehen, streichelt Ruth den Hund Nicki umso lieber. Mit Nicki wird der Gespenster-Roman zu einer leisen, wenn auch traurigen Komödie. Ein Happy End hat sie im Roman aber nicht. Mitnehmen kann Ruth den Hund aus diesem Park nicht.
Michael Hametner, geboren in Rostock, studierte Journalistik in Leipzig und war u. a. Leiter des Studententheaters der Leipziger Universität. Er ist Theater-, Literatur- und Hörspielkritiker und seit 1994 Literaturredakteur beim MDR. Außerdem ist Hametner als freier Autor und Herausgeber tätig, zuletzt erschien „Einkreisen. Ein Porträt des Malers Sighard Gille“.
Tanzende Punkte
Über den unscharfen Blick und das Alltägliche
Ruth kennt sich aus mit Bildern. Als Angestellte des museumspädagogischen Dienstes sind sie das Medium, in dem sie sich heimisch fühlt. Vielleicht erklärt dies, dass es Ruth zwar anfangs beunruhigt, als sie eine Veränderung ihrer Sehorgane feststellt, sie dann aber mit einer bemerkenswerten Offenheit und sogar Freude in diese neue Bilder- und Erfahrungswelt taucht.
Anfangs ist es nur eine leichte Irritation, die Ruth kurz auf Schlaganfall oder Herzinfarkt als Ursache prüft, und auch die rückwärts fliegende Wolke versucht sie noch als optische Täuschung einzuordnen. Dann aber tanzen Punkte und Farben vor Ruths Augen, so dass sie sich in einem impressionistischen Gemälde wähnt. Gegenstände lösen sich auf, um sich neu zusammenzusetzen – ein Zeichen dafür, was später mit der Vergangenheit passieren wird. Doch Ruth fühlt nicht Angst, im Gegenteil: „Die Verwandlung des Alltäglichen in seine impressionistischen Variante!“ ruft sie entzückt aus, und der Genuss steigert sich zu wahrer Euphorie, wenn sie durch die Stadt fährt und blaue Flammen aus der Tankstelle schlagen sieht.
Gegen diese verschwommene Wahrnehmung der Realität setzt sich eine andere ab. Zuerst ist es nur Olga, die Tote, „wie von Liebermann gemalt“, die als Einzige klar zu erkennen, „echt“ ist. Später folgen Bruno und das Ehepaar Honecker, und im gleichen Maß, wie Ruth die Gegenwart aus den Augen verliert, gewinnt die Vergangenheit an Kontur. Der verunfallte Andy, der verlassene Fast-Ehemann Bernhard, der Streit um Hendriks Buch, die Übersiedlung nach West-Berlin ... Ruth blickt in eine andere Zeit, eine andere Dimension, und der unscharfe Blick verhüllt nur die Dinge der realen Welt, Erinnerungen aber lässt er deutlich werden.
Olga wird auch mit einem zweiten Gemälde verglichen, ihre Augen erinnern Ruth an ein Marienbild von El Greco. Diese Ähnlichkeit weist auf Eigenschaften, die Ruth an Olga im Leben bewundert hat, und in deren Genuss sie an diesem Tag noch einmal kommt: Olgas Sanftmut, ihr Interesse für andere Menschen, ihr Verständnis für die Nöte eines Lebens. Der erste Leitsatz, den Olga noch im Sessel in Ruths Wohnung wiederholt, ist denn auch: „Schuld bleibt immer, so oder so.“ Wahrscheinlich war es feige, die Verantwortung für ein behindertes Kind nicht angenommen zu haben. Aber, das impliziert Olgas Satz, vielleicht hätte sich Ruth genauso schuldig gemacht, wenn sie bei Bernhard und Andy geblieben wäre.
Den radikal anderen Entwurf zu Olgas Schuldverständnis verkörpert Bruno, auch er ein Gespenst, ein Toter, der an diesem Tag wieder zum Leben erwacht. Bruno hat sich verweigert, hat sein Talent verschleudert, sein Leben in Unproduktivität verbracht und somit einem Staat, für den Produktion und Arbeit oberste Maxime war, seinen Dienst und seine Mitarbeit versagt. Bruno fällt es leicht, alle anderen zu beschuldigen, er tut es mit Genuss, weil er die Schuld bei den anderen einfach findet: Bei seinem Freund Hendrik, dem er als Inspirationsquelle zu Ruhm und Ansehen als Schriftsteller verholfen hat, und der ihn verraten hat, nachdem er die DDR verlassen hatte. Und natürlich bei Honeckers, in denen Bruno die eigentlich Verantwortlichen dafür sieht, dass er um sein Leben betrogen wurde. Die Vermeidung von Schuld machte Bruno zum Säufer – aber, fragt Ruth, „bedeutet Nichtstun schon Unschuld?“
Es sind große Themen, schwere Vorwürfe, denen sich Ruth und die anderen Figuren stellen, und trotzdem sind es Ereignisse eines im besten Sinne durchschnittlichen Lebens und allgemeingültige Fragen: „Ich habe kein Buch über die DDR geschrieben“, sagt Monika Maron im Gespräch über ihr Buch, „sondern über allgemein menschliche Dinge, über Verrat, Schuld und Verantwortung. Aber in diesem Land, das ich nun einmal kenne, konnten diese Dinge besonders schlimme Folgen haben.“
Der veränderte Blick, den Ruth an diesem Tag besitzt, beeinflusst ihre Sicht auf die dunklen Flecken in der Vergangenheit, lässt sie in anderem Licht erscheinen, auch Bernhards Tätigkeit bei der Stasi. Bernhard hatte damals laut Akten sogar die gemeinsame Tochter Fanny als Spitzel benutzt, um Erkenntnisse über den Staatsfeind Hendrik Kaufmann und seine Frau Ruth einzuholen. Doch was hätte Bernhard tun sollen, als Ruth mit Fanny nach West-Deutschland gehen wollte, ihm seine Tochter entzog? Wie Fanny weiter sehen können? „Manchmal gibt es das Richtige einfach nicht,“ sagt Olga, „und man hat nur die Wahl zwischen dem einen und dem anderen Falschen, und dann weiß sich der Mensch nicht zu helfen.“
Anfangs ist es nur eine leichte Irritation, die Ruth kurz auf Schlaganfall oder Herzinfarkt als Ursache prüft, und auch die rückwärts fliegende Wolke versucht sie noch als optische Täuschung einzuordnen. Dann aber tanzen Punkte und Farben vor Ruths Augen, so dass sie sich in einem impressionistischen Gemälde wähnt. Gegenstände lösen sich auf, um sich neu zusammenzusetzen – ein Zeichen dafür, was später mit der Vergangenheit passieren wird. Doch Ruth fühlt nicht Angst, im Gegenteil: „Die Verwandlung des Alltäglichen in seine impressionistischen Variante!“ ruft sie entzückt aus, und der Genuss steigert sich zu wahrer Euphorie, wenn sie durch die Stadt fährt und blaue Flammen aus der Tankstelle schlagen sieht.
Gegen diese verschwommene Wahrnehmung der Realität setzt sich eine andere ab. Zuerst ist es nur Olga, die Tote, „wie von Liebermann gemalt“, die als Einzige klar zu erkennen, „echt“ ist. Später folgen Bruno und das Ehepaar Honecker, und im gleichen Maß, wie Ruth die Gegenwart aus den Augen verliert, gewinnt die Vergangenheit an Kontur. Der verunfallte Andy, der verlassene Fast-Ehemann Bernhard, der Streit um Hendriks Buch, die Übersiedlung nach West-Berlin ... Ruth blickt in eine andere Zeit, eine andere Dimension, und der unscharfe Blick verhüllt nur die Dinge der realen Welt, Erinnerungen aber lässt er deutlich werden.
Olga wird auch mit einem zweiten Gemälde verglichen, ihre Augen erinnern Ruth an ein Marienbild von El Greco. Diese Ähnlichkeit weist auf Eigenschaften, die Ruth an Olga im Leben bewundert hat, und in deren Genuss sie an diesem Tag noch einmal kommt: Olgas Sanftmut, ihr Interesse für andere Menschen, ihr Verständnis für die Nöte eines Lebens. Der erste Leitsatz, den Olga noch im Sessel in Ruths Wohnung wiederholt, ist denn auch: „Schuld bleibt immer, so oder so.“ Wahrscheinlich war es feige, die Verantwortung für ein behindertes Kind nicht angenommen zu haben. Aber, das impliziert Olgas Satz, vielleicht hätte sich Ruth genauso schuldig gemacht, wenn sie bei Bernhard und Andy geblieben wäre.
Den radikal anderen Entwurf zu Olgas Schuldverständnis verkörpert Bruno, auch er ein Gespenst, ein Toter, der an diesem Tag wieder zum Leben erwacht. Bruno hat sich verweigert, hat sein Talent verschleudert, sein Leben in Unproduktivität verbracht und somit einem Staat, für den Produktion und Arbeit oberste Maxime war, seinen Dienst und seine Mitarbeit versagt. Bruno fällt es leicht, alle anderen zu beschuldigen, er tut es mit Genuss, weil er die Schuld bei den anderen einfach findet: Bei seinem Freund Hendrik, dem er als Inspirationsquelle zu Ruhm und Ansehen als Schriftsteller verholfen hat, und der ihn verraten hat, nachdem er die DDR verlassen hatte. Und natürlich bei Honeckers, in denen Bruno die eigentlich Verantwortlichen dafür sieht, dass er um sein Leben betrogen wurde. Die Vermeidung von Schuld machte Bruno zum Säufer – aber, fragt Ruth, „bedeutet Nichtstun schon Unschuld?“
Es sind große Themen, schwere Vorwürfe, denen sich Ruth und die anderen Figuren stellen, und trotzdem sind es Ereignisse eines im besten Sinne durchschnittlichen Lebens und allgemeingültige Fragen: „Ich habe kein Buch über die DDR geschrieben“, sagt Monika Maron im Gespräch über ihr Buch, „sondern über allgemein menschliche Dinge, über Verrat, Schuld und Verantwortung. Aber in diesem Land, das ich nun einmal kenne, konnten diese Dinge besonders schlimme Folgen haben.“
Der veränderte Blick, den Ruth an diesem Tag besitzt, beeinflusst ihre Sicht auf die dunklen Flecken in der Vergangenheit, lässt sie in anderem Licht erscheinen, auch Bernhards Tätigkeit bei der Stasi. Bernhard hatte damals laut Akten sogar die gemeinsame Tochter Fanny als Spitzel benutzt, um Erkenntnisse über den Staatsfeind Hendrik Kaufmann und seine Frau Ruth einzuholen. Doch was hätte Bernhard tun sollen, als Ruth mit Fanny nach West-Deutschland gehen wollte, ihm seine Tochter entzog? Wie Fanny weiter sehen können? „Manchmal gibt es das Richtige einfach nicht,“ sagt Olga, „und man hat nur die Wahl zwischen dem einen und dem anderen Falschen, und dann weiß sich der Mensch nicht zu helfen.“
Immer weiter schraubt sich Ruth in diese Fragen nach dem Bösen und seinem Ursprung, bis sie gemeinsam mit Olga und Bruno am späteren Nachmittag bei der Frage nach dem Ursprung des Bösen, der göttlichen Willkür und dem Baum der Erkenntnis landet: „Was folgt aus Willkür?“, will Bruno wissen, und auf Ruths schnelle Antwort: „Wut“, kontert er mit: „Falsch: Verantwortung.“ Wenn wir mündig sind und zwischen Gut und Böse unterscheiden können, dann müssen wir auch die Verantwortung dafür übernehmen, ob unsere Taten gut oder böse sind. Diesem Dilemma entkommt nur Nicki, der Hund, der als Wesen ohne Vernunft auch nichts falsch machen kann, der unverstellt und ohne Bewusstsein von Gut und Böse tut, was er tun muss.
Bevor der Tag endet und Ruth den Vorsatz umsetzen kann, ihre Tochter Fanny anzurufen und das schwierige Verhältnis zwischen Mutter, Tochter und Vater anzugehen, drängt das Unbewusste hervor. Nach dem Vergessenen und Verdrängten kommen diffusere Ängste, und wieder ist die Bildende Kunst das Medium. Der Unbekannte, der von sich behauptet, böse zu sein, und auch die Vision, die Ruth sieht, sind Tableau vivants. Es sind Gemälde, zum Leben erwacht, und sie stehen in einer langen literarischen Tradition von lebendigen Porträts und Gemälden, von Gespenstern und Wiedergängern, die aus Bildern kommen. Das Porträt des Bösen stammt von einem unbekannten französischen Meister aus dem 16. Jahrhundert, und die Schlussvision ist Goyas „Das Begräbnis der Sardine“, das Ruth leibhaftig vor Augen steht. Beide lösen ein Unbehagen aus, das einen vor Gemälden bisweilen beschleichen kann. Es ist durch die gleichzeitige An- und Abwesenheit des Porträtierten zu erklären, die das Bild zu einem Dazwischen macht: Die Abgebildeten sind weder anwesend noch abwesend, weder tot noch lebendig. Sie werden zu Gespenstern und Untoten, als Lebendige auf einem Bild fixiert und stillgestellt. Der böse Mann im „Zwischenspiel“ nutzt dieses Unbehagen, das Grauen lustvoll aus. Er spricht vom Genuss des Tötens und von der Bejahung des Bösen, er folgt seinem Trieb, ohne schlechtes Gewissen, ohne Moral. Er ist das Gegenstück zu Nicki, der nicht böse sein kann, weil er das Böse nicht kennt. Der Unbekannte dagegen folgt ungehemmt seiner Lust am Bösen, eine Bestie ohne Moral, ohne „zivilisatorischen Dressurakt“, wie es Bruno beschreibt.
Auch „Das Begräbnis der Sardine“ von Francisco de Goya wird zu einer beängstigenden und beunruhigenden Vision: Die feiernden Menschen, die schon bei Goya etwas Bedrohliches haben, beginnen zu stampfen, formieren sich zu Reihen, skandieren Parolen. Die Frauen verschwinden, Männer in Schwarz dominieren, ihr Rufen klingt wie Krieg. Was als möglicher Blick Goyas in die Zukunft beschrieben ist, kann gleichzeitig die Wiederholung der Vergangenheit sein: „Ein zweiter Versuch ab dem Mittelalter vielleicht?“, ahnt Ruth. Es ist eine Schreckensvision im doppelten Sinne: nicht nur, dass ein weiterer Krieg die Erde überzieht, sondern auch, dass das Rad der Geschichte um einige Jahrhunderte zurückgedreht wird. Es manifestiert sich darin ein radikal anderes Geschichtsverständnis als das, mit dem Ruth aufgewachsen ist: Nicht das Rad der Geschichte, das nicht angehalten werden kann, sondern Geschichte als die ewige Wiederkehr des Gleichen. Durch die letzten Monate, in denen rund um Europa ein Krieg nach dem anderen ausgebrochen ist – Syrien, die Ukraine, Israel, is ... – ist diese Vision ein beunruhigender Blick in die Zukunft, der erschreckend prophetisch ist.
Mit dem Untergehen der Sonne löst sich auch diese Vision auf. Olga und Bruno verschwinden, und auch Nicki wird von seinem Besitzer gerufen. Alleine geht Ruth zu ihrem Auto und kann das Nummernschild im Licht der Laterne klar und deutlich erkennen. Der Tag ist vorbei, das Fenster zur anderen Welt schließt sich. Wahrscheinlich fährt Ruth nach diesem seltsamen Zwischenspiel zurück in ihr normales Leben, aber wer weiß, vielleicht ruft sie tatsächlich ihre Tochter an.
Felicitas Zürcher
Bevor der Tag endet und Ruth den Vorsatz umsetzen kann, ihre Tochter Fanny anzurufen und das schwierige Verhältnis zwischen Mutter, Tochter und Vater anzugehen, drängt das Unbewusste hervor. Nach dem Vergessenen und Verdrängten kommen diffusere Ängste, und wieder ist die Bildende Kunst das Medium. Der Unbekannte, der von sich behauptet, böse zu sein, und auch die Vision, die Ruth sieht, sind Tableau vivants. Es sind Gemälde, zum Leben erwacht, und sie stehen in einer langen literarischen Tradition von lebendigen Porträts und Gemälden, von Gespenstern und Wiedergängern, die aus Bildern kommen. Das Porträt des Bösen stammt von einem unbekannten französischen Meister aus dem 16. Jahrhundert, und die Schlussvision ist Goyas „Das Begräbnis der Sardine“, das Ruth leibhaftig vor Augen steht. Beide lösen ein Unbehagen aus, das einen vor Gemälden bisweilen beschleichen kann. Es ist durch die gleichzeitige An- und Abwesenheit des Porträtierten zu erklären, die das Bild zu einem Dazwischen macht: Die Abgebildeten sind weder anwesend noch abwesend, weder tot noch lebendig. Sie werden zu Gespenstern und Untoten, als Lebendige auf einem Bild fixiert und stillgestellt. Der böse Mann im „Zwischenspiel“ nutzt dieses Unbehagen, das Grauen lustvoll aus. Er spricht vom Genuss des Tötens und von der Bejahung des Bösen, er folgt seinem Trieb, ohne schlechtes Gewissen, ohne Moral. Er ist das Gegenstück zu Nicki, der nicht böse sein kann, weil er das Böse nicht kennt. Der Unbekannte dagegen folgt ungehemmt seiner Lust am Bösen, eine Bestie ohne Moral, ohne „zivilisatorischen Dressurakt“, wie es Bruno beschreibt.
Auch „Das Begräbnis der Sardine“ von Francisco de Goya wird zu einer beängstigenden und beunruhigenden Vision: Die feiernden Menschen, die schon bei Goya etwas Bedrohliches haben, beginnen zu stampfen, formieren sich zu Reihen, skandieren Parolen. Die Frauen verschwinden, Männer in Schwarz dominieren, ihr Rufen klingt wie Krieg. Was als möglicher Blick Goyas in die Zukunft beschrieben ist, kann gleichzeitig die Wiederholung der Vergangenheit sein: „Ein zweiter Versuch ab dem Mittelalter vielleicht?“, ahnt Ruth. Es ist eine Schreckensvision im doppelten Sinne: nicht nur, dass ein weiterer Krieg die Erde überzieht, sondern auch, dass das Rad der Geschichte um einige Jahrhunderte zurückgedreht wird. Es manifestiert sich darin ein radikal anderes Geschichtsverständnis als das, mit dem Ruth aufgewachsen ist: Nicht das Rad der Geschichte, das nicht angehalten werden kann, sondern Geschichte als die ewige Wiederkehr des Gleichen. Durch die letzten Monate, in denen rund um Europa ein Krieg nach dem anderen ausgebrochen ist – Syrien, die Ukraine, Israel, is ... – ist diese Vision ein beunruhigender Blick in die Zukunft, der erschreckend prophetisch ist.
Mit dem Untergehen der Sonne löst sich auch diese Vision auf. Olga und Bruno verschwinden, und auch Nicki wird von seinem Besitzer gerufen. Alleine geht Ruth zu ihrem Auto und kann das Nummernschild im Licht der Laterne klar und deutlich erkennen. Der Tag ist vorbei, das Fenster zur anderen Welt schließt sich. Wahrscheinlich fährt Ruth nach diesem seltsamen Zwischenspiel zurück in ihr normales Leben, aber wer weiß, vielleicht ruft sie tatsächlich ihre Tochter an.
Felicitas Zürcher