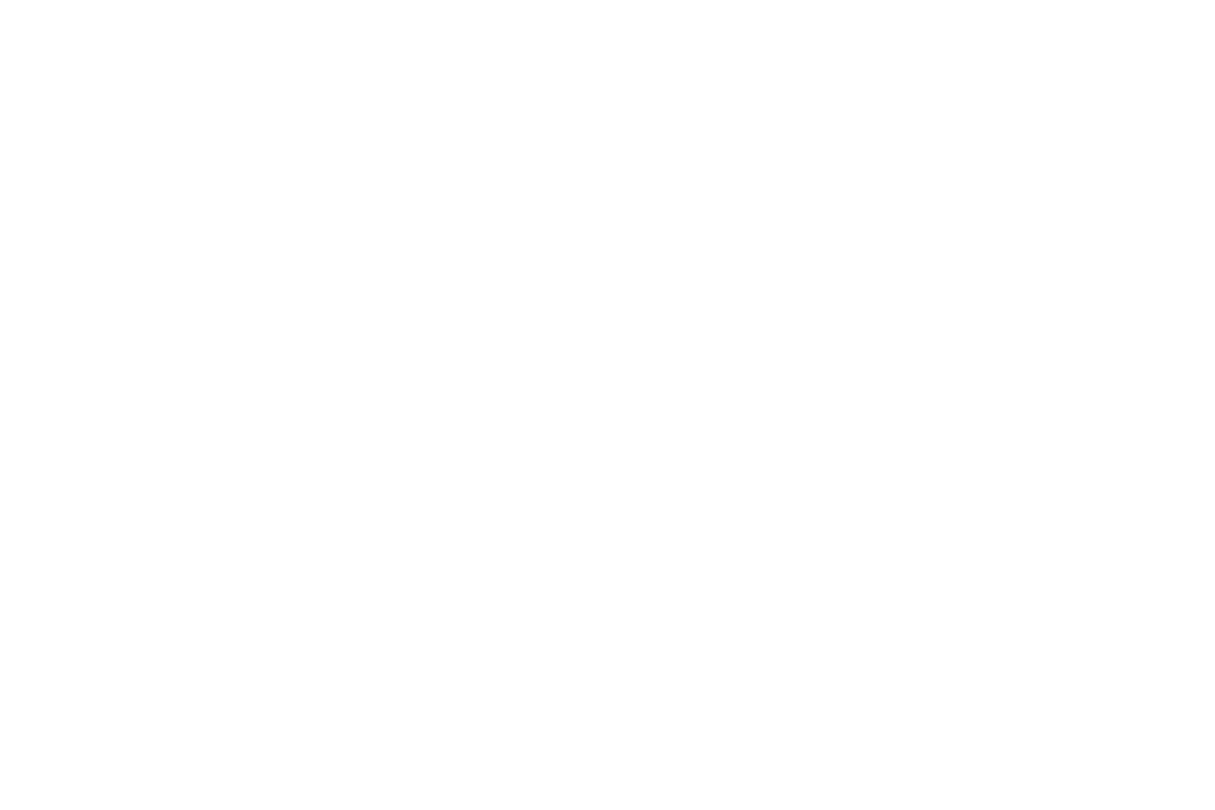Premiere 13.09.2014
› Kleines Haus 1
Wir sind keine Barbaren!
von Philipp Löhle
Handlung
Neben Barbara und Mario sind neue Mieter eingezogen. Die Fitnesstrainerin Sara und der gesellige Paul werden bald zu gern gesehenen Nachbarn. Doch als eines Tages ein Fremder auftaucht, den Sara und Paul sofort abweisen, ist es bald vorbei mit der neuen Freundschaft. Barbara nimmt den Mann kurz entschlossen bei sich auf. Es ist doch klar, dass er, der Klint oder Bobo heißt, ein Asylsuchender aus Afrika ist – oder war es nicht doch Asien? –, dass er auf jeden Fall Hilfe braucht, weil er in seiner Heimat gelitten hat. Klint/Bobo, dessen wahre Identität bis zum Schluss ein Geheimnis bleibt, wird zum Sinnbild für alle Entrechteten und Hilfsbedürftigen dieser Welt. Die Begegnung mit einem von ihnen löst bei den vier Wohlstandsbürgern Abwehr, Schuldgefühle oder erotische Sehnsüchte aus. Begleitet werden sie vom sogenannten Heimatchor, der regelmäßig auftaucht und der als Stimme der wohlanständigen Bürger sein Urteil längst gefällt hat: „wir können nicht mehr bei uns aufnehmen / wir können nicht noch mehr zulassen / wir müssen jetzt alles zu lassen.“
Das Stück des Dramatikers Philipp Löhle erzählt von der gesteigerten Hysterie im Angesicht des Unbekannten. Es wurde im Frühjahr 2014 in Bern uraufgeführt, zu einem Zeitpunkt, als die Schweiz sogenannte „Einwandererkontingente“ beschloss, um eine „Überfremdung“ zu verhindern. Löhle machte 2007 mit seinem Debüt „Genannt Gospodin“ auf sich aufmerksam, seine Texte werden an vielen Theatern im deutschsprachigen Raum gespielt. Regie führt Barbara Bürk, die u. a. Hübners „Frau Müller muss weg“, Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ und zuletzt Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ inszenierte.
Das Stück des Dramatikers Philipp Löhle erzählt von der gesteigerten Hysterie im Angesicht des Unbekannten. Es wurde im Frühjahr 2014 in Bern uraufgeführt, zu einem Zeitpunkt, als die Schweiz sogenannte „Einwandererkontingente“ beschloss, um eine „Überfremdung“ zu verhindern. Löhle machte 2007 mit seinem Debüt „Genannt Gospodin“ auf sich aufmerksam, seine Texte werden an vielen Theatern im deutschsprachigen Raum gespielt. Regie führt Barbara Bürk, die u. a. Hübners „Frau Müller muss weg“, Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ und zuletzt Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ inszenierte.
Besetzung
Regie
Barbara Bürk
Bühne
Anke Grot
Kostüme
Irène Favre de Lucascaz
Musik
Markus Reschtnefki
Dramaturgie
Beret Evensen
Licht
Barbara
Cathleen Baumann
Mario
Raphael Rubino
Sara
Paul
Anna
Cathleen Baumann
Video
Winnetou oder der Fremde in uns
Die Begegnung mit dem Fremden und die Angst vor dem Unbekannten sind zentrale Themen im Stück „Wir sind keine Barbaren!“ Der Dramaturg und Kurator Arved Schultze denkt über diese Motive aus einer ganz anderen Richtung nach und geht unter Zuhilfenahme eines wohlbekannten sächsischen Literaturhelden auf die Suche nach dem Umgang mit dem Anderen.
Kaum verklingen die letzten Töne des „Ave Maria“ in der Prärie, da haucht Winnetou Old Shatterhand die letzten Worte ins Ohr: „Charly, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ. Leb wohl …“ Er stirbt in seinen Armen. Über ihnen auf einem Felsen stehen zu einem Chor vereint die Settler aus dem Fichtelgebirge, die mit dem Lied der „Königin des Himmels“ den letzten Wunsch des sterbenden Apatschenhäuptlings erfüllt haben. Der Kampf mit den feindlichen Sioux hat ihn niedergestreckt, aber gerade noch rechtzeitig gelingt es den Freunden, die aus so verschiedenen Welten kommen, ihre Blutsbrüderschaft auch auf geistiger Ebene zu besiegeln, im christlichen Glauben.
Wir wissen, dass Karl May niemals Nordamerika betreten hat und seine Geschichten pure Fiktion sind. Doch für ihn lagen Dichtung und Wahrheit so nah beieinander, dass er am Ende diese nicht mehr zu trennen wusste. Winnetou, einst der Fremde, wurde zu einem unverzichtbaren Teil seiner eigenen Identität. Und so komponierte er sogar den Chorsatz des „Ave Maria“ selbst. Er lässt ihn feierlich sterben, aber Winnetou darf nicht in seinem Glauben an den Großen Manitu aus der Welt treten, denn dann würden die Freunde an der Schwelle des Todes getrennt. Winnetou würde in den ewigen Jagdgründen verschwinden, in die Karl ihm – trotz aller Verbundenheit – nicht folgen möchte. Und so ist es an Winnetou, sich zu bekehren, um ein posthumes Wiedersehen im Paradies zu ermöglichen. Noch tief im kolonialistischen Sendungsbewusstsein des 19. Jahrhunderts steckend, treibt May hier die Harmonisierung der Freundschaft bis zur Perfektion.
Das Überraschende an dieser Sterbeszene ist, dass der Leser, nachdem er über gut 1 500 Seiten durch den Wilden Westen geritten ist, fiese Indsmen und Widersacher erlegt hat, am Pfahl gemartert, Kalumet geraucht, Blut mit und für seinen Bruder vergossen und mit Sam Hawkens in der Badewanne gesessen hat, schließlich mit der eigenartigen Erhabenheit des aus bayerischen Kehlen strömenden „Ave Maria“ wieder in seine eigene langweilige Existenz zurückgeschickt wird. Dieser Kontrast setzt auf eine emotionale Wendung der Geschichte, die den tiefen Wunsch ausdrückt, dass die Freundschaft, in der Old Shatterhand eine Heimat gefunden hat, alle kulturellen Differenzen auflöst und sich das Fremde einverleibt. Das letzte „Un-heimliche“ des Fremden wird eliminiert.
Doch warum kann das Fremde nicht bleiben – parallel weiterexistieren in seiner Unauflösbarkeit? Wenn das Fremde die ästhetische Harmlosigkeit des Exotischen überschreitet, entstehen – so scheint es – damals wie in der Gesellschaft von heute Angst und Unbehagen. Und obwohl unser Zusammenleben vielfältiger, globalisiert, schneller im Wandel und Austausch mit dem Anderen geworden ist, sind Xenophobie, Rassismus und offene Fremdenfeindlichkeit allgegenwärtig. Die bulgarisch-französische Philosophin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva verknüpft in ihrer Untersuchung „Fremde sind wir uns selbst“ das Phänomen der kollektiven Angst vor dem Fremden mit der Angst des Individuums vor einer eigenen, ihm fremden „verborgenen Seite“. Hierbei geht sie von der existenzialphilosophischen Position aus, dass jedes Individuum in seiner Subjektivität gefangen und mit sich allein ist.
Wir wissen, dass Karl May niemals Nordamerika betreten hat und seine Geschichten pure Fiktion sind. Doch für ihn lagen Dichtung und Wahrheit so nah beieinander, dass er am Ende diese nicht mehr zu trennen wusste. Winnetou, einst der Fremde, wurde zu einem unverzichtbaren Teil seiner eigenen Identität. Und so komponierte er sogar den Chorsatz des „Ave Maria“ selbst. Er lässt ihn feierlich sterben, aber Winnetou darf nicht in seinem Glauben an den Großen Manitu aus der Welt treten, denn dann würden die Freunde an der Schwelle des Todes getrennt. Winnetou würde in den ewigen Jagdgründen verschwinden, in die Karl ihm – trotz aller Verbundenheit – nicht folgen möchte. Und so ist es an Winnetou, sich zu bekehren, um ein posthumes Wiedersehen im Paradies zu ermöglichen. Noch tief im kolonialistischen Sendungsbewusstsein des 19. Jahrhunderts steckend, treibt May hier die Harmonisierung der Freundschaft bis zur Perfektion.
Das Überraschende an dieser Sterbeszene ist, dass der Leser, nachdem er über gut 1 500 Seiten durch den Wilden Westen geritten ist, fiese Indsmen und Widersacher erlegt hat, am Pfahl gemartert, Kalumet geraucht, Blut mit und für seinen Bruder vergossen und mit Sam Hawkens in der Badewanne gesessen hat, schließlich mit der eigenartigen Erhabenheit des aus bayerischen Kehlen strömenden „Ave Maria“ wieder in seine eigene langweilige Existenz zurückgeschickt wird. Dieser Kontrast setzt auf eine emotionale Wendung der Geschichte, die den tiefen Wunsch ausdrückt, dass die Freundschaft, in der Old Shatterhand eine Heimat gefunden hat, alle kulturellen Differenzen auflöst und sich das Fremde einverleibt. Das letzte „Un-heimliche“ des Fremden wird eliminiert.
Doch warum kann das Fremde nicht bleiben – parallel weiterexistieren in seiner Unauflösbarkeit? Wenn das Fremde die ästhetische Harmlosigkeit des Exotischen überschreitet, entstehen – so scheint es – damals wie in der Gesellschaft von heute Angst und Unbehagen. Und obwohl unser Zusammenleben vielfältiger, globalisiert, schneller im Wandel und Austausch mit dem Anderen geworden ist, sind Xenophobie, Rassismus und offene Fremdenfeindlichkeit allgegenwärtig. Die bulgarisch-französische Philosophin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva verknüpft in ihrer Untersuchung „Fremde sind wir uns selbst“ das Phänomen der kollektiven Angst vor dem Fremden mit der Angst des Individuums vor einer eigenen, ihm fremden „verborgenen Seite“. Hierbei geht sie von der existenzialphilosophischen Position aus, dass jedes Individuum in seiner Subjektivität gefangen und mit sich allein ist.
Der Mensch kann sich selbst nicht sehen, nicht vollständig erkennen. Eine Sicherheit darüber, wie und was er ist, wird es nie geben, auch nicht wenn er versucht, seine Individualität in die explizit vereinheitlichte Identität einer Gruppe einzugliedern. Eine Gesellschaft, so Kristeva, kann sich nur dann ändern, wenn der Staatsbürger aufhört, sich als Teil des Kollektivs zu betrachten, und seine eigene unaufhebbare Fremdheit entdeckt. Erst wenn wir erkennen, dass wir alle eine Gemeinschaft aus Fremden bilden, dann entsteht die Möglichkeit der offenen, angstfreien Begegnung mit dem Anderen. In der Erzählung „Satan und Ischariot“, die Karl May einige Jahre nach der „Winnetou“-Trilogie veröffentlichte, schildert er einen Überraschungsbesuch in Dresden:
„Und da stand er unter der Thür! Winnetou, der berühmte Häuptling der Apatschen in Dresden! Und wie sah der gewaltige Krieger aus! Eine dunkle Hose, eine ebensolche Weste, um welche ein Gürtel geschnallt war, einen kurzen Saccorock; in der Hand einen starken Stock und auf dem Kopfe einen hohen Cylinderhut. Ich sprang auf ihn zu. Wir küßten uns wieder und immer wieder, betrachteten uns in den Zwischenpausen und brachen schließlich in ein herzliches Gelächter aus, was bei dem Apatschen noch nie vorgekommen war. Die Gestalt, in welcher er seinen Shatterhand vor sich sah, war gar so zahm, und die Figur, welche der tapferste Krieger der Apatschen bildete, war so friedlich und so drollig, daß ein Hexenmeister dazu gehört hätte, sich des Lachens zu enthalten.“
Beide Freunde haben sich inzwischen verwandelt. Der Apatsche wirkt plötzlich europäisiert, sein unerwartetes Lachen markiert in diesem Moment den Höhepunkt seiner Assimilation. Aber was ist das für ein Lachen? Der Schrecken über die Zivilisation, die sie am Ende unterworfen hat, bricht lachend heraus und verbindet die beiden. Die vermeintliche Heimat Dresden wird zur Fremde, die die Abenteurer zur Verkleidung zwingt. Wovor müssen wir mehr Angst haben? Vor dem Fremden oder vor einer Zivilisation, in der unsere unterschiedlichen Formen von Fremdheit nicht parallel existieren dürfen? Offenbar zweifelte auch Karl May später an der Echtheit heimatlicher Harmonie. In dieser Szene wird das Fremde nur versteckt, aber es bleibt als geheimes Freundschaftszeichen bestehen. Die vertraute Fremdheit Winnetous bedeutet für den alt gewordenen Charlie das Versprechen, dass auch die Idee der individuellen Freiheit bewahrt bleibt. Denn: „Ich ahnte, weshalb er den Hut nicht abnahm; er hatte die Fülle seines reichen, dunkeln Haares unter denselben verborgen. Ich nahm ihm den Cylinder ab; da wurde es frei und fiel ihm wie ein Mantel über die Schultern und weit auf den Rücken herab.“
Arved Schultze ist Dramaturg und Kurator an diversen Theatern sowie für Festivals im deutschsprachigen Raum und in Südamerika. Er kuratierte u. a. das Kleistfestival zum 200. Todestag des Dichters 2011 am Maxim Gorki Theater Berlin und war in Dresden mitverantwortlich für die Ausstellung „Das neue Deutschland. Von Migration und Vielfalt“ im Deutschen Hygiene-Museum.
„Und da stand er unter der Thür! Winnetou, der berühmte Häuptling der Apatschen in Dresden! Und wie sah der gewaltige Krieger aus! Eine dunkle Hose, eine ebensolche Weste, um welche ein Gürtel geschnallt war, einen kurzen Saccorock; in der Hand einen starken Stock und auf dem Kopfe einen hohen Cylinderhut. Ich sprang auf ihn zu. Wir küßten uns wieder und immer wieder, betrachteten uns in den Zwischenpausen und brachen schließlich in ein herzliches Gelächter aus, was bei dem Apatschen noch nie vorgekommen war. Die Gestalt, in welcher er seinen Shatterhand vor sich sah, war gar so zahm, und die Figur, welche der tapferste Krieger der Apatschen bildete, war so friedlich und so drollig, daß ein Hexenmeister dazu gehört hätte, sich des Lachens zu enthalten.“
Beide Freunde haben sich inzwischen verwandelt. Der Apatsche wirkt plötzlich europäisiert, sein unerwartetes Lachen markiert in diesem Moment den Höhepunkt seiner Assimilation. Aber was ist das für ein Lachen? Der Schrecken über die Zivilisation, die sie am Ende unterworfen hat, bricht lachend heraus und verbindet die beiden. Die vermeintliche Heimat Dresden wird zur Fremde, die die Abenteurer zur Verkleidung zwingt. Wovor müssen wir mehr Angst haben? Vor dem Fremden oder vor einer Zivilisation, in der unsere unterschiedlichen Formen von Fremdheit nicht parallel existieren dürfen? Offenbar zweifelte auch Karl May später an der Echtheit heimatlicher Harmonie. In dieser Szene wird das Fremde nur versteckt, aber es bleibt als geheimes Freundschaftszeichen bestehen. Die vertraute Fremdheit Winnetous bedeutet für den alt gewordenen Charlie das Versprechen, dass auch die Idee der individuellen Freiheit bewahrt bleibt. Denn: „Ich ahnte, weshalb er den Hut nicht abnahm; er hatte die Fülle seines reichen, dunkeln Haares unter denselben verborgen. Ich nahm ihm den Cylinder ab; da wurde es frei und fiel ihm wie ein Mantel über die Schultern und weit auf den Rücken herab.“
Arved Schultze ist Dramaturg und Kurator an diversen Theatern sowie für Festivals im deutschsprachigen Raum und in Südamerika. Er kuratierte u. a. das Kleistfestival zum 200. Todestag des Dichters 2011 am Maxim Gorki Theater Berlin und war in Dresden mitverantwortlich für die Ausstellung „Das neue Deutschland. Von Migration und Vielfalt“ im Deutschen Hygiene-Museum.