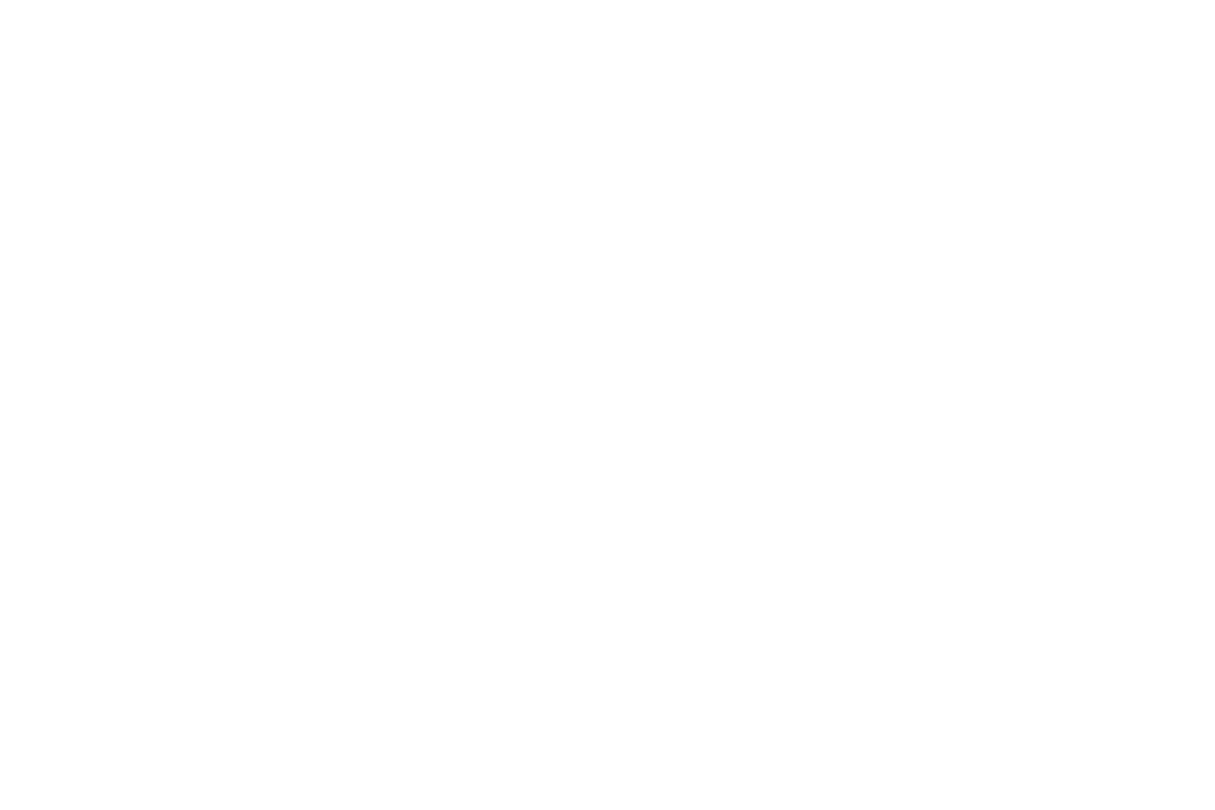Uraufführung 11.09.2010
› Kleines Haus 2
tier. man wird doch bitte unterschicht
von Ewald Palmetshofer
Handlung
Wir sind inmitten einer dörflichen Kleinbürgerödnis. Ein Ort am Rand. Da ist Erika, die ab und zu dem alten Schuldirektor pflegerisch zur Hand geht und am Wochenende kellnert. Da ist der Sohn vom Direktor, der in der Stadt lebt und sich nur selten um den Vater kümmert. Und da ist dieses gemeinsame Erlebnis von vor vielen Jahren, wo die drei sich ziemlich nahegekommen sind. Während der Alte seine Todessehnsucht zelebriert und der Junge sich mit seinem Leben in der Stadt arrangiert, ist es nur Erika, die noch das Warme sucht. Sie glaubt, dass sie den Menschen in ihr drin zum Schmelzen bringen kann, so dass die Wörter kommen. Auf keinen Fall darf das Tier, das die Worte zerfleischt, den Menschen in ihr auffressen. Deshalb kämpft sie gegen die Sprachlosigkeit. Denn das ist es doch, was die Menschen vom Tier unterscheidet: Tiere sprechen nicht.
„tier. man wird doch bitte unterschicht“ ist Ewald Palmetshofers neuestes Stück, das im Rahmen des Dramatiker-Preises des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft (BDI) entstanden ist und von der Regisseurin Simone Blattner uraufgeführt wird. Am Staatsschauspiel Dresden inszenierte sie zuletzt Martin Heckmanns’ „Zukunft für immer“, der 2010 zu den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin eingeladen wurde.
„tier. man wird doch bitte unterschicht“ ist Ewald Palmetshofers neuestes Stück, das im Rahmen des Dramatiker-Preises des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft (BDI) entstanden ist und von der Regisseurin Simone Blattner uraufgeführt wird. Am Staatsschauspiel Dresden inszenierte sie zuletzt Martin Heckmanns’ „Zukunft für immer“, der 2010 zu den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin eingeladen wurde.
Besetzung
Regie
Simone Blattner
Bühne
Simeon Meier
Kostüme
Nadine Grellinger
Dramaturgie
Musikalische Leitung
Licht
Erika / Frau
Cathleen Baumann
Sopran / Expertin / Greißlerin / Kind
Picco von Groote
Alt / Expertin / Freundin / Kind
Sophia Löffler
Counter / Experte / Stammgast / Kind
Stefko Hanushevsky
Tenor / Experte / Direktorssohn / Kind
Bariton / Experte / Freundinnengatte / Kind
Thomas Braungardt
Bass / Experte / alter Direktor / Direktor
Video
Im Gespräch
Die Dramatiker Thomas Freyer, Martin Heckmanns, Lutz Hübner, Dirk Laucke, Jan Neumann und Ewald Palmetshofer im Gespräch über neue Geschichten, deutsche Beißreflexe und das Publikum im Kopf
In der Spielzeit 2009.2010 gab es am Staatsschauspiel Dresden vier Uraufführungen renommierter Autoren sowie ein Projekt mit Texten von fünf Studierenden des Studiengangs Szenisches Schreiben der Universität der Künste in Berlin zu sehen. Auch weiterhin will das Staatsschauspiel Dresden ein Ort sein, an dem Gegenwartsdramatik eine besondere Bedeutung haben soll. Daher haben wir für die kommende Spielzeit wieder Autoren eingeladen, für uns zu schreiben, in der Hoffnung, aus ihren dramatischen Produktionen etwas Neues zu erfahren über die Gegenwart, aktuelle Konflikte und die Welt, in der wir leben.
Martin Heckmanns: Wie findet ihr eure Themen? Auf der Straße, in der Zeitung, oder gibt es eine besondere Form der Suche?
Jan Neumann: Es ist mir erst einmal passiert, dass ich die Zeitung aufgeschlagen und einen Artikel gelesen habe, bei dem ich heulen musste und sofort wusste, dass ich aus der Geschichte ein Stück machen muss. Das habe ich dann auch zwei Wochen später gemacht. Deshalb lese ich jetzt immer fleißig Zeitung, aber leider stellt sich diese Art der inspirierenden Lektüre nicht regelmäßig ein.
Thomas Freyer: Es geht ja eher um die Impulse, die es für ein Stück braucht, weniger um die Themen. Und die Impulse bekomme ich meistens aus konkreten Begegnungen mit einem Problem, das sich nicht sofort erklären oder lösen lässt und das man in einem Text für sich bearbeiten kann. Ein Thema muss die Lust an der Auseinandersetzung wecken, um zu einem Stück zu werden.
Ewald Palmetshofer: Bei mir ist das ähnlich. Die Annäherung an ein Stück geht am ehesten von einem Problem aus, von einer Frage. Bei „hamlet ist tot. keine schwerkraft“ hat sich das z. B. an der Frage nach der Gegenwart entzündet. Was ist sie? Wie bekommt man sie in den Blick? Wie davon sprechen? Was bedeutet eine Handlung, einen Akt setzen, ein Tun erzwingen? Bei meinem Faust-Stück waren es dann das Glück und der Tod, der plötzlich in meine Nähe gekommen ist. Bei meinem neuen Stück „Man wird doch bitte unterschicht“ geht alles von der Frage aus, was ein Subjekt ist und was das Tier Mensch. Das Schreiben beginnt dort, wo ich diese Fragen ins Extrem treibe und mich das bloße Denken nicht mehr weiterbringt.
Dirk Laucke: Mit meinen Geschichten habe ich immer persönlich etwas zu tun. Ich habe einen Job gehabt, der mich angekotzt hat, und ich frage mich, was die Leute wohl jetzt machen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, und was die für Probleme hatten und jetzt noch haben. Für die Bühne verschärfe ich die Konflikte, und dann ist es meistens schon ein Drama. Ich gucke mir bewusst wenig an und lese auch nichts zu dem jeweiligen Thema, weil es mich wahrscheinlich nur verwirren würde, was es dazu alles schon gibt.
Lutz Hübner: Ich lese auch nur in der Vorbereitung Romane oder Studien zu meinem Thema, um mich anzufüttern, aber wenn ich Dialoge schreibe, kann ich dazu nichts mehr lesen. Es sortiert sich dann meistens gut von selbst aus, was hängen bleibt und was in der Schreibphase noch wichtig ist. Und Theaterstücke lese ich nur, wenn ich höre, dass jemand ein ähnliches Thema schon ähnlich behandelt hat.
Zu den großen Themen gibt es meistens schon andere Stücke.
Hübner: Aber selten mit demselben Zugriff. Und letztlich sind es die Details und die eigenen Vorgehensweisen, die die Themen beim Schreiben interessant machen.
Palmetshofer: Ich bin mir da nicht so sicher, inwieweit es tatsächlich zu den großen Themen immer schon andere Stücke gibt. Vielleicht sind manche Themen auch erst zu einer bestimmten Zeit benennbar oder treten erst als Themen in Erscheinung. Wenn ich vorhin vom Subjekt geredet habe oder vom Glück, dann könnte es ja auch sein, dass das heute, jetzt, etwas anderes meint. Dann wäre vielleicht die thematische Überschrift eine bekannte, aber das, was sich darunter versammelt, ist vielleicht neu.
Neumann: Ich würde auch sagen, dass es in erster Linie nicht um das Was, sondern um das Wie der Geschichten geht. Es gibt diese berühmte Anekdote von Billy Wilder, der in der Nacht aufwacht, um eine geniale Idee für einen neuen Film aufzuschreiben, die er im Traum gehabt hat, und am nächsten Morgen steht da geschrieben: „Boy meets girl“. Das ist für mich ein Beispiel dafür, dass die alten Geschichten neu erzählt werden müssen, gespeist aus der subjektiven Lebenserfahrung des Erzählenden.
Freyer: Eine Reaktion darauf, dass es die meisten Geschichten schon gibt, ist bei vielen Autoren die Ironie – man nimmt nichts mehr ernst. Das erlebe ich oft bei meinen Schreibworkshops, dass sich die Schreiber aus den verschiedenen Schubladen ihre Stücke zusammensuchen, und die einzige Haltung, die dahinter zu entdecken ist, ist Ironie. Die einzige Aussage ist dann, dass diese Generation orientierungslos ist und sich ihr Leben zusammensampelt.
Neumann: Das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt, selber zu schreiben, dass ich das Theater der 90er-Jahre viel zu oft als ironisch oder zynisch erlebt habe. Ich habe vermisst, dass Geschichten erzählt werden, die etwas zu tun haben mit dem Menschen, der da unten sitzt, die man ernst nimmt. Das Theater ist für mich einer der letzten werbefreien Räume, die wir haben, und diesen Raum gilt es zu schützen. Und es gibt eine große Sehnsucht, auch des Publikums, nach Geschichten, die mehr sind als eine glatte, abwehrende Oberfläche, nach einem Pfeil mit Widerhaken. Man macht es sich mit dieser zynischen Haltung zu leicht.
Was ist mit zynischem Theater gemeint?
Neumann: Ich fand das in den 90er-Jahren schon sehr stark, gar nicht in erster Linie bei den Autoren, sondern eher in der Art, wie Theater gemacht wurde, dass alles auf Distanz gehalten wurde. Ich habe ja als Schauspieler angefangen und in dieser Zeit sehr oft erlebt, dass ich Regisseure vor mir sitzen hatte, die kein Interesse hatten an einem Text oder an einer Figur, oft nicht einmal an einem Schauspieler, sondern in erster Linie an ihrem gelackten Mercedes vor der Tür.
Hübner: Das war nicht nur eine Regiemarotte, sondern auch eine Tendenz der Kritik, dass Geschichten, die einfach waren oder berühren wollten, fast reflexhaft weggebissen wurden mit der Haltung: Wenn es nicht wehtut, kann es keine Kunst sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass da unten im Parkett die abgebrühten sm-Freier sitzen, die es jetzt härter brauchen. Dann kannst du aber als Autor und auch als Schauspieler eigentlich keine Figuren entwickeln, weil Figuren sich nicht ständig in Extrembereichen bewegen.
Woher kommt dieser Beißreflex?
Hübner: Das scheint mir schon spezifisch deutsch, auch dass Komödien hier extrem schnell weggebissen werden, mit denen die Engländer beispielsweise nicht das geringste Problem haben. Es darf nicht zu komisch sein oder zu berührend, dann ist es populistisch.
Aber ist es nicht auch eine berechtigte Forderung, dass das Theater Grenzen testen soll und auch formal verstörender sein muss als kommerzialisiertes Geschichtenerzählen im Fernsehen? Bietet dieser Ort nicht gerade die Möglichkeit, Formen zu erfinden jenseits von klassischer Dramaturgie und Rollenpsychologie? Muss dieser Freiraum nicht noch viel radikaler genutzt werden? Oder worin besteht der Unterschied zu Film und Fernsehen?
Laucke: Ich habe ein Drehbuch geschrieben, und das Wichtigste an dieser Erfahrung ist die Einsicht, warum die Dinger oft so platt sind: weil da so viele Leute reinquatschen, dass du irgendwann machst, was die dir sagen. Und dass fast ausschließlich über einen möglichst breiten Zuschauerzuspruch nachgedacht wird, bis in die Details der Geschichten hinein.
Hübner: Fernsehen hat eine ganz andere Sprache und es ist eine Industrie, aber ich würde es nicht gegen das Theater ausspielen. Es gibt in beiden Bereichen gelungene Produktionen. Das Besondere der Theatererfahrung ist doch, dass ich 100 oder mehr atmende Menschen neben mir habe und dass das Geschehen auf der Bühne mir näherkommt als auf der Mattscheibe. Das ist der Push, dass es diese Art der gemeinsamen Konzentration gibt. Aber die Verstörung durch einen schockierenden Regieeinfall macht dieses Gemeinsame oft kaputt. Und Verstörung ist nicht per se eine Qualität. Die Härte muss sich aus der Geschichte ergeben und darf kein reiner Geschmacksverstärker sein. Mit diesen Schockeffekten schließt man auch ein bestimmtes Publikum automatisch aus.
Palmetshofer: Ich glaube, im Kern hat der Film einfach kein Sprachproblem, oder anders gesagt: Das Sprechen ist im Film kein Problem oder stellt sich als unproblematisch dar. Im Film dominiert das Bild über das Wort. Und dieses Bild geht mittlerweile bis in die dritte Dimension, in den Hyperrealismus, egal wie imaginär diese Bilder auch sein mögen. Oder wie gebrochen, wenn z. B. versucht wird, Authentizität darzustellen. Für mich ist Theater dem Wort ausgesetzt und dem Problem, dass wir sprechen bzw. sprechen müssen. Das ist auch das, was mich daran interessiert.
Martin Heckmanns: Wie findet ihr eure Themen? Auf der Straße, in der Zeitung, oder gibt es eine besondere Form der Suche?
Jan Neumann: Es ist mir erst einmal passiert, dass ich die Zeitung aufgeschlagen und einen Artikel gelesen habe, bei dem ich heulen musste und sofort wusste, dass ich aus der Geschichte ein Stück machen muss. Das habe ich dann auch zwei Wochen später gemacht. Deshalb lese ich jetzt immer fleißig Zeitung, aber leider stellt sich diese Art der inspirierenden Lektüre nicht regelmäßig ein.
Thomas Freyer: Es geht ja eher um die Impulse, die es für ein Stück braucht, weniger um die Themen. Und die Impulse bekomme ich meistens aus konkreten Begegnungen mit einem Problem, das sich nicht sofort erklären oder lösen lässt und das man in einem Text für sich bearbeiten kann. Ein Thema muss die Lust an der Auseinandersetzung wecken, um zu einem Stück zu werden.
Ewald Palmetshofer: Bei mir ist das ähnlich. Die Annäherung an ein Stück geht am ehesten von einem Problem aus, von einer Frage. Bei „hamlet ist tot. keine schwerkraft“ hat sich das z. B. an der Frage nach der Gegenwart entzündet. Was ist sie? Wie bekommt man sie in den Blick? Wie davon sprechen? Was bedeutet eine Handlung, einen Akt setzen, ein Tun erzwingen? Bei meinem Faust-Stück waren es dann das Glück und der Tod, der plötzlich in meine Nähe gekommen ist. Bei meinem neuen Stück „Man wird doch bitte unterschicht“ geht alles von der Frage aus, was ein Subjekt ist und was das Tier Mensch. Das Schreiben beginnt dort, wo ich diese Fragen ins Extrem treibe und mich das bloße Denken nicht mehr weiterbringt.
Dirk Laucke: Mit meinen Geschichten habe ich immer persönlich etwas zu tun. Ich habe einen Job gehabt, der mich angekotzt hat, und ich frage mich, was die Leute wohl jetzt machen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, und was die für Probleme hatten und jetzt noch haben. Für die Bühne verschärfe ich die Konflikte, und dann ist es meistens schon ein Drama. Ich gucke mir bewusst wenig an und lese auch nichts zu dem jeweiligen Thema, weil es mich wahrscheinlich nur verwirren würde, was es dazu alles schon gibt.
Lutz Hübner: Ich lese auch nur in der Vorbereitung Romane oder Studien zu meinem Thema, um mich anzufüttern, aber wenn ich Dialoge schreibe, kann ich dazu nichts mehr lesen. Es sortiert sich dann meistens gut von selbst aus, was hängen bleibt und was in der Schreibphase noch wichtig ist. Und Theaterstücke lese ich nur, wenn ich höre, dass jemand ein ähnliches Thema schon ähnlich behandelt hat.
Zu den großen Themen gibt es meistens schon andere Stücke.
Hübner: Aber selten mit demselben Zugriff. Und letztlich sind es die Details und die eigenen Vorgehensweisen, die die Themen beim Schreiben interessant machen.
Palmetshofer: Ich bin mir da nicht so sicher, inwieweit es tatsächlich zu den großen Themen immer schon andere Stücke gibt. Vielleicht sind manche Themen auch erst zu einer bestimmten Zeit benennbar oder treten erst als Themen in Erscheinung. Wenn ich vorhin vom Subjekt geredet habe oder vom Glück, dann könnte es ja auch sein, dass das heute, jetzt, etwas anderes meint. Dann wäre vielleicht die thematische Überschrift eine bekannte, aber das, was sich darunter versammelt, ist vielleicht neu.
Neumann: Ich würde auch sagen, dass es in erster Linie nicht um das Was, sondern um das Wie der Geschichten geht. Es gibt diese berühmte Anekdote von Billy Wilder, der in der Nacht aufwacht, um eine geniale Idee für einen neuen Film aufzuschreiben, die er im Traum gehabt hat, und am nächsten Morgen steht da geschrieben: „Boy meets girl“. Das ist für mich ein Beispiel dafür, dass die alten Geschichten neu erzählt werden müssen, gespeist aus der subjektiven Lebenserfahrung des Erzählenden.
Freyer: Eine Reaktion darauf, dass es die meisten Geschichten schon gibt, ist bei vielen Autoren die Ironie – man nimmt nichts mehr ernst. Das erlebe ich oft bei meinen Schreibworkshops, dass sich die Schreiber aus den verschiedenen Schubladen ihre Stücke zusammensuchen, und die einzige Haltung, die dahinter zu entdecken ist, ist Ironie. Die einzige Aussage ist dann, dass diese Generation orientierungslos ist und sich ihr Leben zusammensampelt.
Neumann: Das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt, selber zu schreiben, dass ich das Theater der 90er-Jahre viel zu oft als ironisch oder zynisch erlebt habe. Ich habe vermisst, dass Geschichten erzählt werden, die etwas zu tun haben mit dem Menschen, der da unten sitzt, die man ernst nimmt. Das Theater ist für mich einer der letzten werbefreien Räume, die wir haben, und diesen Raum gilt es zu schützen. Und es gibt eine große Sehnsucht, auch des Publikums, nach Geschichten, die mehr sind als eine glatte, abwehrende Oberfläche, nach einem Pfeil mit Widerhaken. Man macht es sich mit dieser zynischen Haltung zu leicht.
Was ist mit zynischem Theater gemeint?
Neumann: Ich fand das in den 90er-Jahren schon sehr stark, gar nicht in erster Linie bei den Autoren, sondern eher in der Art, wie Theater gemacht wurde, dass alles auf Distanz gehalten wurde. Ich habe ja als Schauspieler angefangen und in dieser Zeit sehr oft erlebt, dass ich Regisseure vor mir sitzen hatte, die kein Interesse hatten an einem Text oder an einer Figur, oft nicht einmal an einem Schauspieler, sondern in erster Linie an ihrem gelackten Mercedes vor der Tür.
Hübner: Das war nicht nur eine Regiemarotte, sondern auch eine Tendenz der Kritik, dass Geschichten, die einfach waren oder berühren wollten, fast reflexhaft weggebissen wurden mit der Haltung: Wenn es nicht wehtut, kann es keine Kunst sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass da unten im Parkett die abgebrühten sm-Freier sitzen, die es jetzt härter brauchen. Dann kannst du aber als Autor und auch als Schauspieler eigentlich keine Figuren entwickeln, weil Figuren sich nicht ständig in Extrembereichen bewegen.
Woher kommt dieser Beißreflex?
Hübner: Das scheint mir schon spezifisch deutsch, auch dass Komödien hier extrem schnell weggebissen werden, mit denen die Engländer beispielsweise nicht das geringste Problem haben. Es darf nicht zu komisch sein oder zu berührend, dann ist es populistisch.
Aber ist es nicht auch eine berechtigte Forderung, dass das Theater Grenzen testen soll und auch formal verstörender sein muss als kommerzialisiertes Geschichtenerzählen im Fernsehen? Bietet dieser Ort nicht gerade die Möglichkeit, Formen zu erfinden jenseits von klassischer Dramaturgie und Rollenpsychologie? Muss dieser Freiraum nicht noch viel radikaler genutzt werden? Oder worin besteht der Unterschied zu Film und Fernsehen?
Laucke: Ich habe ein Drehbuch geschrieben, und das Wichtigste an dieser Erfahrung ist die Einsicht, warum die Dinger oft so platt sind: weil da so viele Leute reinquatschen, dass du irgendwann machst, was die dir sagen. Und dass fast ausschließlich über einen möglichst breiten Zuschauerzuspruch nachgedacht wird, bis in die Details der Geschichten hinein.
Hübner: Fernsehen hat eine ganz andere Sprache und es ist eine Industrie, aber ich würde es nicht gegen das Theater ausspielen. Es gibt in beiden Bereichen gelungene Produktionen. Das Besondere der Theatererfahrung ist doch, dass ich 100 oder mehr atmende Menschen neben mir habe und dass das Geschehen auf der Bühne mir näherkommt als auf der Mattscheibe. Das ist der Push, dass es diese Art der gemeinsamen Konzentration gibt. Aber die Verstörung durch einen schockierenden Regieeinfall macht dieses Gemeinsame oft kaputt. Und Verstörung ist nicht per se eine Qualität. Die Härte muss sich aus der Geschichte ergeben und darf kein reiner Geschmacksverstärker sein. Mit diesen Schockeffekten schließt man auch ein bestimmtes Publikum automatisch aus.
Palmetshofer: Ich glaube, im Kern hat der Film einfach kein Sprachproblem, oder anders gesagt: Das Sprechen ist im Film kein Problem oder stellt sich als unproblematisch dar. Im Film dominiert das Bild über das Wort. Und dieses Bild geht mittlerweile bis in die dritte Dimension, in den Hyperrealismus, egal wie imaginär diese Bilder auch sein mögen. Oder wie gebrochen, wenn z. B. versucht wird, Authentizität darzustellen. Für mich ist Theater dem Wort ausgesetzt und dem Problem, dass wir sprechen bzw. sprechen müssen. Das ist auch das, was mich daran interessiert.
Ich finde auch, dass Sprechen auf der Bühne seine Selbstverständlichkeit verliert und auch der Repräsentationsgedanke in ganz anderer Weise infrage steht. Nur weiß ich nicht, ob und wie der Zuschauer sich für diese theaterinternen Probleme noch interessiert. Habt ihr beim Schreiben ein Publikum im Kopf? Wisst ihr, für wen ihr schreibt oder wen ihr ins Gespräch bringen wollt?
Freyer: Ich habe kein Publikum im Kopf, vielleicht auch weil ich weiß, dass meine Fassung zuerst einmal zu meinem Regisseur kommt. Das ist wichtig für mich, dass ich mit Tilmann Köhler einen mir vertrauten Gesprächspartner habe. Und aus unserer Erfahrung weiß ich, welche Impulse es in der Zusammenarbeit noch nicht gab und welche Sichtweisen noch fehlen.
Laucke: Ich finde es auch schwierig, über Kollektive zu urteilen, dass die so oder so auf die Bühne schauen, auch wenn ich manchmal schon denke, den bürgerlichen Spinnern kannst du mal ordentlich an den Latz kacken. Aber eigentlich schreibe ich die Geschichten, die mir selber gefallen. Das ist das wichtigste Kriterium.
Palmetshofer: Wer das jeweilige Publikum sein wird, kann ich auch nicht sagen. Aber ich versuche, mir vorzustellen, wozu ich das Publikum dort oder da bringen will. Oder verführen. Im besten Fall wäre das so eine Art Arbeit. Dass sich der Theaterabend erst in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer zusammensetzt. Und dass das ohne ihre Arbeit nicht geht.
Neumann: Die direkte Verbindung zum Publikum hat der Schauspieler, deshalb denke ich beim Schreiben auch in erster Linie aus dieser Perspektive. Ich will mich in diesen Figuren sehen und gerne den Weg gehen mit ihnen.
Hübner: Ich entwerfe die Stücke gemeinsam mit meiner Frau, ich arbeite sehr früh mit einem Dramaturgen und mit einem Regisseur zusammen, insofern sind die Ansprechpartner schon in der Schreibphase konkret anwesend. Ich muss die Geschichte sehr früh jemandem erzählen können, und wenn ich nach zwei Sätzen hängen bleibe, dann weiß ich, dass die Geschichte nicht stimmt.
Und hat die Stadt Dresden Einfluss auf euren Text, wenn ihr für das Staatsschauspiel schreibt?
Laucke: Ich frage mich schon, was die Stadt bewegt und was da ein Thema ist. An Dresden z. B. finde ich diese Randlage interessant, aber auch die Spanne zwischen der Kulturstadt und dem Naziaufmarsch am 13. Februar. Da hilft es mir, dass ich im Osten aufgewachsen bin und mich den Leuten vertraut fühle.
Freyer: Aber es liegt auch schnell etwas Vermessenes in diesem Anspruch, aus der Entfernung etwas über eine Stadt sagen zu können.
Palmetshofer: Bei mir ist es dann noch so, dass ich Österreicher bin. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Ich kann da nicht meinen Blick auf diese Stadt anbieten. Das würde keinen interessieren und ohnehin niemand glauben. Da kann ich nur etwas von mir mitnehmen und hoffen, dass das dann was taugt.
Neumann: Ich kenne Dresden zu wenig, aber eine fremde Stadt kann schon Einfluss haben auf den Text, speziell natürlich wenn man wie ich den eigenen Text in dieser Stadt schreibt und inszeniert.
Was habt ihr für Erfahrungen mit euren Regisseuren? Oder was erwartet ihr von einem guten Regisseur?
Neumann: Wenn ich eigene Texte von mir inszeniere, kann ich ziemlich gnadenlos sein. Während ich mit fremden Texten eigentlich sehr vorsichtig umgehe. Und das erwarte ich eigentlich auch von einem anderen Regisseur, dass er zuerst einmal sehr genau hinschaut. Bei neuen Texten vor allem, denn die alten hat man ja in der Regel schon einmal gesehen oder gelesen, aber eine Uraufführung sollte doch erst einmal den Text ernst nehmen, den es vorzustellen gilt. Und wenn das nicht gelingt, will ich wenigstens das Bemühen um Genauigkeit auf der Bühne sehen können.
Hübner: Ich habe meine ersten Stücke auch selbst inszeniert, aber inzwischen bin ich froh, Regisseure zu haben, die etwas weiterentwickeln, was ich nicht mehr weitererfinden kann, dass noch eine andere Fantasie zu dem Text hinzukommt. Ich habe mit dem Text alles gesagt, was ich zu sagen habe.
Freyer: Meine Fantasie ist eigentlich auch fertig, wenn ich den Text geschrieben habe. Ich freue mich, wenn dann ein Regisseur kommt, der mit dem Text arbeitet und auch etwas dagegenstellen kann und sich auseinandersetzt. Bei sehr jungen Regisseuren fehlt da oft die Geduld. Und oft sehe ich auch nicht, warum sie Texte inszenieren – außer um ihren Platz im Theater zu finden.
Palmetshofer: Ich hoffe immer, dass die Regie sich an derselben Frage abarbeiten will, die auch mein Text zu umkreisen versucht. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Und dann wären Text und Regie derselben Sache verpflichtet. Und die Regie nicht einfach nur dem Text. Sondern diesem Dritten. Und manchmal findet sich das auch.
Hübner: Ich finde es extrem hilfreich, eine langjährige Verbindung zu Häusern und zu Regisseuren zu entwickeln, damit Vertrauen entsteht. Auf dieser Grundlage fällt es mir auch leichter, Neues auszuprobieren. Für Hannover habe ich über neun Jahre immer wieder Stücke geschrieben, und spätestens nach dem zweiten Erfolg wird einem auch die Abweichung oder ein Experiment zugestanden.
Hat sich die Position des Autors verändert? Ich frage das auch, weil sich einige der 70-jährigen Kollegen noch regelmäßig in der Öffentlichkeit streiten und Stellung nehmen zu den prominenten politischen Themen, während wir hier schon so lange friedlich beisammensitzen.
Laucke: Ich würde schon Ärger machen, wenn ich wüsste, der Lutz Hübner ist voll die rechtskonservative Sau, aber das ist er einfach nicht.
Hübner: Und diese Auseinandersetzungen der alten Autoren kommen mir eher vor wie Rüdenkämpfe, da geht es doch selten um inhaltliche Differenzen. Und auch diese Gruppenbildungen der 1920er-Jahre, bei denen einer zum Häuptling wird, um die anderen auszuschließen, das sind Prozesse, die Theaterautoren wesensfremd sind.
Neumann: Es geht doch nicht darum, eine Position zu vertreten, sondern unterschiedliche Positionen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Und es interessiert mich eigentlich mehr, eine fremde Position im Schreiben zu überprüfen, die ich selbst nicht teile. Oder von der Schwierigkeit zu erzählen, eine Position einzunehmen.
Palmetshofer: Aber ich glaube schon, dass ein Stück in irgendeiner Weise eine Position einnimmt oder eine Position ist. Und manchmal reibt es dann auch zwischen Stücken. Oder ich reibe mich an dem, was ich als Position unterstelle. In Autorenprojekten gab es darum hin und wieder durchaus Streit, oder auf Proben oder in Dramaturgiesitzungen. Nur nicht öffentlich. Vielleicht gibt es jenseits dessen wenig öffentlichen Streit, wenn man mal von diversen Internetforen absieht, weil das alles irgendwie auch eine Einsamkeitsmaschine ist.
Hübner: In meinem Stück über die Berliner Bankenkrise habe ich am deutlichsten gespürt, was es heißt, Teil einer Debatte zu werden. Aber auch dieser Text war eher eine Aufforderung zum Gespräch als die Verkündigung einer Wahrheit. Theater kann eine Diskussion in Gang setzen, aber auf der Bühne muss jede Figur recht haben. Die Moral steckt in der Perspektive auf die Figuren.
Laucke: Ich habe schon den Anspruch, dass für etwas gestritten wird in den Texten. Dass es Figuren gibt, die nicht klarkommen oder für etwas kämpfen. Oder die einer Ideologie anhängen und an den Umständen scheitern. Ein Stück sollte doch versuchen, etwas aufzureißen oder um Alternativen zu kämpfen.
Freyer: Ich hab nur einmal konkret versucht, in einem Stück eine Utopie zu entwerfen, und es ist ein Märchen daraus geworden.
Warum müssen denn überhaupt immer wieder neue Geschichten erzählt werden?
Hübner: Man kann keine neuen Geschichten erzählen, man überprüft nur die alten Geschichten, um herauszufinden, was sie noch zu sagen haben.
Palmetshofer: Ich sehe mich eigentlich gar nicht als Geschichtenerzähler. Ich würde eher sagen: Man muss immer wieder Fragen stellen.
Neumann: Vielleicht ist es nur die Art zu erzählen, die Sprache, der Blick auf einen Sachverhalt, der sich ändert, und damit eine Notwendigkeit des Wiederbetrachtens, die wichtig ist: aus der Zeit heraus und in die Zeit hinein erzählen, in der man lebt – wieder und wieder.
Laucke: Ich glaube, die Geschichten, die ich erzähle, sind auf jeden Fall schon irgendwie mal erzählt worden. Die verdammten Griechen haben doch schon alles abgedeckt, aber ich habe das Gefühl, die Art und Weise, wie ich die Geschichten erzählen würde, sagen auf jeden Fall etwas über den Zustand der Welt jetzt aus. Und über die Welt bin ich nun mal verunsichert, verwirrt und wütend. Und außerdem komme ich doch aus dem Jetzt. Hoffentlich.
Freyer: Ich habe kein Publikum im Kopf, vielleicht auch weil ich weiß, dass meine Fassung zuerst einmal zu meinem Regisseur kommt. Das ist wichtig für mich, dass ich mit Tilmann Köhler einen mir vertrauten Gesprächspartner habe. Und aus unserer Erfahrung weiß ich, welche Impulse es in der Zusammenarbeit noch nicht gab und welche Sichtweisen noch fehlen.
Laucke: Ich finde es auch schwierig, über Kollektive zu urteilen, dass die so oder so auf die Bühne schauen, auch wenn ich manchmal schon denke, den bürgerlichen Spinnern kannst du mal ordentlich an den Latz kacken. Aber eigentlich schreibe ich die Geschichten, die mir selber gefallen. Das ist das wichtigste Kriterium.
Palmetshofer: Wer das jeweilige Publikum sein wird, kann ich auch nicht sagen. Aber ich versuche, mir vorzustellen, wozu ich das Publikum dort oder da bringen will. Oder verführen. Im besten Fall wäre das so eine Art Arbeit. Dass sich der Theaterabend erst in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer zusammensetzt. Und dass das ohne ihre Arbeit nicht geht.
Neumann: Die direkte Verbindung zum Publikum hat der Schauspieler, deshalb denke ich beim Schreiben auch in erster Linie aus dieser Perspektive. Ich will mich in diesen Figuren sehen und gerne den Weg gehen mit ihnen.
Hübner: Ich entwerfe die Stücke gemeinsam mit meiner Frau, ich arbeite sehr früh mit einem Dramaturgen und mit einem Regisseur zusammen, insofern sind die Ansprechpartner schon in der Schreibphase konkret anwesend. Ich muss die Geschichte sehr früh jemandem erzählen können, und wenn ich nach zwei Sätzen hängen bleibe, dann weiß ich, dass die Geschichte nicht stimmt.
Und hat die Stadt Dresden Einfluss auf euren Text, wenn ihr für das Staatsschauspiel schreibt?
Laucke: Ich frage mich schon, was die Stadt bewegt und was da ein Thema ist. An Dresden z. B. finde ich diese Randlage interessant, aber auch die Spanne zwischen der Kulturstadt und dem Naziaufmarsch am 13. Februar. Da hilft es mir, dass ich im Osten aufgewachsen bin und mich den Leuten vertraut fühle.
Freyer: Aber es liegt auch schnell etwas Vermessenes in diesem Anspruch, aus der Entfernung etwas über eine Stadt sagen zu können.
Palmetshofer: Bei mir ist es dann noch so, dass ich Österreicher bin. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Ich kann da nicht meinen Blick auf diese Stadt anbieten. Das würde keinen interessieren und ohnehin niemand glauben. Da kann ich nur etwas von mir mitnehmen und hoffen, dass das dann was taugt.
Neumann: Ich kenne Dresden zu wenig, aber eine fremde Stadt kann schon Einfluss haben auf den Text, speziell natürlich wenn man wie ich den eigenen Text in dieser Stadt schreibt und inszeniert.
Was habt ihr für Erfahrungen mit euren Regisseuren? Oder was erwartet ihr von einem guten Regisseur?
Neumann: Wenn ich eigene Texte von mir inszeniere, kann ich ziemlich gnadenlos sein. Während ich mit fremden Texten eigentlich sehr vorsichtig umgehe. Und das erwarte ich eigentlich auch von einem anderen Regisseur, dass er zuerst einmal sehr genau hinschaut. Bei neuen Texten vor allem, denn die alten hat man ja in der Regel schon einmal gesehen oder gelesen, aber eine Uraufführung sollte doch erst einmal den Text ernst nehmen, den es vorzustellen gilt. Und wenn das nicht gelingt, will ich wenigstens das Bemühen um Genauigkeit auf der Bühne sehen können.
Hübner: Ich habe meine ersten Stücke auch selbst inszeniert, aber inzwischen bin ich froh, Regisseure zu haben, die etwas weiterentwickeln, was ich nicht mehr weitererfinden kann, dass noch eine andere Fantasie zu dem Text hinzukommt. Ich habe mit dem Text alles gesagt, was ich zu sagen habe.
Freyer: Meine Fantasie ist eigentlich auch fertig, wenn ich den Text geschrieben habe. Ich freue mich, wenn dann ein Regisseur kommt, der mit dem Text arbeitet und auch etwas dagegenstellen kann und sich auseinandersetzt. Bei sehr jungen Regisseuren fehlt da oft die Geduld. Und oft sehe ich auch nicht, warum sie Texte inszenieren – außer um ihren Platz im Theater zu finden.
Palmetshofer: Ich hoffe immer, dass die Regie sich an derselben Frage abarbeiten will, die auch mein Text zu umkreisen versucht. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Und dann wären Text und Regie derselben Sache verpflichtet. Und die Regie nicht einfach nur dem Text. Sondern diesem Dritten. Und manchmal findet sich das auch.
Hübner: Ich finde es extrem hilfreich, eine langjährige Verbindung zu Häusern und zu Regisseuren zu entwickeln, damit Vertrauen entsteht. Auf dieser Grundlage fällt es mir auch leichter, Neues auszuprobieren. Für Hannover habe ich über neun Jahre immer wieder Stücke geschrieben, und spätestens nach dem zweiten Erfolg wird einem auch die Abweichung oder ein Experiment zugestanden.
Hat sich die Position des Autors verändert? Ich frage das auch, weil sich einige der 70-jährigen Kollegen noch regelmäßig in der Öffentlichkeit streiten und Stellung nehmen zu den prominenten politischen Themen, während wir hier schon so lange friedlich beisammensitzen.
Laucke: Ich würde schon Ärger machen, wenn ich wüsste, der Lutz Hübner ist voll die rechtskonservative Sau, aber das ist er einfach nicht.
Hübner: Und diese Auseinandersetzungen der alten Autoren kommen mir eher vor wie Rüdenkämpfe, da geht es doch selten um inhaltliche Differenzen. Und auch diese Gruppenbildungen der 1920er-Jahre, bei denen einer zum Häuptling wird, um die anderen auszuschließen, das sind Prozesse, die Theaterautoren wesensfremd sind.
Neumann: Es geht doch nicht darum, eine Position zu vertreten, sondern unterschiedliche Positionen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Und es interessiert mich eigentlich mehr, eine fremde Position im Schreiben zu überprüfen, die ich selbst nicht teile. Oder von der Schwierigkeit zu erzählen, eine Position einzunehmen.
Palmetshofer: Aber ich glaube schon, dass ein Stück in irgendeiner Weise eine Position einnimmt oder eine Position ist. Und manchmal reibt es dann auch zwischen Stücken. Oder ich reibe mich an dem, was ich als Position unterstelle. In Autorenprojekten gab es darum hin und wieder durchaus Streit, oder auf Proben oder in Dramaturgiesitzungen. Nur nicht öffentlich. Vielleicht gibt es jenseits dessen wenig öffentlichen Streit, wenn man mal von diversen Internetforen absieht, weil das alles irgendwie auch eine Einsamkeitsmaschine ist.
Hübner: In meinem Stück über die Berliner Bankenkrise habe ich am deutlichsten gespürt, was es heißt, Teil einer Debatte zu werden. Aber auch dieser Text war eher eine Aufforderung zum Gespräch als die Verkündigung einer Wahrheit. Theater kann eine Diskussion in Gang setzen, aber auf der Bühne muss jede Figur recht haben. Die Moral steckt in der Perspektive auf die Figuren.
Laucke: Ich habe schon den Anspruch, dass für etwas gestritten wird in den Texten. Dass es Figuren gibt, die nicht klarkommen oder für etwas kämpfen. Oder die einer Ideologie anhängen und an den Umständen scheitern. Ein Stück sollte doch versuchen, etwas aufzureißen oder um Alternativen zu kämpfen.
Freyer: Ich hab nur einmal konkret versucht, in einem Stück eine Utopie zu entwerfen, und es ist ein Märchen daraus geworden.
Warum müssen denn überhaupt immer wieder neue Geschichten erzählt werden?
Hübner: Man kann keine neuen Geschichten erzählen, man überprüft nur die alten Geschichten, um herauszufinden, was sie noch zu sagen haben.
Palmetshofer: Ich sehe mich eigentlich gar nicht als Geschichtenerzähler. Ich würde eher sagen: Man muss immer wieder Fragen stellen.
Neumann: Vielleicht ist es nur die Art zu erzählen, die Sprache, der Blick auf einen Sachverhalt, der sich ändert, und damit eine Notwendigkeit des Wiederbetrachtens, die wichtig ist: aus der Zeit heraus und in die Zeit hinein erzählen, in der man lebt – wieder und wieder.
Laucke: Ich glaube, die Geschichten, die ich erzähle, sind auf jeden Fall schon irgendwie mal erzählt worden. Die verdammten Griechen haben doch schon alles abgedeckt, aber ich habe das Gefühl, die Art und Weise, wie ich die Geschichten erzählen würde, sagen auf jeden Fall etwas über den Zustand der Welt jetzt aus. Und über die Welt bin ich nun mal verunsichert, verwirrt und wütend. Und außerdem komme ich doch aus dem Jetzt. Hoffentlich.