Premiere 31.05.2019
› Schauspielhaus
Schuld und Sühne
nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewski
in der Übersetzung VERBRECHEN UND STRAFE von Swetlana Geier
unter Verwendung der REDE ZUM UNMÖGLICHEN THEATER von Wolfram Lotz
in der Übersetzung VERBRECHEN UND STRAFE von Swetlana Geier
unter Verwendung der REDE ZUM UNMÖGLICHEN THEATER von Wolfram Lotz
Handlung
Radion Raskolnikow, ein verarmter Student und Held von Dostojewskis großem Roman, hat sich eine Theorie gebaut, nach der er die Menschen in ‚gewöhnliche‘ und ‚ungewöhnliche‘ einteilt. Letztere hätten das Recht, die ersteren als Material für Ihre Ideen und Vorhaben zu behandeln und zu benutzen und eben auch das Recht zu töten. Den Ideen der ‚großen‘ Menschen ist alles unterzuordnen, da nur sie in der Lage seien, etwas Neues zu schaffen. Raskolnikow testet seine Theorie im realen Leben, er ermordet eine Pfandleiherin und als ‚Kollateralschaden‘ auch noch ihre Schwester. SCHULD UND SÜHNE, in der neuen Übersetzung von Sewtlana Geier genauer als VERBRECHEN UND STRAFE übersetzt, ist einer der großen Ideenromane Dostojewskis: Die nihilistische Philosophie Raskolnikows verweist bereits wie ein überlanger Schatten auf die Verbrechen, die das zwanzigste Jahrhundert geprägt haben.
Wie bereits in ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE, eingeladen zum Berliner Theatertreffen 2019, verfolgt der Regisseur Sebastian Hartmann in seiner Inszenierung keine lineare Übertragung der Romanhandlung. Ausgehend von der Frage Dostojewskis, was Menschen zum Töten bringt, was dies mit ihnen macht, untersucht Hartmann den Text nach Motiven und Assoziationen. Die Schauspieler*innen, die Kamera, der Ton und das Licht sind gleichberechtigter Bestandteil in einem Theater-Spiel, in dem nur die Eckpunkte fixiert sind. An jedem Abend entsteht aus den fragmentarisierten Sprachbildern Dostojewskis ein neuer Kosmos und mit ihm die Frage, wie viel vom Syndrom Raskolnikow in uns und unserer Welt ist.
Wie bereits in ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE, eingeladen zum Berliner Theatertreffen 2019, verfolgt der Regisseur Sebastian Hartmann in seiner Inszenierung keine lineare Übertragung der Romanhandlung. Ausgehend von der Frage Dostojewskis, was Menschen zum Töten bringt, was dies mit ihnen macht, untersucht Hartmann den Text nach Motiven und Assoziationen. Die Schauspieler*innen, die Kamera, der Ton und das Licht sind gleichberechtigter Bestandteil in einem Theater-Spiel, in dem nur die Eckpunkte fixiert sind. An jedem Abend entsteht aus den fragmentarisierten Sprachbildern Dostojewskis ein neuer Kosmos und mit ihm die Frage, wie viel vom Syndrom Raskolnikow in uns und unserer Welt ist.
Dauer der Aufführung: ca. 1 Stunde und 50 Minuten.
Keine Pause.
Keine Pause.
Besetzung
Regie und Bühne
Kostüme
Musik
Lichtdesign
Video und Kamera
Tonassistenz
Emily Kuhlmann
Live-Schnitt
Thomas Schenkel, Diana Stelzer
Wandzeichnung
Tilo Baumgärtel
Dramaturgie
Mit
Luise Aschenbrenner, Moritz Kienemann, Philipp Lux, Linda Pöppel, Torsten Ranft, Lukas Rüppel, Fanny Staffa, Nadja Stübiger, Yassin Trabelsi
Musiker
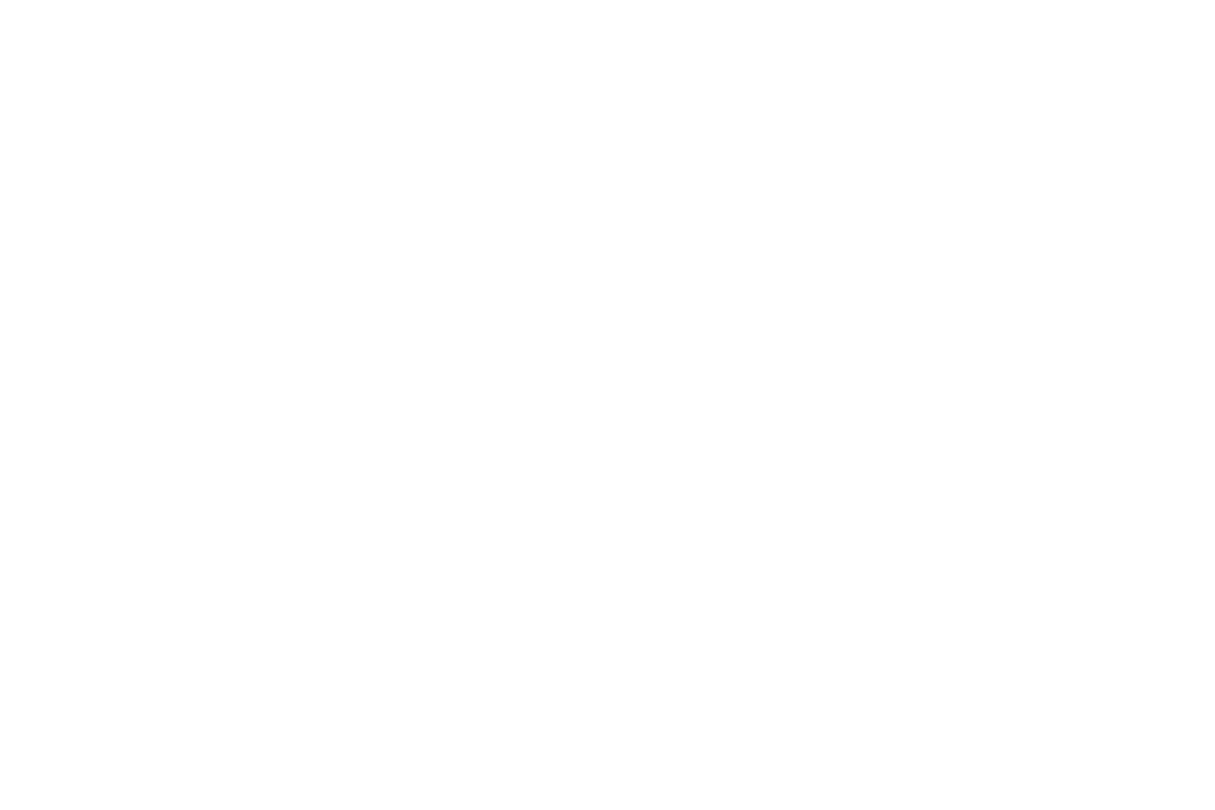

Es geht um Schuld und Sühne. Wer mag, kann hier und da Dostojewskis Raskolnikow heraushören, wie er sich anmaßt, eine ‚Laus‘ von Mitmensch ermorden zu dürfen, weil er ein außergewöhnlicher Mensch sei. Im Grunde spielt das aber keine Rolle, denn der Kontext, den Hartmann setzt, ist weitaus größer und genügt sich selbst. Es ist nicht weniger als die Geschichte der Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts, die auf der Hinterbühne und diversen anderen Projektionsflächen zu sehen ist und diesen Kontext herstellt. Man könnte das dem Abend natürlich vorwerfen, einen Mangel an Dostojewski, sozusagen. Die den Saal verlassen haben, werden es sicher tun. Man kann ihn aber auch dafür preisen, den Dostojewski einmal eben gerade nicht für Regie-Ideen zu verwursten, mit Einsprengseln aus anderen Texten zu verblenden, ihn in eine andere Zeit zu setzen, zu spielen mit ihm, in und neben den Rollen, changierend zwischen Ironie und tieferer Bedeutung. Was Hartmann von Dostojewski nimmt und einbettet in sein totales, gänzlich unironisches Theater aus Bildern und Tönen und Körpern, ist ein Kondensat: eine Schuld-und-Sühne-Maschine, in der es nicht ein einzelner ist, der schuldig wird, sondern der Mensch an sich. Nur, scheint es, hat er es im Gegensatz zu Raskolnikow noch nicht erkannt.
Das wird verstärkt dadurch, dass Hartmann die Übersetzung VERBRECHEN UND STRAFE von Swetlana Geier verwendet. Und einige Sätze daraus, oft nur Stichworte, den übermächtigen Filmbildern zur Seite stellt. Unmöglich, all die Bilder zu nennen oder gar zu analysieren, die über die Bühnenwände und die Kulisse flimmern. Brutale Bilder aus einem brutalen Jahrhundert. So viele Kriege, Morde, Hinrichtungen. Attentate und Attentäter, Mörder und Diktatoren und solche, denen wir es zutrauen. So viel Schuld und so viel Sühne. Bis ins Heute.
Die Musik von Samuel Wiese treibt technoid, dröhnt industriell, klagt melodiös, wird von Kampfgeräuschen unterbrochen. Und sie lässt Pausen. Stille, beklemmende Stille. Das 20. Jahrhundert als Leidensgeschichte. Selten hat man das so komprimiert und in solcher Penetranz gesehen. Zugegeben, das hier muss man aushalten können. Die Schauspieler*innen werfen ihre Textfragmente ein, atemlos, mal dieser, mal jene von Kamera und Ton-Anglerin in den Mittelpunkt geholt, dabei ständig die Monitore und die Kulissen verschiebend. Doch was sie auch versuchen – das Elend der Bilder bleibt.
Noch ein Element, das schon für sich genommen ein großer Wurf wäre: die Kulisse. Eine die halbe Bühne ausfüllende Kirche, die sie in der Mitte teilen, sie öffnen (wobei eine Riesenzeichnung von Tilo Baumgärtel sichtbar wird, noch mehr Futter für die Augen), die sie zum Skelett zurückbauen und wieder zusammensetzen, der sie sich unterwerfen, die sie anbeten, gegen die sie sich auflehnen. Allein, die grausamen Bilder laufen weiter. Roman-Fragmente sind zu hören – es gibt kein Entkommen aus dem Kaleidoskop des Schreckens. Am Ende filmt die Kamera das Publikum: Diese schuldigen Menschen, sind das etwa – wir?
Das hätte es gewesen sein können mit diesem transzendenten Theaterabend, doch Sebastian Hartmann mag neuerdings offenbar auch gerne erklären. In diesem Fall lässt er erklären, und zwar mit Wolfram Lotz' keck-unterhaltsamem Theater-Manifest ‚Rede zum unmöglichen Theater‘: ‚Das Theater ist der Ort, wo Wirklichkeit und Fiktion aufeinandertreffen, und es ist also der Ort, wo beides seine Fassung verliert in einer heiligen Kollision‘, heißt es darin unter anderem. Und was für eine Kollision das hier war, Chapeau! Das hier ist ein – wenn auch finsteres – Fest für Augen und Ohren.“
Hartmanns Dresdner Inszenierung führt nicht ins Russland des 19. Jahrhunderts, sondern geradewegs in das Gehirn seines Protagonisten, zu Fragmenten seiner Gefühlswelt, Splittern seines Bewusstseins. Vor allem aber entwirft er in einem suggestiven Bilderrausch die kollektive Dimension von Raskolnikows krudem Überlegenheitsgefühl.
Aus dem Töten als individuellem Programm wird organisierter Massenmord, Krieg, politisches Verbrechen. In einem ritualhaften Bilderstrom mehrfach sich überlagernder Projektionen taucht die Inszenierung in die Schrecken des 20. Jahrhunderts.
Am Ende, wenn alle Bilder des Grauens an ihr Ende gekommen sind, steht Fanny Staffa allein auf der Vorderbühne und weist zweimal das ihr dargereichte Mikrofon ab. Zu sagen ist nun nichts mehr. Dann umarmt sie einen Lautsprecher, aus dem Kriegslärm ertönt, so als wär's ein Kind, das beruhigt werden muss. Ein radikal auf Rhythmus, Bild und Klang und wenig auf Narration setzendes Theater.
Subtil gebaut, berauschend ritualhaft.“
Nach einigen Minuten sinnlicher Entschlackungskur ist klar, Regisseur Sebastian Hartmann kreiert hier et was anderes als eine Nacherzählung. Hatte er in der vergangenen Spielzeit mit ERNIEDRIGTE UND BELEIDIGTE ein überregional gefeiertes Gesamtkunstwerk geliefert, so schreitet er diesmal weiter voran. Epische Breite und Figuren sind gestrichen. Übrig bleibt eine Melange aus Sound, Textfetzen und Bildgewalt. Und eine theatertheoretische Rede von Wolfram Lotz, die der These folgt, dass Fiktion die Realität ändern sollte. Alles hier ist in Bewegung. Alles arbeitet für die Aussage: Nicht Raskolnikow als Einzelner ist schuld. Uns alle betrifft die Schuld. In jedem schlummert der Größenwahn. Der Inszenierungsbeginn ist nur die Ruhe vor dem Sturm.
Über Mikrofone keucht, stammelt und agitiert das energetische Ensemble Raskolnikows abstruse Theorien. Es schuftet hart. Ein schwarzes Kirchenschiff wird hereingeschoben. Bald klappt es sich auf und offenbart apokalyptische Zeichnungen des Künstlers Tilo Baumgärtel. Natürlich ist auch dieses umherhuschende, sich windende und zappelnde Ensemble von Adriana Braga Peretzki fantastisch wave-gothicmäßig kostümiert. Alle sind sie Teil einer gespaltenen Persönlichkeit. Spontan und improvisiert wirkt dieser Prozess des nicht enden wollenden Albtraums, dem sich das Ensemble unterordnet. Dabei flüstert Moritz Kienemann eindrücklich seinen Raskolnikow-Part. Luise Aschenbrenner ist das vibrierendste Nervenbündel und Torsten Ranft singt ironisch gebrochen auch mal die Weihnachtsgeschichte.
Kurz vorm Schluss nimmt Fanny Staffa eine Lautsprecherbox, aus der nur Kriegsgeräusche dröhnen, in die Arme und versucht, sie zu beruhigen. Nadja Stübiger hilft ihr, indem sie auf die Box haut, sodass diese verstummt: Ein klares Schlusszeichen für einen künstlerisch anspruchsvollen Abend. Das ist kein mörderischer Verkaufsschlager, sondern durch und durch ein humanes Statement im Gewand progressiver Theaterkunst. Ein radikaler Glücksfall. Und bei aller Schwerverdaulichkeit absolut sehenswert!“
Ein anschwellender, hypnotischer Bilderstrom entsteht, genial untermalt von einem treibenden Drone-Soundtrack (Musik: Samuel Wiese). Textfragmente werden geflüstert, geschrien, gesungen.
Am Ende bauen sie die Bühne ab und Yassin Trabelsi trägt die ‚Rede zum unmöglichen Theater‘ des Dramatikers Wolfram Lotz vor. Deren Kernsatz trifft hier: ‚Das Theater ist der Ort, wo Wirklichkeit und Fiktion aufeinandertreffen, und es ist also der Ort, wo beides seine Fassung verliert in einer heiligen Kollision.‘ Genau.
Es gibt kein ‚na ja geht so‘, diese Inszenierung kann man nur hassen oder lieben. Man kann sie nervtötend finden und die Flucht ergreifen – oder sich ihr hingeben und das Geschehen immer geiler finden. Berauschend.“
Die Schauspieler irren hin und her, Menschen auf der Suche nach ihrem Platz in diesem Kaleidoskop des Schreckens. Dazu tragen sie einzelne Sätze, manchmal nur Worte aus dem Dostojewski-Roman vor. Darin geht es ja um Schuld, um Verbrechen, wie die verwendete Übersetzung sagt. Bei Dostojewski ist es ein Mensch, Raskolnikow, der sich schuldig macht, weil er glaubt, er dürfe einen anderen Menschen ‚wie eine Laus‘ töten. Der Kontext, den Hartmann setzt, sagt: Die Menschen sind schuldig. Wir Menschen. Das ist gar nicht so einfach auszuhalten – auch, weil es wie eine Endlosschleife abläuft.
Hartmann lässt von Dostojewski eine Art Kondensat übrig, und dieses ordnet er, wie alles andere auch, diesem Gesamtwerk aus Bildern und Tönen und Körpern unter. Es gibt auch keine aufgesetzten Regie-Eskapaden, auch keine Riesen-Einzelauftritte für die Schauspieler. Keine Lacher, keine Ironie. Alles läuft parallel und gleichberechtigt, und man hat auf dieser Bühne und in dieser sehr ernsthaften Gleichzeitigkeit aller Medien so viel zu entdecken, dass man ziemlich gut ausgelastet ist ohne die Romanhandlung.
Am Ende, im erklärenden Nachtrag, dem keck-unterhaltsamen Theater-Manifest REDE ZUM UNMÖGLICHEN THEATER des Dramatikers Wolfgang Lotz, heißt es dann: ‚Das Theater ist der Ort, wo Wirklichkeit und Fiktion aufeinandertreffen, und es ist also der Ort, wo beides seine Fassung verliert in einer heiligen Kollision.‘ Solch eine Kollision ist in Dresden zu erleben, und was für eine – Chapeau!“
Hartmann installiert mit grandioser Konsequenz ein Empfinden.“
Hartmann erzählt am Staatsschauspiel Dresden aber nicht Fjodor Dostojewskis Roman, er installiert mit grandioser Konsequenz ein Empfinden. Er choreografiert sein Erschrecken über das, was aus Raskolnikows Geschichte heraus- und herübergiftet. Dialoge? Sprengsel. Drama? Klagefetzen. Russland? Allegorie. Zeit, Ort? Übertragbarkeit.
Video-Wucht. Ist da noch Schauspielertheater möglich? Oder werden Darsteller als Zeichen benutzt? Sie werden nicht benutzt – sie sind Zeichen. Und wie jeder Chor Seele und Herz hat, so besitzt auch die Elementarteilchen-Ethik dieses Theaters eine Aura, die ganz aus dem neunköpfigen Ensemble kommt. Wie rigoros es Theater in eine ‚Kirche der Angst‘ (Schlingensief) und Text in eine Liturgie verwandelt. Partikel mit Aura. Elegisch undurchsichtig. Schrill. Lächelnd verneinunungsgierig.
Dostojewski als Spiegel, der Vergangenheit als zukunftsdrohend aufscheinen lässt, und diese Fenster in die Vergangenheit lassen sich nicht schließen. Sie sind das schwarze Loch, das bleibt, die Augen der Toten darin wie Fragenblitze.“