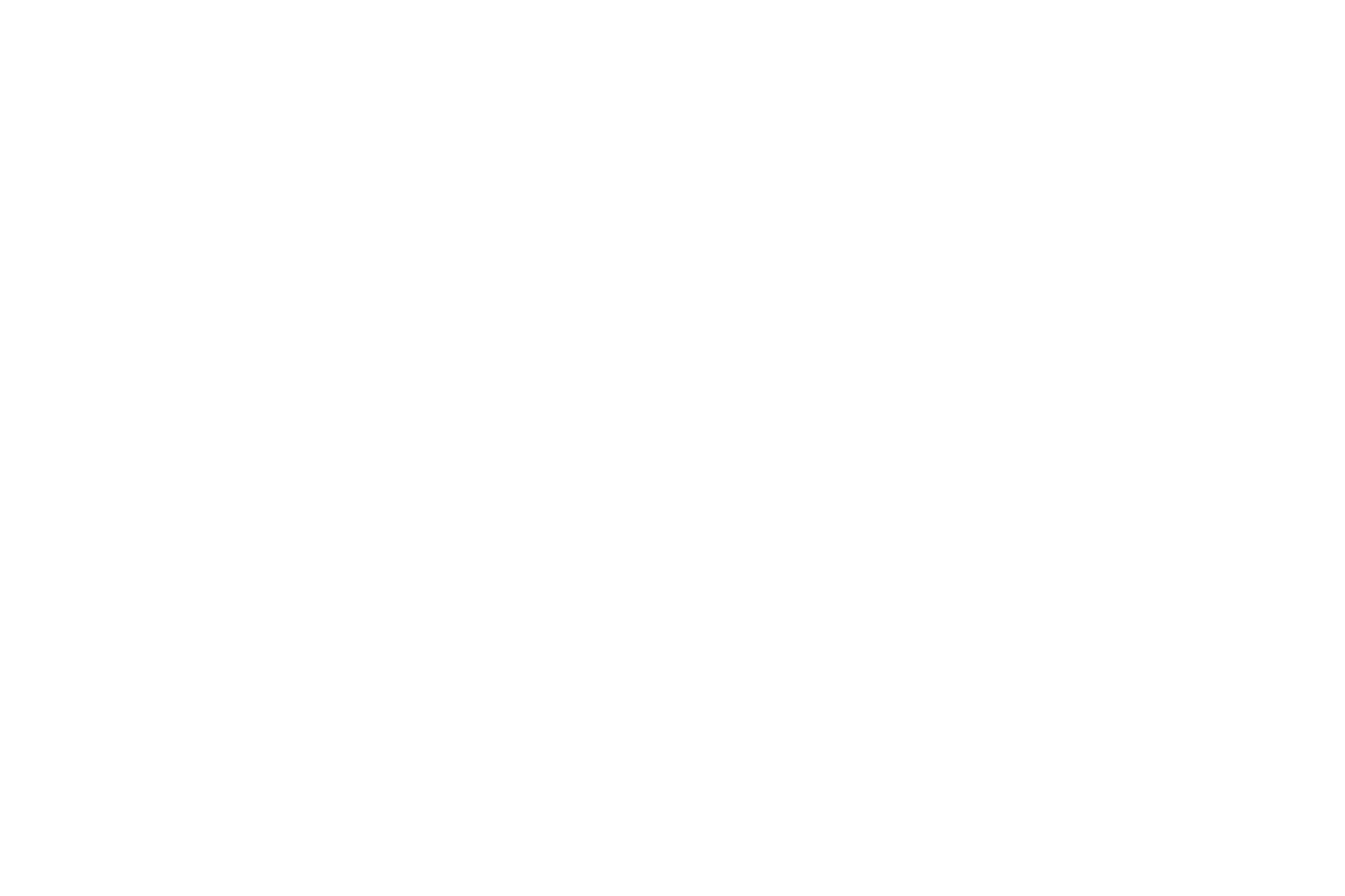Premiere 01.11.2014
› Kleines Haus 1
Miss Sara Sampson
Bürgerliches Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing
Handlung
Sara verlässt ihren Vater und brennt mit ihrem Geliebten Mellefont durch. Der versteckt sich mit ihr in einer Absteige, kann sich aber nicht entschließen, nun auch den nächsten Schritt zu tun und Sara zu heiraten. Die Wochen vergehen. Sara verzweifelt, Mellefont zaudert, bis er von der Marwood, seiner verlassenen Geliebten, aufgespürt wird. Es entspinnt sich eine Dreiecksgeschichte voller Leidenschaft, Hass und Begehren, an deren Ende mindestens ein liebeskrankes Herz zu schlagen aufhört.
Lessing begründete mit „Miss Sara Sampson“ die Gattung des Bürgerlichen Trauerspiels in der deutschen Dramenliteratur. Auslöser war eine Wette, der junge Dramatiker hatte 1755 behauptet: „Es ist keine Kunst, alte Weiber zum Heulen zu bringen.“ So schrieb der 26Jährige das Drama in sechs Wochen und gewann – bei der Uraufführung brach der gesamte Saal in Tränen aus. Und doch ist sein Trauerspiel mehr als ein kalkuliertes Rührstück: Lessings Personal lässt die beginnende Emanzipation von Religion und Politik spürbar werden. Individuelle Glücksansprüche befeuern ein neues bürgerliches Selbstbewusstsein, eine altruistische Grundhaltung wird zur entscheidenden Kraft, wenn es darum geht, eine Ehe oder einen Staat zu führen. Lessing schickt seine Figuren in einen Kampf um Vernunft und Leidenschaft, der manchmal komisch und dann wieder tieftragisch ist.
Sebastian Kreyer (*1979) arbeitete als Regieassistent am Schauspiel Köln u. a. mit den Regisseuren Karin Beier, Karin Henkel und Herbert Fritsch. Mit seiner Inszenierung von Williams’ „Die Glasmenagerie“ am Schauspiel Köln wurde er 2013 zum Festival „Radikal jung“ nach München eingeladen. Kreyer inszeniert zudem an Theatern in Bonn, Bremen, München und Hamburg. Lessings „Miss Sara Sampson“ ist seine erste Arbeit in Dresden.
Lessing begründete mit „Miss Sara Sampson“ die Gattung des Bürgerlichen Trauerspiels in der deutschen Dramenliteratur. Auslöser war eine Wette, der junge Dramatiker hatte 1755 behauptet: „Es ist keine Kunst, alte Weiber zum Heulen zu bringen.“ So schrieb der 26Jährige das Drama in sechs Wochen und gewann – bei der Uraufführung brach der gesamte Saal in Tränen aus. Und doch ist sein Trauerspiel mehr als ein kalkuliertes Rührstück: Lessings Personal lässt die beginnende Emanzipation von Religion und Politik spürbar werden. Individuelle Glücksansprüche befeuern ein neues bürgerliches Selbstbewusstsein, eine altruistische Grundhaltung wird zur entscheidenden Kraft, wenn es darum geht, eine Ehe oder einen Staat zu führen. Lessing schickt seine Figuren in einen Kampf um Vernunft und Leidenschaft, der manchmal komisch und dann wieder tieftragisch ist.
Sebastian Kreyer (*1979) arbeitete als Regieassistent am Schauspiel Köln u. a. mit den Regisseuren Karin Beier, Karin Henkel und Herbert Fritsch. Mit seiner Inszenierung von Williams’ „Die Glasmenagerie“ am Schauspiel Köln wurde er 2013 zum Festival „Radikal jung“ nach München eingeladen. Kreyer inszeniert zudem an Theatern in Bonn, Bremen, München und Hamburg. Lessings „Miss Sara Sampson“ ist seine erste Arbeit in Dresden.
Besetzung
Regie
Sebastian Kreyer
Bühne
Thomas Dreißigacker
Kostüme
Maria Roers
Dramaturgie
Beret Evensen
Licht
Björn Gerum
Sir William Sampson
Ben Daniel Jöhnk
Miss Sara, Sir William Sampsons Tochter
Ines Marie Westernströer
Mellefont
Christian Clauß
Marwood, Mellefonts ehemalige Geliebte
Cathleen Baumann
Arabella, ein Kind, Marwoods Tochter / Waitwell, Diener des Sampson
Matthias Buss
Video
Die Autorin Dagrun Hintze sieht fern und liest Lessing
Oberärztin Dr. April Kepner und Rettungssanitäter Matthew Taylor haben es geschafft: Sie stehen vor dem Traualtar. Doch bevor der Pfarrer überhaupt mit seiner Ansprache beginnen kann, springt in der Kirche einer auf – Dr. Jackson Avery, Oberarzt der Plastischen Chirurgie und Exfreund der Braut. Er bekennt seine Liebe zu April und bittet sie, Matthew nicht zu heiraten. Neben Jackson sitzt seine Freundin Stephanie, versteinert.
So geschehen in einer der jüngsten Folgen der US-amerikanischen Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“. Die vielleicht nicht zu den besten TV-Serien gehören mag, in einem jedoch unschlagbar ist: in der Konstruktion von Emotionen. Immer wieder gelingt es dem Autorenteam, die größtmögliche Fallhöhe herzustellen – und deshalb verdrücken Menschen, die ansonsten durchaus zurechnungsfähig sind, immer wieder ein paar Tränen vor dem Fernseher. April rennt mit ihrem Exfreund Jackson aus der Kirche, die beiden brausen mit dem Auto davon. Aber wohin?
Auch Miss Sara Sampson ist mit dem Mann, den sie liebt, durchgebrannt. Sie hat ihren Vater enttäuscht und in den Augen der Gesellschaft ihre Tugend verloren, nun sitzt sie seit acht Wochen in einem schäbigen Gasthaus und weint. Denn Mellefont zögert, sie zu heiraten, sosehr sie ihn auch drängt. Für Sara gibt es nur diese eine Möglichkeit, nur eine Trauung könnte die sittliche Ordnung wiederherstellen. Ohne Zeremonie bleibt sie eine Sünderin, die Gott strafen wird – auf das Durchbrennen, das man durchaus als emanzipatorischen Akt der Selbstverwirklichung begreifen kann, folgt die Selbstanklage.
Vordergründig beruht Mellefonts Zögern auf einer Erbschaftsangelegenheit, die noch geregelt werden muss, bevor er Sara heiraten kann. Doch als sich die Dinge zum Guten wenden – Saras Vater verzeiht seiner Tochter und akzeptiert Mellefont als Schwiegersohn –, offenbart sich seine innere Zerrissenheit. Er liebt Sara, das schon. Aber ihn schreckt der Verlust von Freiheit und Leidenschaft, der für ihn mit einer Ehe einhergeht, er wünscht sich Sara als Geliebte und nicht als Ehefrau – und weiß doch, dass er das diesem tugendhaften Geschöpf niemals wird zumuten können.
2014, eine Kneipe in Hamburg, ein Mann und eine Frau im Gespräch. Er: „Langjährige Beziehungen haben den Vorteil, dass alles geklärt ist – in welcher Kinoreihe man sitzt, was man kocht, um dem anderen eine Freude zu machen, wie man beim Frühstück die Zeitung aufteilt. Man hat zwar kaum noch Sex miteinander, weiß aber, wo gestreichelt werden muss und auch wie, wer auf welcher Seite des Betts schläft und dass Freundschaft ein wichtiger Bestandteil von dauernder Liebe ist. Das alles weiß ich sehr zu schätzen und möchte es wirklich nicht missen.“ Pause. „Aber wenn ich mir vorstelle, auch die nächsten 15 Jahre noch so zu verbringen, werde ich einfach verrückt.“
Da ist sie in heutiger Gestalt, die Ambivalenz, die auch Mellefont umtreibt: die Sehnsucht, bei einem Partner zu bleiben – und das Wissen darum, dass das Vergehen von Zeit und das Einhalten von Konventionen Spontaneität und Leidenschaft entgegenstehen. Und damit auch dem Gefühl persönlicher Freiheit und Selbstverwirklichung.
Die Einzige, die sich diesem Dilemma schmerzlich stellt, ist bei Lessing die Böse: Marwood, Exgeliebte von Mellefont und Mutter einer gemeinsamen Tochter. Sie kennt Eros’ auf- und abziehende Macht und weiß, mit wem sie es bei Mellefont zu tun hat, sie verlangte dem Geliebten nie eine Ehe ab und duldete seine Affären. Als sie nun begreift, dass sie ihn endgültig an Sara verloren hat, verfällt Marwood in Raserei, geht erst (erfolglos) mit einem Dolch auf Mellefont los und vergiftet schließlich ihre Rivalin.
So geschehen in einer der jüngsten Folgen der US-amerikanischen Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“. Die vielleicht nicht zu den besten TV-Serien gehören mag, in einem jedoch unschlagbar ist: in der Konstruktion von Emotionen. Immer wieder gelingt es dem Autorenteam, die größtmögliche Fallhöhe herzustellen – und deshalb verdrücken Menschen, die ansonsten durchaus zurechnungsfähig sind, immer wieder ein paar Tränen vor dem Fernseher. April rennt mit ihrem Exfreund Jackson aus der Kirche, die beiden brausen mit dem Auto davon. Aber wohin?
Auch Miss Sara Sampson ist mit dem Mann, den sie liebt, durchgebrannt. Sie hat ihren Vater enttäuscht und in den Augen der Gesellschaft ihre Tugend verloren, nun sitzt sie seit acht Wochen in einem schäbigen Gasthaus und weint. Denn Mellefont zögert, sie zu heiraten, sosehr sie ihn auch drängt. Für Sara gibt es nur diese eine Möglichkeit, nur eine Trauung könnte die sittliche Ordnung wiederherstellen. Ohne Zeremonie bleibt sie eine Sünderin, die Gott strafen wird – auf das Durchbrennen, das man durchaus als emanzipatorischen Akt der Selbstverwirklichung begreifen kann, folgt die Selbstanklage.
Vordergründig beruht Mellefonts Zögern auf einer Erbschaftsangelegenheit, die noch geregelt werden muss, bevor er Sara heiraten kann. Doch als sich die Dinge zum Guten wenden – Saras Vater verzeiht seiner Tochter und akzeptiert Mellefont als Schwiegersohn –, offenbart sich seine innere Zerrissenheit. Er liebt Sara, das schon. Aber ihn schreckt der Verlust von Freiheit und Leidenschaft, der für ihn mit einer Ehe einhergeht, er wünscht sich Sara als Geliebte und nicht als Ehefrau – und weiß doch, dass er das diesem tugendhaften Geschöpf niemals wird zumuten können.
2014, eine Kneipe in Hamburg, ein Mann und eine Frau im Gespräch. Er: „Langjährige Beziehungen haben den Vorteil, dass alles geklärt ist – in welcher Kinoreihe man sitzt, was man kocht, um dem anderen eine Freude zu machen, wie man beim Frühstück die Zeitung aufteilt. Man hat zwar kaum noch Sex miteinander, weiß aber, wo gestreichelt werden muss und auch wie, wer auf welcher Seite des Betts schläft und dass Freundschaft ein wichtiger Bestandteil von dauernder Liebe ist. Das alles weiß ich sehr zu schätzen und möchte es wirklich nicht missen.“ Pause. „Aber wenn ich mir vorstelle, auch die nächsten 15 Jahre noch so zu verbringen, werde ich einfach verrückt.“
Da ist sie in heutiger Gestalt, die Ambivalenz, die auch Mellefont umtreibt: die Sehnsucht, bei einem Partner zu bleiben – und das Wissen darum, dass das Vergehen von Zeit und das Einhalten von Konventionen Spontaneität und Leidenschaft entgegenstehen. Und damit auch dem Gefühl persönlicher Freiheit und Selbstverwirklichung.
Die Einzige, die sich diesem Dilemma schmerzlich stellt, ist bei Lessing die Böse: Marwood, Exgeliebte von Mellefont und Mutter einer gemeinsamen Tochter. Sie kennt Eros’ auf- und abziehende Macht und weiß, mit wem sie es bei Mellefont zu tun hat, sie verlangte dem Geliebten nie eine Ehe ab und duldete seine Affären. Als sie nun begreift, dass sie ihn endgültig an Sara verloren hat, verfällt Marwood in Raserei, geht erst (erfolglos) mit einem Dolch auf Mellefont los und vergiftet schließlich ihre Rivalin.
Böse ist das ohne Zweifel. Doch erinnert man sich selbst nur zu gut an Verletzungen in Liebesdingen, an zerschmissenes Geschirr, vom Balkon geworfene Klamotten und Schlimmeres, als dass man nicht dem Satz zustimmen würde, den Lessing in seinem späteren Stück „Emilia Galotti“ die Gräfin Orsina sagen lässt: „Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren.“ Voraussetzung für eine solche Empathie mit Marwood wäre, dass sie Mellefont tatsächlich liebt und nicht nur aus gekränktem Stolz durchdreht. Denn zumindest Frauen beherrschen sie doch, die eindeutige und nicht widersprüchliche Liebe. Oder?
Zurück in der Hamburger Kneipe. Jetzt erzählt die Frau: „Vor ein paar Tagen dachte ich plötzlich, mein Mann hätte eine Affäre. Er war so distanziert, ich hatte das Gefühl, ihm gar nichts mehr zu bedeuten, und dass er mich verlassen würde, stand für mich fest. Am nächsten Tag liebte auch ich ihn nicht mehr, es war klar, wir würden uns trennen. Als ich am dritten Tag aufwachte, war er auf einmal derjenige, mit dem ich unbedingt alt werden wollte.“ Pause. „Es ist doch zum Wahnsinnigwerden: immer derselbe Mann. Nur ich bin jeden Tag anders.“
So viel dazu.
Die Liebe, die nicht romantisch-abstrakte Idee bleibt, sondern real gelebt wird, scheint zu Verunsicherungen zu führen – sowohl was die eigene Identität als auch was Lebensentwürfe und -träume angeht. Aus dieser Verunsicherung entsteht Ambivalenz. Sie ist – symbolisch gesprochen – das Gift, das Saras Vorstellung von der Liebe tötet.
Vielleicht wäre Emilie du Châtelet nicht nur Sara, sondern auch Marwood eine gute Ratgeberin gewesen. Diese bemerkenswerte Dame, die sechs Jahre vor der Uraufführung von „Miss Sara Sampson“ starb, war nicht nur Mathematikerin, Physikerin, Philosophin und Übersetzerin, sie lebte auch zehn Jahre lang in wilder Ehe mit Voltaire. In ihrem wunderbaren Essay „Rede vom Glück“ heißt es: „Ich weiß indes nicht, ob die Liebe jemals zwei so sehr füreinander geschaffene Menschen vereint hat, dass sie der Lust nie überdrüssig wurden, nie die Erkaltung im Gefolge der Sicherheit, nie Gleichgültigkeit und Lauigkeit erfuhren, die so oft aus der Bequemlichkeit und Beständigkeit eines Verhältnisses entspringen […] Aber wie lächerlich wäre es, sich dieser Lust zu verweigern, aus Angst vor künftigem Unglück, das Sie vielleicht erst empfinden, nachdem Sie sehr glücklich gewesen sind – und selbst dann würden Sie entschädigt und müssen daran denken, sich zu heilen, nicht, zu bereuen.“
Auf den Rausch folgt die Ernüchterung. So war das im 18. Jahrhundert, so ist es bis heute. Diese Einsicht zu bejahen erfordert Mut. Volles Risiko gehen und nicht bereuen empfiehlt Madame du Châtelet. Die Autoren von „Grey’s Anatomy“ scheinen das ähnlich zu sehen: April und Jackson fahren nach ihrer Flucht aus der Kirche direkt nach Las Vegas – es gibt offenbar auch heute noch Situationen, die nur durch eine Blitzhochzeit bereinigt werden können. Und denjenigen, die nicht so mutig sind, bleiben immerhin ein paar Tränen vor dem Fernseher.
Dagrun Hintze studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft in Würzburg und Antwerpen. Seit 1999 lebt sie als Autorin in Hamburg. Dagrun Hintze widmet sich essayistisch und literarisch der Vermittlung zeitgenössischer Kunst. Sie veröffentlichte Lyrik und Kurzprosa in diversen Zeitschriften und Anthologien und wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Ihr Stück „Die Zärtlichkeit der Russen“ wurde 2012 am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt.
Zurück in der Hamburger Kneipe. Jetzt erzählt die Frau: „Vor ein paar Tagen dachte ich plötzlich, mein Mann hätte eine Affäre. Er war so distanziert, ich hatte das Gefühl, ihm gar nichts mehr zu bedeuten, und dass er mich verlassen würde, stand für mich fest. Am nächsten Tag liebte auch ich ihn nicht mehr, es war klar, wir würden uns trennen. Als ich am dritten Tag aufwachte, war er auf einmal derjenige, mit dem ich unbedingt alt werden wollte.“ Pause. „Es ist doch zum Wahnsinnigwerden: immer derselbe Mann. Nur ich bin jeden Tag anders.“
So viel dazu.
Die Liebe, die nicht romantisch-abstrakte Idee bleibt, sondern real gelebt wird, scheint zu Verunsicherungen zu führen – sowohl was die eigene Identität als auch was Lebensentwürfe und -träume angeht. Aus dieser Verunsicherung entsteht Ambivalenz. Sie ist – symbolisch gesprochen – das Gift, das Saras Vorstellung von der Liebe tötet.
Vielleicht wäre Emilie du Châtelet nicht nur Sara, sondern auch Marwood eine gute Ratgeberin gewesen. Diese bemerkenswerte Dame, die sechs Jahre vor der Uraufführung von „Miss Sara Sampson“ starb, war nicht nur Mathematikerin, Physikerin, Philosophin und Übersetzerin, sie lebte auch zehn Jahre lang in wilder Ehe mit Voltaire. In ihrem wunderbaren Essay „Rede vom Glück“ heißt es: „Ich weiß indes nicht, ob die Liebe jemals zwei so sehr füreinander geschaffene Menschen vereint hat, dass sie der Lust nie überdrüssig wurden, nie die Erkaltung im Gefolge der Sicherheit, nie Gleichgültigkeit und Lauigkeit erfuhren, die so oft aus der Bequemlichkeit und Beständigkeit eines Verhältnisses entspringen […] Aber wie lächerlich wäre es, sich dieser Lust zu verweigern, aus Angst vor künftigem Unglück, das Sie vielleicht erst empfinden, nachdem Sie sehr glücklich gewesen sind – und selbst dann würden Sie entschädigt und müssen daran denken, sich zu heilen, nicht, zu bereuen.“
Auf den Rausch folgt die Ernüchterung. So war das im 18. Jahrhundert, so ist es bis heute. Diese Einsicht zu bejahen erfordert Mut. Volles Risiko gehen und nicht bereuen empfiehlt Madame du Châtelet. Die Autoren von „Grey’s Anatomy“ scheinen das ähnlich zu sehen: April und Jackson fahren nach ihrer Flucht aus der Kirche direkt nach Las Vegas – es gibt offenbar auch heute noch Situationen, die nur durch eine Blitzhochzeit bereinigt werden können. Und denjenigen, die nicht so mutig sind, bleiben immerhin ein paar Tränen vor dem Fernseher.
Dagrun Hintze studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft in Würzburg und Antwerpen. Seit 1999 lebt sie als Autorin in Hamburg. Dagrun Hintze widmet sich essayistisch und literarisch der Vermittlung zeitgenössischer Kunst. Sie veröffentlichte Lyrik und Kurzprosa in diversen Zeitschriften und Anthologien und wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Ihr Stück „Die Zärtlichkeit der Russen“ wurde 2012 am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt.