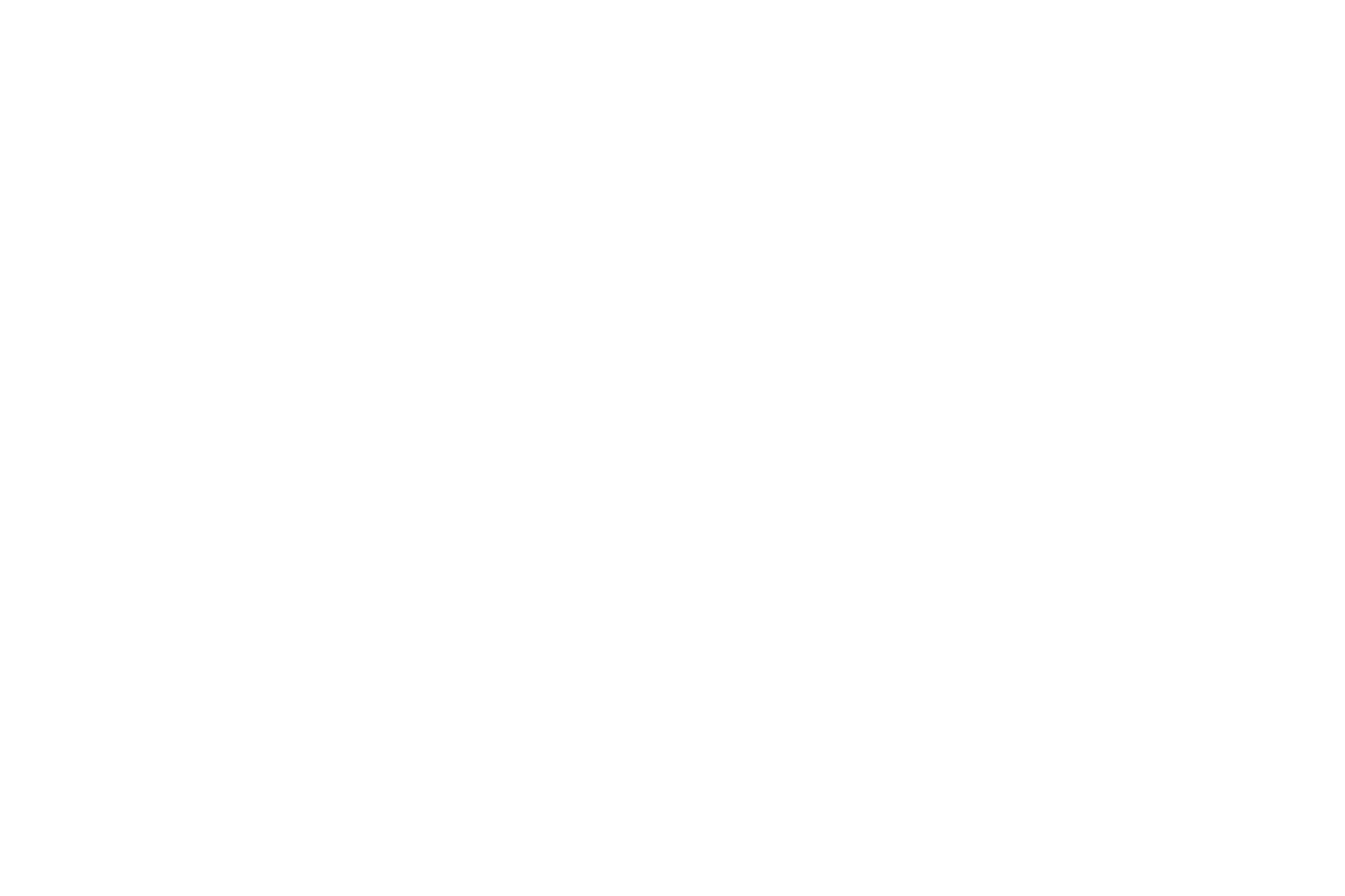Premiere 11.09.2015
› Schauspielhaus
Maß für Maß
von William Shakespeare
Deutsch von Thomas Brasch
Deutsch von Thomas Brasch
Handlung
Shakespeares „dunkle Komödie“ ist faszinierend und verwirrend. Sie ist voller widersprüchlicher und gegensätzlicher Ansichten – egal, ob moralische, juristische oder religiöse Themen verhandelt werden. Schon die Frage, um wen es in diesem Stück eigentlich geht, ist nicht leicht zu beantworten: Geht es um den Herzog Vincentio, der einfach keine Freude mehr an seinem Amt hat und es deshalb seinem Stellvertreter Angelo überträgt und sich anschließend aus dem Staub macht? Geht es folglich um Angelo, der, kaum im Amt, vorehelichen Sex wieder unter Haftstrafe stellt, was ihm später selbst zum Verhängnis wird? Oder geht es um Claudio, an dem die Strafe zuerst vollzogen werden soll? Steht vielleicht die Nonne Isabella, Claudios Schwester, im Mittelpunkt, die beim Statthalter um Begnadigung fleht und in ihrer strengen Gläubigkeit genauso halsstarrig ist wie Angelo in seiner rigiden Staatsführung? Oder sind die eigentlichen Hauptfiguren das Fußvolk, das Rotlichtmilieu, durch die Puffmutter Overdone und den Zuhälter Pompejus vertreten, die ihre Existenz bedroht sehen?
„Maß für Maß“, 1604 uraufgeführt, ist ein Stück voller Rätsel. Es beginnt als Tragödie und endet als Komödie mit einer großen Versöhnungsszene. Shakespeare entwirft eine Groteske, in der die politische Obrigkeit jeden Bezug zum Volk verloren hat. Mehr noch: Vor den erlassenen Gesetzen sind eben längst nicht alle gleich; zumindest dann nicht, wenn Politik, Geld und Sex erst mal unglückselige Verbindungen eingegangen sind. Am Ende gewinnt nicht, wer gut, aufrichtig oder gerecht ist, sondern wer clever genug ist, so zu erscheinen.
„Maß für Maß“, 1604 uraufgeführt, ist ein Stück voller Rätsel. Es beginnt als Tragödie und endet als Komödie mit einer großen Versöhnungsszene. Shakespeare entwirft eine Groteske, in der die politische Obrigkeit jeden Bezug zum Volk verloren hat. Mehr noch: Vor den erlassenen Gesetzen sind eben längst nicht alle gleich; zumindest dann nicht, wenn Politik, Geld und Sex erst mal unglückselige Verbindungen eingegangen sind. Am Ende gewinnt nicht, wer gut, aufrichtig oder gerecht ist, sondern wer clever genug ist, so zu erscheinen.
Besetzung
Regie
Bühne
Kostüme
Musik
Jörg-Martin Wagner
Licht
Michael Gööck
Dramaturgie
Vincentio, der Herzog
Angelo, der Stellvertreter
Escalus, ein Lord
Matthias Luckey
Claudio, ein Lord
Jonas Friedrich Leonhardi
Lucio, ein Unikum
Benjamin Pauquet
Kerkermeister
Christian Clauß
Pompejus, Angestellter von Madame Overdone / Klosterbruder
Isabella, Claudios Schwester
Ina Piontek
Mariana, Angelos Verlobte / Madame Overdone, eine Puffmutter
Antje Trautmann
Harmoniumspieler
Mojib Majidi
Video
Hans Vorländer über einige Grundkonstanten im Verhältnis zwischen Volk und Politikern
Es wäre ja schön: Das Volk äußert seinen Willen, die Politiker setzen ihn um. Und: Die Politiker erklären dem Volk, warum etwas so und nicht anders geschehen muss, und das Volk akzeptiert. Man hört aufeinander, man versteht sich. Das Regieren fällt leicht, die Bürger sind zufrieden. Jeder bekommt, was er will; von allem ist genug da. Friedlich wie eine Herde von Lämmern lassen sich die Bürger vom guten Hirten führen – oder sie führen selbst. Ein schönes Bild, vielleicht auch ein bisschen langweilig.
Ein anderes Bild: Das Volk ruft, die Politiker hören nicht. Die „hier unten“ stehen gegen die „da oben“. Wir sind das Volk, die Politiker sind Verräter. Wir sind gut, die anderen sind korrupt. Emotionen wallen auf, Wut und Frust marschieren, der Furor kennt kein Maß. Politiker schimpfen, Medien verstehen nicht. Ein hässliches Bild, bestimmt ein dramatisches.
Bilder einer Ordnung des Politischen – einer guten, einer schlechten? Hier das wohlgeordnete Gemeinwesen, wo Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und Eintracht herrschen, dort die aus den Fugen geratene Stadt, das Land, in dem Empörung, Misstrauen, Unfrieden und Zwietracht regieren. Kein Zweifel, das sind die Alternativen – und sie bestimmen die Politik.
Das Volk kommt immer zweimal vor: als Bürger, der aufopferungsvoll handelt, sich um die Belange des Gemeinwesens kümmert, Kompromisse mit seinen Mitbürgern schließt. Und als Pöbel, der sich seinen Stimmungen hingibt, seine eigenen Interessen verfolgt, sich von Demagogen verführen lässt. Ebenso die Herrschenden: Sie treten als mildtätige Landesherren auf, zeigen sich um Wohlfahrt und Sicherheit der ihnen anvertrauten Schutzbefohlenen besorgt – oder gerieren sich als Tyrannen, Despoten und Diktatoren, herrschen mit eiserner Hand und kalkulierten Wohltaten.
Die zyklische Wiederkehr von guten und schlechten Formen des Regierens hat in den zweieinhalbtausend Jahren, seitdem die Griechen die Politik „erfunden“ haben, die politischen, auch die philosophischen Gemüter bewegt. Aristoteles sah in Mitte und Maß, in der Selbstbeherrschung der Regierenden und der Regierten, das Mittel, eine gute Ordnung, auch und gerade die der Selbstregierung der Bürger, auf Dauer zu garantieren. Viele folgten ihm darin und stellten Ethiken und Tugendkataloge, für Bürger und Herrscher gleichermaßen, auf. Geduld, Uneigennützigkeit, Mut, Nachsicht, Beherrschtheit, Gerechtigkeitssinn und Urteilsvermögen – das waren die Leitideen. Da, wo das Gegenteil, das Laster, die Politik bestimmte, wo Ehrgeiz, Neid, Furcht und Machtstreben herrschten, lag das Gemeinwesen danieder. Die Bürger von Siena in der Toskana ließen zu Beginn des 14. Jahrhunderts das Schreckbild des schlechten, aber auch eine Allegorie des guten Regierens an die Wände eines Rathaussaales malen, damit jeder sehen konnte, wie schwierig, aber auch wie erstrebenswert es ist, eine Republik sich selbst regierender Bürger zu erhalten. Bis heute kann man sich der Wirkung des Freskos von Ambrogio Lorenzetti nicht entziehen.
Tugend – das richtete sich als Forderung immer an Herrscher und Bürger zugleich. Die Fürstenspiegel, die Berater für ihre Herren abfassten, waren Verhaltensbreviere für einen vorbildlichen Regenten. King James I. schrieb 1599 selber eine solche Handreichung für seine Söhne, und Shakespeare ließ sich vermutlich für „Measure for Measure“ davon inspirieren. Es ging um das richtige Maß von Gerechtigkeit und Gnade, Strenge und Nachsicht, das ein Herrscher gegenüber seinen Untertanen walten lassen sollte. Aber auch die Demokratie kann ohne die Tugend ihrer Bürger nicht bestehen.
Ein anderes Bild: Das Volk ruft, die Politiker hören nicht. Die „hier unten“ stehen gegen die „da oben“. Wir sind das Volk, die Politiker sind Verräter. Wir sind gut, die anderen sind korrupt. Emotionen wallen auf, Wut und Frust marschieren, der Furor kennt kein Maß. Politiker schimpfen, Medien verstehen nicht. Ein hässliches Bild, bestimmt ein dramatisches.
Bilder einer Ordnung des Politischen – einer guten, einer schlechten? Hier das wohlgeordnete Gemeinwesen, wo Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und Eintracht herrschen, dort die aus den Fugen geratene Stadt, das Land, in dem Empörung, Misstrauen, Unfrieden und Zwietracht regieren. Kein Zweifel, das sind die Alternativen – und sie bestimmen die Politik.
Das Volk kommt immer zweimal vor: als Bürger, der aufopferungsvoll handelt, sich um die Belange des Gemeinwesens kümmert, Kompromisse mit seinen Mitbürgern schließt. Und als Pöbel, der sich seinen Stimmungen hingibt, seine eigenen Interessen verfolgt, sich von Demagogen verführen lässt. Ebenso die Herrschenden: Sie treten als mildtätige Landesherren auf, zeigen sich um Wohlfahrt und Sicherheit der ihnen anvertrauten Schutzbefohlenen besorgt – oder gerieren sich als Tyrannen, Despoten und Diktatoren, herrschen mit eiserner Hand und kalkulierten Wohltaten.
Die zyklische Wiederkehr von guten und schlechten Formen des Regierens hat in den zweieinhalbtausend Jahren, seitdem die Griechen die Politik „erfunden“ haben, die politischen, auch die philosophischen Gemüter bewegt. Aristoteles sah in Mitte und Maß, in der Selbstbeherrschung der Regierenden und der Regierten, das Mittel, eine gute Ordnung, auch und gerade die der Selbstregierung der Bürger, auf Dauer zu garantieren. Viele folgten ihm darin und stellten Ethiken und Tugendkataloge, für Bürger und Herrscher gleichermaßen, auf. Geduld, Uneigennützigkeit, Mut, Nachsicht, Beherrschtheit, Gerechtigkeitssinn und Urteilsvermögen – das waren die Leitideen. Da, wo das Gegenteil, das Laster, die Politik bestimmte, wo Ehrgeiz, Neid, Furcht und Machtstreben herrschten, lag das Gemeinwesen danieder. Die Bürger von Siena in der Toskana ließen zu Beginn des 14. Jahrhunderts das Schreckbild des schlechten, aber auch eine Allegorie des guten Regierens an die Wände eines Rathaussaales malen, damit jeder sehen konnte, wie schwierig, aber auch wie erstrebenswert es ist, eine Republik sich selbst regierender Bürger zu erhalten. Bis heute kann man sich der Wirkung des Freskos von Ambrogio Lorenzetti nicht entziehen.
Tugend – das richtete sich als Forderung immer an Herrscher und Bürger zugleich. Die Fürstenspiegel, die Berater für ihre Herren abfassten, waren Verhaltensbreviere für einen vorbildlichen Regenten. King James I. schrieb 1599 selber eine solche Handreichung für seine Söhne, und Shakespeare ließ sich vermutlich für „Measure for Measure“ davon inspirieren. Es ging um das richtige Maß von Gerechtigkeit und Gnade, Strenge und Nachsicht, das ein Herrscher gegenüber seinen Untertanen walten lassen sollte. Aber auch die Demokratie kann ohne die Tugend ihrer Bürger nicht bestehen.
Das war in der Antike so, das gilt für die Gegenwart. Sie ist das Lebenselixier eines freiheitlichen Gemeinwesens. Tugend verweist auf einen bürgerschaftlichen Verpflichtungszusammenhang wechselseitiger Anerkennung und Loyalität, eine Voraussetzung, damit Bürger ihre eigenen Angelegenheiten regeln können. Das kann in politischer Bildung gelernt, in politischer Praxis eingeübt werden.
Doch Tugend ist ein flüchtiges Element; sie geht, wie sie gekommen ist. Auch davon und von der steten Gefährdung freiheitlicher Ordnungen berichtet die Geschichte des politischen Denkens. Ein unerbittlicher Realist – und Chronist des Verfalls der italienischen Stadtrepubliken – wie Niccolò Machiavelli beobachtete an der Wende zum 16. Jahrhundert, dass Menschen im Allgemeinen „undankbar, wankelmütig, unaufrichtig, heuchlerisch, furchtsam und habgierig sind“ und dass der „Pöbel“ sich „immer von dem Schein und dem Erfolg mitreißen“ lasse. Ähnlich hatte auch schon Platon in der Antike die Pathologien der athenischen Demokratie beschrieben. Beide zogen daraus die Konsequenz, dass es auch in der Politik der Führung bedarf, genauso wie es zum Steuern eines Schiffes auf die Fähigkeiten eines Kapitäns ankomme, so Platon. Machiavelli ging noch einen Schritt weiter und riet einem Fürsten, der die Staatsgeschäfte klug und effizient leiten wollte, sich neben der Waffe des Gesetzes der tierischen Kampfweisen von Löwen und Füchsen zu versichern: „Da also ein Fürst gezwungen ist, von der Natur der Tiere den rechten Gebrauch machen zu können, muss er sich unter ihnen den Fuchs und den Löwen auswählen; denn der Löwe ist wehrlos gegen Schlingen und der Fuchs gegen Wölfe. Man muss also ein Fuchs sein, um die Schlingen zu erkennen, und ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken.“
Wo keine Tugend der Bürger, da der Zynismus der Herrschenden? Noch einmal Machiavelli: „Ein Fürst muss gnädig, rechtschaffen, leutselig, aufrichtig und gottesfürchtig scheinen und es sein und gleichwohl so ganz Herr über sich sein, dass er im Notfall gerade das Gegenteil von allem tun kann.“ Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? Moderne Demokratien setzen auf das Engagement, die Beteiligung der Bürger, aber auch auf ihren Respekt, die Empathie, die Bereitschaft, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, sie ernst zu nehmen – kurzum auf Kooperation und Gemeinsinn. Und sie setzen auf die Fähigkeit der Amts- und Mandatsträger, verantwortungsvoll mit dem Wählerauftrag umzugehen. Die Ausübung der Herrschaft wird zeitlich begrenzt und rechtlich beschränkt, Verfassungen und Menschenrechte legen der Macht Zügel an. Das sind gute Voraussetzungen, aber keine Garantien für eine gelingende Demokratie.
Hans Vorländer hat seit 1993 den Lehrstuhl für Politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Dresden inne. In Dresden initiierte er um den Jahreswechsel 2014/2015 eine Eilstudie über die Teilnehmer der Pegida-Demonstrationen.
Doch Tugend ist ein flüchtiges Element; sie geht, wie sie gekommen ist. Auch davon und von der steten Gefährdung freiheitlicher Ordnungen berichtet die Geschichte des politischen Denkens. Ein unerbittlicher Realist – und Chronist des Verfalls der italienischen Stadtrepubliken – wie Niccolò Machiavelli beobachtete an der Wende zum 16. Jahrhundert, dass Menschen im Allgemeinen „undankbar, wankelmütig, unaufrichtig, heuchlerisch, furchtsam und habgierig sind“ und dass der „Pöbel“ sich „immer von dem Schein und dem Erfolg mitreißen“ lasse. Ähnlich hatte auch schon Platon in der Antike die Pathologien der athenischen Demokratie beschrieben. Beide zogen daraus die Konsequenz, dass es auch in der Politik der Führung bedarf, genauso wie es zum Steuern eines Schiffes auf die Fähigkeiten eines Kapitäns ankomme, so Platon. Machiavelli ging noch einen Schritt weiter und riet einem Fürsten, der die Staatsgeschäfte klug und effizient leiten wollte, sich neben der Waffe des Gesetzes der tierischen Kampfweisen von Löwen und Füchsen zu versichern: „Da also ein Fürst gezwungen ist, von der Natur der Tiere den rechten Gebrauch machen zu können, muss er sich unter ihnen den Fuchs und den Löwen auswählen; denn der Löwe ist wehrlos gegen Schlingen und der Fuchs gegen Wölfe. Man muss also ein Fuchs sein, um die Schlingen zu erkennen, und ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken.“
Wo keine Tugend der Bürger, da der Zynismus der Herrschenden? Noch einmal Machiavelli: „Ein Fürst muss gnädig, rechtschaffen, leutselig, aufrichtig und gottesfürchtig scheinen und es sein und gleichwohl so ganz Herr über sich sein, dass er im Notfall gerade das Gegenteil von allem tun kann.“ Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? Moderne Demokratien setzen auf das Engagement, die Beteiligung der Bürger, aber auch auf ihren Respekt, die Empathie, die Bereitschaft, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, sie ernst zu nehmen – kurzum auf Kooperation und Gemeinsinn. Und sie setzen auf die Fähigkeit der Amts- und Mandatsträger, verantwortungsvoll mit dem Wählerauftrag umzugehen. Die Ausübung der Herrschaft wird zeitlich begrenzt und rechtlich beschränkt, Verfassungen und Menschenrechte legen der Macht Zügel an. Das sind gute Voraussetzungen, aber keine Garantien für eine gelingende Demokratie.
Hans Vorländer hat seit 1993 den Lehrstuhl für Politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Dresden inne. In Dresden initiierte er um den Jahreswechsel 2014/2015 eine Eilstudie über die Teilnehmer der Pegida-Demonstrationen.