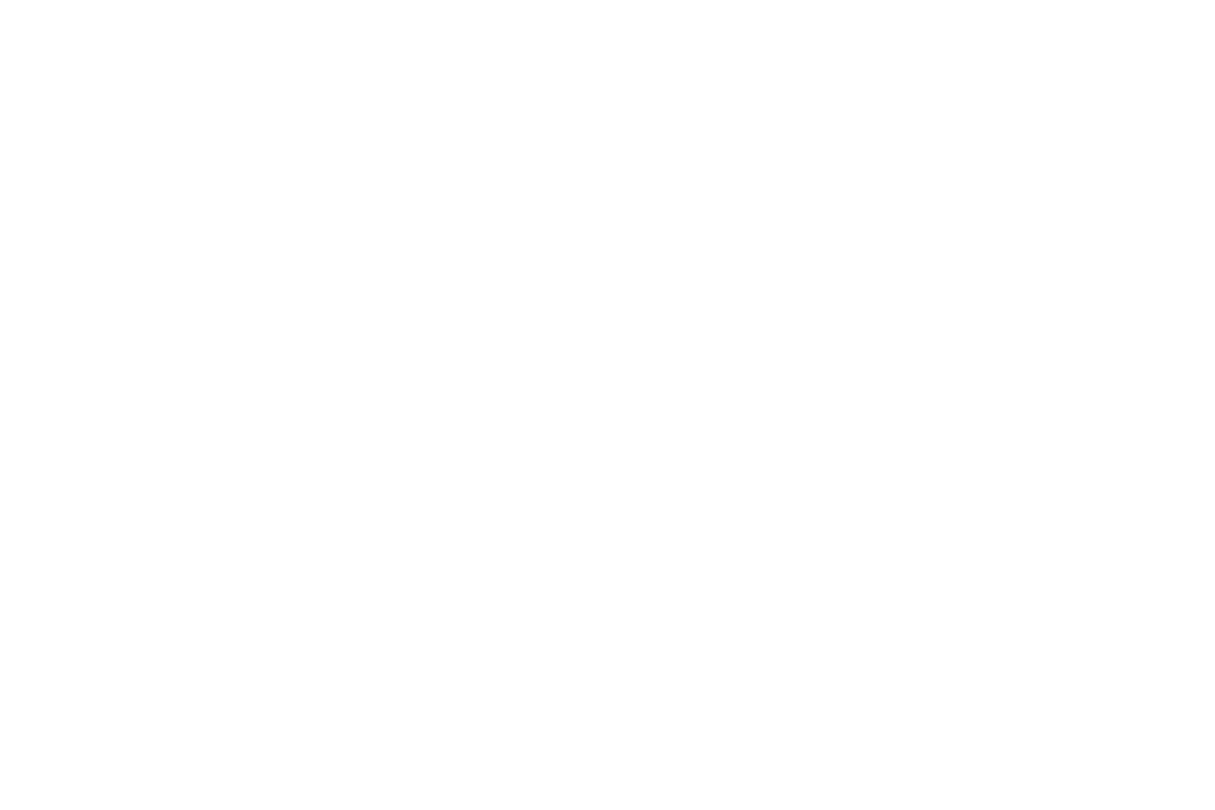Premiere 08.06.2012
› Kleines Haus 1
Liliom
eine Vorstadtlegende in sieben Bildern und einem szenischen Prolog von Franz Molnar
für die deutsche Bühne bearbeitet von Alfred Polgar
für die deutsche Bühne bearbeitet von Alfred Polgar
Handlung
Der Schausteller Liliom, Ausrufer bei den Karussells des Stadtwäldchens und der Polizei wohlbekannt, begegnet Julie. Sie bleiben zusammen – obwohl beide ihre Arbeit verlieren, obwohl die Karussellbesitzerin Frau Muskat Liliom gerne wieder zurücknähme, obwohl die Polizei Julie warnt, obwohl Liliom Julie prügelt und obwohl Julies beste Freundin Marie, selbst bald verheiratet, eine gute Partie für sie wüsste.
Als Julie schwanger wird, lässt Liliom sich, anstatt zu den Karussells zurückzukehren, auf einen Plan des Gauners Ficsur ein, der ihnen Geld verschaffen und ein neues Leben in Amerika ermöglichen soll. Der versuchte Raubmord scheitert, und Liliom tötet sich selbst. Über der Leiche Lilioms kommen alle noch einmal zusammen.
Nach seinem Tod gelangt Liliom im Jenseits in die Abteilung für Selbstmörder, um dort Reue zu zeigen und nach sechzehn Jahren Läuterung noch einmal zur Erde zurückzukehren. Er soll für sein inzwischen groß gewordenes Kind etwas Schönes tun.
Als Julie schwanger wird, lässt Liliom sich, anstatt zu den Karussells zurückzukehren, auf einen Plan des Gauners Ficsur ein, der ihnen Geld verschaffen und ein neues Leben in Amerika ermöglichen soll. Der versuchte Raubmord scheitert, und Liliom tötet sich selbst. Über der Leiche Lilioms kommen alle noch einmal zusammen.
Nach seinem Tod gelangt Liliom im Jenseits in die Abteilung für Selbstmörder, um dort Reue zu zeigen und nach sechzehn Jahren Läuterung noch einmal zur Erde zurückzukehren. Er soll für sein inzwischen groß gewordenes Kind etwas Schönes tun.
Besetzung
Regie
Julia Hölscher
Bühne
Esther Bialas
Kostüme
Ulli Smid
Musik
Tobias Vethake
Licht
Björn Gerum
Dramaturgie
Ole Georg Graf, Martin Hammer
Liliom
Julie
Cathleen Baumann
Frau Muskat
Cornelia Kempers
Marie
Annika Schilling
Wolf
Benjamin Pauquet
Ficsur
Benjamin Höppner
Luise
Juliette Favre
Luise alternierend
Lea Ruckpaul
Drechsler
Tobias Vethake
Die Zwei
Ahmad Mesgarha, Christian Clauß
Video
Liliom. Eine deutsche Frage
von Wolf Lotter
Armer kleiner Mann. Du hast so wenig, bist nur ein Ausrufer im Wurstelprater, stehst am Karussell und lockst zahlende Kundschaft an. Du dienst am Rummel und der alten Muskat im Bett. Dann kommt die Liebe, die alles anders macht, glaubst du, und Julie wird nun alles ändern. Aber nichts verändert sich von selbst, Liliom.
Denn es gibt keine richtige Liebe im falschen Leben.
Um das zu wissen, brauchte man 1909, als Ferenc Molnár seinen „Liliom“ in Budapest uraufführte, keinen Theodor Adorno. Liliom, dein Name ist Legion, denn viele seid ihr.
Ihr sagt, das Leben ist schuld, die Umstände, das System. Jeder würde sich an diesem Leben bedienen. Ausgenutzt, missbraucht, so lange klingt dieser Kammerton in deinem Kopf, bis die Entscheidung fällt, du deine Schlüsse ziehst. Wir sind ja nicht blöd. Die anderen machen das auch. Das nehme ich mit. Vergiss deine Skrupel.
Und du umgibst dich und lernst von jenen, die Unrechtes tun. Der kleine Mann sieht im Unanständigen den Ausweg. Du schlägst deine Frau, aber es tut dir leid. Du lässt dich mit dem Gangster Ficsur ein, der so ist, wie du gern wärst, skrupellos, aber es reicht nicht. Deine Skrupel sind übrigens keine Tugend. Molnár hat sie dir nur geliehen. Denn der Ficsur ist wie Mackie Messer: berechenbar, klar, entschieden. Das Böse hingegen ist nie entschieden. Das macht es aus. Der Liliom ist kein Held, kein Täter, aber am allerwenigsten ist er ein Opfer.
Was ist wichtiger? Der Stolz oder die Miete zahlen? Geht beides zusammen? Verantwortung und Vaterschaft oder doch lieber wieder das einzige Gefühl, auf das man sich verlassen kann, nämlich dass es allen anderen besser geht, ungerechterweise, und man selber eben gar nichts tun kann, weil man dort hingeworfen ist, wo Liliom immer wieder Platz nimmt.
Man plant, jemanden umzubringen, zu töten, wegen 16.000 Kronen, den Linzmann, den Kassierer, den geordneten Bürger, das Missing Link des eigenen Lebens. Ein Angehöriger des Mittelstandes. Doch man muss achtgeben. Diese Leute sind bewaffnet. Wutbürger. Sie haben gelernt, dass es Leute gibt wie Liliom, die ihr Leben ständig anderen als Rechnung vorlegen. Sie sind bewaffnet, weil ihnen gar nichts anderes mehr übrigbleibt. Man kann sich auf das Verständnis all jener verlassen, die meinen, dass die kleinen Leute immer Recht haben. Meistens sind das große Leute, die keine kleinen Leute kennen.
Liliom spielt, verspielt seinen Anteil nicht nur am Verbrechen, sondern auch am Leben. Am Ende kann er wenigstens noch seine Julie sehen. Es hilft nichts.
Und dann? Man tötet sich.
Im wirklichen Leben ist das ein Dilemma, bei Molnár geschieht ein Wunder, das muss es auch. Ist es nicht unerträglich, dass einer wie wir, einer, der sich nicht entscheiden kann, der nicht für sich selbst handeln mag, der nicht selbstständig ist und selbstbewusst, sondern von Zweifeln zerfressen, sich am Ende das Leben nimmt? Das war schon 1909 so. Heute nicht anders. So viele versuchen, ein richtiges Leben im falschen zu führen, dass es Wunder braucht, Happy Ends. Auch weil das die einfachste Lösung ist.
Bei Molnár ist das anders, zuletzt. Statt eines Happy Ends gibt es die Wiedervorlage der Chancengleichheit. Mach was draus. Hat Liliom etwas gelernt aus dem, was geschah?
Im Himmel gibt es auch dafür ein Amt, für Selbstmörder. Der Himmel des kleinen Mannes mit dem traurigen Ende ist ein deutsches Sozialgericht mit offenen Türen, verständigen Richtern, ohne politische Korrektheit und mit verstehbaren Gesetzen. Der Gerichtssaal hat Hintertüren, Ausgänge, er lässt ein, zwei, drei Chancen zu. Ein Chancenkarussell. Fördern und fordern.
Liliom muss ein wenig warten, aber dann darf er auf die Erde zurück. Zu seinem Kind, das Julie ihm gebar. Er will gut sein, nimmt einen Stern mit für seine Tochter. Er will reden. Wie es war. Damit das Kind versteht, was sein Vater war. Er will Abrechnung halten mit sich selbst. Jetzt die Wahrheit sagen. Aber wer will das hören? Seine Tochter nicht. Er schlägt auch sie. Aber sie spürt es nicht.
Denn es gibt keine richtige Liebe im falschen Leben.
Um das zu wissen, brauchte man 1909, als Ferenc Molnár seinen „Liliom“ in Budapest uraufführte, keinen Theodor Adorno. Liliom, dein Name ist Legion, denn viele seid ihr.
Ihr sagt, das Leben ist schuld, die Umstände, das System. Jeder würde sich an diesem Leben bedienen. Ausgenutzt, missbraucht, so lange klingt dieser Kammerton in deinem Kopf, bis die Entscheidung fällt, du deine Schlüsse ziehst. Wir sind ja nicht blöd. Die anderen machen das auch. Das nehme ich mit. Vergiss deine Skrupel.
Und du umgibst dich und lernst von jenen, die Unrechtes tun. Der kleine Mann sieht im Unanständigen den Ausweg. Du schlägst deine Frau, aber es tut dir leid. Du lässt dich mit dem Gangster Ficsur ein, der so ist, wie du gern wärst, skrupellos, aber es reicht nicht. Deine Skrupel sind übrigens keine Tugend. Molnár hat sie dir nur geliehen. Denn der Ficsur ist wie Mackie Messer: berechenbar, klar, entschieden. Das Böse hingegen ist nie entschieden. Das macht es aus. Der Liliom ist kein Held, kein Täter, aber am allerwenigsten ist er ein Opfer.
Was ist wichtiger? Der Stolz oder die Miete zahlen? Geht beides zusammen? Verantwortung und Vaterschaft oder doch lieber wieder das einzige Gefühl, auf das man sich verlassen kann, nämlich dass es allen anderen besser geht, ungerechterweise, und man selber eben gar nichts tun kann, weil man dort hingeworfen ist, wo Liliom immer wieder Platz nimmt.
Man plant, jemanden umzubringen, zu töten, wegen 16.000 Kronen, den Linzmann, den Kassierer, den geordneten Bürger, das Missing Link des eigenen Lebens. Ein Angehöriger des Mittelstandes. Doch man muss achtgeben. Diese Leute sind bewaffnet. Wutbürger. Sie haben gelernt, dass es Leute gibt wie Liliom, die ihr Leben ständig anderen als Rechnung vorlegen. Sie sind bewaffnet, weil ihnen gar nichts anderes mehr übrigbleibt. Man kann sich auf das Verständnis all jener verlassen, die meinen, dass die kleinen Leute immer Recht haben. Meistens sind das große Leute, die keine kleinen Leute kennen.
Liliom spielt, verspielt seinen Anteil nicht nur am Verbrechen, sondern auch am Leben. Am Ende kann er wenigstens noch seine Julie sehen. Es hilft nichts.
Und dann? Man tötet sich.
Im wirklichen Leben ist das ein Dilemma, bei Molnár geschieht ein Wunder, das muss es auch. Ist es nicht unerträglich, dass einer wie wir, einer, der sich nicht entscheiden kann, der nicht für sich selbst handeln mag, der nicht selbstständig ist und selbstbewusst, sondern von Zweifeln zerfressen, sich am Ende das Leben nimmt? Das war schon 1909 so. Heute nicht anders. So viele versuchen, ein richtiges Leben im falschen zu führen, dass es Wunder braucht, Happy Ends. Auch weil das die einfachste Lösung ist.
Bei Molnár ist das anders, zuletzt. Statt eines Happy Ends gibt es die Wiedervorlage der Chancengleichheit. Mach was draus. Hat Liliom etwas gelernt aus dem, was geschah?
Im Himmel gibt es auch dafür ein Amt, für Selbstmörder. Der Himmel des kleinen Mannes mit dem traurigen Ende ist ein deutsches Sozialgericht mit offenen Türen, verständigen Richtern, ohne politische Korrektheit und mit verstehbaren Gesetzen. Der Gerichtssaal hat Hintertüren, Ausgänge, er lässt ein, zwei, drei Chancen zu. Ein Chancenkarussell. Fördern und fordern.
Liliom muss ein wenig warten, aber dann darf er auf die Erde zurück. Zu seinem Kind, das Julie ihm gebar. Er will gut sein, nimmt einen Stern mit für seine Tochter. Er will reden. Wie es war. Damit das Kind versteht, was sein Vater war. Er will Abrechnung halten mit sich selbst. Jetzt die Wahrheit sagen. Aber wer will das hören? Seine Tochter nicht. Er schlägt auch sie. Aber sie spürt es nicht.
Es tut gar nicht weh. Das kann auch heißen: Die Illusionen, die er genährt hat, die Lügen, werden wahr. Ab hier ist seine letzte Chance vertan. Er hat nicht mal mehr das Recht auf Wahrheit.
Molnár und sein deutscher Übersetzer, der Wiener Großschreiber Alfred Polgar, der den „Liliom“ 1913 in Wien präsentierte und das Stück damit zum Welterfolg machte, waren das, was Condoleezza Rice mal „romantisch, ohne sentimental zu sein“ nannte. Der „Liliom“ ist so oft verkitscht und als Inbegriff der Chancenlosigkeit des kleinen Mannes missverstanden worden, weil das Publikum es so wollte. Der Theatergänger war schon vor einem Jahrhundert sentimental, und der Stoff empfahl sich als ideale Therapiesitzung gegen im Leben nicht lösbare Klassengegensätze. Besonders von Polgar wissen wir, dass er nicht an den Mythos des armen kleinen Mannes glaubte. Er war nicht besoffen von der Ungerechtigkeitsreligion, die damals schon weitverbreitet war – wenngleich nicht so stabil wie heute.
Er kannte den kleinen Mann, seine Zwiespältigkeit. Der kleine Mann war damals, was er bis heute geblieben ist: Er will mehr, als er hat, und dabei bleiben, wie er ist. Auf diese Wirklichkeit schauen wir nicht, auch wenn wir den Liliom sehen. Zwischen der Wahrheit, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der sein Leben nicht in die Hand nimmt und stets andere dafür verantwortlich macht, steht die deutsche Moral. Nun ist die Moral ein Stoff, der zu Illusionen führt. Moral ist Ethik mit hohem Lösungsmittelanteil. Unter dem Einfluss dieser Droge verwechselt man das Gerechte mit der Forderung.
Gerechtigkeit fordern? Von wem denn?
Der Kammerton unserer Gesellschaft ist kein anderer als jener der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg: Der kleine Mann fühlt sich betrogen. Er verwechselt unentwegt Ursache und Wirkung, so wie er bis heute Werkzeug und Ideologie verwechselt. Den Reichen, den Kapitalisten, und ihren Zuträgern, den Linzmanns, ihnen will er es zeigen, all jenen, die ihm vorführen, was er versäumt: sich zu entscheiden. Nicht nur für ein Kind, für Julie, sondern einmal auch gegen etwas: Die Kraft, die den Liliom zusammenhält, ist seine Gekränktheit. Er ist ein kleiner Mann. Aber der kleine Mann ist nicht von selbst, an sich also, gut. Er schlägt zu, wenn man ihm nicht zustimmt, er wird selbst dort, wo er wohlständig geworden ist, zum Wutbürger, der nach wie vor nichts anderes vermag als zu fordern, von denen da oben. Selbermachen ist ihm fremd. Er ist kein Citoyen. Er ist ein zu Wohlstand gekommener Untertan. Er sagt: Ich bin doch nicht blöd. Und wird so vollends zum Dummen.
Das ist heute eine klassenlose Angelegenheit. Liliom wäre heute Angehöriger nicht mehr des Prekariats, sondern des sich auflösenden Mittelstands. Ein Angestellter. Mit Hartz-IV-Abstiegsängsten. Ängstlich. Hilflos. Zur Unselbstständigkeit erzogen. Da bleibt nur falscher Stolz. Wut. Furor. Ein deutsches Fragezeichen mitten in der globalen Veränderung.
Die Zivilgesellschaft braucht andere Bürger. Keine Wutbürger, die die Macht doch gerne abgeben, weil fordern einfacher ist als machen. Es sind nicht die Umstände. Nicht das System. Die Zivilgesellschaft braucht Menschen, die selber machen, nicht mitmachen. Die Initiative ergreifen – und nicht falschen Propheten und ihren Versprechen folgen.
Was können wir vom „Liliom“ noch lernen? Dass zweite Chancen nichts wert sind, wenn man sich nicht verändert. Stolz und Kränkung sind schlechte Ratgeber der Veränderung. Sie mögen menschlich sein. Vor allem aber tragen sie dazu bei, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist weder gut noch gut genug.
Wolf Lotter ist Autor und Journalist. Er schreibt als Leitartikler für das Wirtschaftsmagazin brand eins und zahlreiche andere Medien. Dieser Text ist ein Originalbeitrag für das Spielzeitheft 2011.2012.
Molnár und sein deutscher Übersetzer, der Wiener Großschreiber Alfred Polgar, der den „Liliom“ 1913 in Wien präsentierte und das Stück damit zum Welterfolg machte, waren das, was Condoleezza Rice mal „romantisch, ohne sentimental zu sein“ nannte. Der „Liliom“ ist so oft verkitscht und als Inbegriff der Chancenlosigkeit des kleinen Mannes missverstanden worden, weil das Publikum es so wollte. Der Theatergänger war schon vor einem Jahrhundert sentimental, und der Stoff empfahl sich als ideale Therapiesitzung gegen im Leben nicht lösbare Klassengegensätze. Besonders von Polgar wissen wir, dass er nicht an den Mythos des armen kleinen Mannes glaubte. Er war nicht besoffen von der Ungerechtigkeitsreligion, die damals schon weitverbreitet war – wenngleich nicht so stabil wie heute.
Er kannte den kleinen Mann, seine Zwiespältigkeit. Der kleine Mann war damals, was er bis heute geblieben ist: Er will mehr, als er hat, und dabei bleiben, wie er ist. Auf diese Wirklichkeit schauen wir nicht, auch wenn wir den Liliom sehen. Zwischen der Wahrheit, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der sein Leben nicht in die Hand nimmt und stets andere dafür verantwortlich macht, steht die deutsche Moral. Nun ist die Moral ein Stoff, der zu Illusionen führt. Moral ist Ethik mit hohem Lösungsmittelanteil. Unter dem Einfluss dieser Droge verwechselt man das Gerechte mit der Forderung.
Gerechtigkeit fordern? Von wem denn?
Der Kammerton unserer Gesellschaft ist kein anderer als jener der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg: Der kleine Mann fühlt sich betrogen. Er verwechselt unentwegt Ursache und Wirkung, so wie er bis heute Werkzeug und Ideologie verwechselt. Den Reichen, den Kapitalisten, und ihren Zuträgern, den Linzmanns, ihnen will er es zeigen, all jenen, die ihm vorführen, was er versäumt: sich zu entscheiden. Nicht nur für ein Kind, für Julie, sondern einmal auch gegen etwas: Die Kraft, die den Liliom zusammenhält, ist seine Gekränktheit. Er ist ein kleiner Mann. Aber der kleine Mann ist nicht von selbst, an sich also, gut. Er schlägt zu, wenn man ihm nicht zustimmt, er wird selbst dort, wo er wohlständig geworden ist, zum Wutbürger, der nach wie vor nichts anderes vermag als zu fordern, von denen da oben. Selbermachen ist ihm fremd. Er ist kein Citoyen. Er ist ein zu Wohlstand gekommener Untertan. Er sagt: Ich bin doch nicht blöd. Und wird so vollends zum Dummen.
Das ist heute eine klassenlose Angelegenheit. Liliom wäre heute Angehöriger nicht mehr des Prekariats, sondern des sich auflösenden Mittelstands. Ein Angestellter. Mit Hartz-IV-Abstiegsängsten. Ängstlich. Hilflos. Zur Unselbstständigkeit erzogen. Da bleibt nur falscher Stolz. Wut. Furor. Ein deutsches Fragezeichen mitten in der globalen Veränderung.
Die Zivilgesellschaft braucht andere Bürger. Keine Wutbürger, die die Macht doch gerne abgeben, weil fordern einfacher ist als machen. Es sind nicht die Umstände. Nicht das System. Die Zivilgesellschaft braucht Menschen, die selber machen, nicht mitmachen. Die Initiative ergreifen – und nicht falschen Propheten und ihren Versprechen folgen.
Was können wir vom „Liliom“ noch lernen? Dass zweite Chancen nichts wert sind, wenn man sich nicht verändert. Stolz und Kränkung sind schlechte Ratgeber der Veränderung. Sie mögen menschlich sein. Vor allem aber tragen sie dazu bei, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist weder gut noch gut genug.
Wolf Lotter ist Autor und Journalist. Er schreibt als Leitartikler für das Wirtschaftsmagazin brand eins und zahlreiche andere Medien. Dieser Text ist ein Originalbeitrag für das Spielzeitheft 2011.2012.