Premiere 28.11.2015
› Schauspielhaus
Graf Öderland / Wir sind das Volk
von Max Frisch / mit Texten von Dresdnerinnen und Dresdnern
Textfassung von Volker Lösch, Robert Koall und Stefan Schnabel
Textfassung von Volker Lösch, Robert Koall und Stefan Schnabel
Handlung
Die Inszenierungen von Volker Lösch orientieren sich oft an den großen Themen der Städte, in denen sie gezeigt werden – sie politisieren, sie polemisieren, sie fordern heraus zur Auseinandersetzung. Am Staatsschauspiel waren dies z. B. seine „Dresdner Weber“ nach Gerhart Hauptmann oder „Die Wunde Dresden“. Der „Bürgerchor“ wurde ebenfalls hier als stilbildendes Element von Volker Löschs Arbeit erfunden.
„Herrlich sind wir und frei!“, sagt mit der Axt in der Hand Graf Öderland. Der gar kein Graf ist. Max Frisch erzählt in seinem Drama die Geschichte des Staatsanwalts Martin, der sich unfähig sieht, einen Mörder anzuklagen. Denn der Mord an einem Hauswart geschah ohne Motiv, er wurde einzig aus dem Grund begangen, der dem Staatsanwalt nur zu gut einleuchtet: Weltekel. Der Staatsanwalt teilt dieses Gefühl mit dem Mörder: „In dieser Welt der Papiere, in diesem Dschungel von Grenzen und Gesetzen, in diesem Irrenhaus der Ordnung. Ich kenne eure Ordnung. Ich bin in Öderland geboren. Wo der Mensch nicht hingehört, wo er nie gedeiht. Wo man die Schöpfung bekämpfen muss, damit man nicht erfriert oder verhungert.“ Und so lässt er sein bürgerliches Leben hinter sich, zieht in die Wälder, wird mehr aus Versehen Anführer einer Rebellion und sieht sich schließlich vor die Frage gestellt, ob er den letzten Schritt gehen und die Macht im Land ergreifen soll.
In GRAF ÖDERLAND, das für Max Frisch selbst eine zentrale Rolle in seinem Werk einnahm, bringt er einen Kessel zum Überkochen, in dem ein Gebräu aus diffuser Angst, unklarer Sehnsucht und Ignoranz brodelt – er lässt eine ganze Gesellschaft das Gleichgewicht verlieren. Volker Lösch wird Max Frischs Drama mit Texten anreichern, die er Dresdner Bürgern ablauscht, und dadurch die Ängste dieser Stadt hörbar machen.
„Herrlich sind wir und frei!“, sagt mit der Axt in der Hand Graf Öderland. Der gar kein Graf ist. Max Frisch erzählt in seinem Drama die Geschichte des Staatsanwalts Martin, der sich unfähig sieht, einen Mörder anzuklagen. Denn der Mord an einem Hauswart geschah ohne Motiv, er wurde einzig aus dem Grund begangen, der dem Staatsanwalt nur zu gut einleuchtet: Weltekel. Der Staatsanwalt teilt dieses Gefühl mit dem Mörder: „In dieser Welt der Papiere, in diesem Dschungel von Grenzen und Gesetzen, in diesem Irrenhaus der Ordnung. Ich kenne eure Ordnung. Ich bin in Öderland geboren. Wo der Mensch nicht hingehört, wo er nie gedeiht. Wo man die Schöpfung bekämpfen muss, damit man nicht erfriert oder verhungert.“ Und so lässt er sein bürgerliches Leben hinter sich, zieht in die Wälder, wird mehr aus Versehen Anführer einer Rebellion und sieht sich schließlich vor die Frage gestellt, ob er den letzten Schritt gehen und die Macht im Land ergreifen soll.
In GRAF ÖDERLAND, das für Max Frisch selbst eine zentrale Rolle in seinem Werk einnahm, bringt er einen Kessel zum Überkochen, in dem ein Gebräu aus diffuser Angst, unklarer Sehnsucht und Ignoranz brodelt – er lässt eine ganze Gesellschaft das Gleichgewicht verlieren. Volker Lösch wird Max Frischs Drama mit Texten anreichern, die er Dresdner Bürgern ablauscht, und dadurch die Ängste dieser Stadt hörbar machen.
Besetzung
Regie
Bühne
Kostüme
Chorleitung
Bernd Freytag
Licht
Michael Gööck, Andreas Barkleit
Video
Dramaturgie
Robert Koall, Stefan Schnabel
Der Staatsanwalt
Ben Daniel Jöhnk
Elsa
Antje Trautmann
Doktor Hahn
Benjamin Pauquet
Hilde / Inge / Coco
Lea Ruckpaul
Der Mörder
Thomas Braungardt
Mario, ein Hellseher
Die Mutter / Die Kommissarin
Annedore Bauer
Der Vater / Der Innenminister / Der Staatspräsident
Concierge / Studentin
Alexandra Weis
Gendarm / Sträfling
Dresdner Bürgerchor
Hartmut Arnstadt, Grit Buchmann, Gunther Ermlich, Friederike Feldmann, Berndt Fröbel, Katrin Hanschmann, Franziska Hauer, Christine Hrzan, Mario Jäkel, Katrin Kaden, Stephanie Kölling, Luise Körber, Gisela Liscovius, Bertolt List, Hans-Joachim Neubert, Bernd Oppermann, Ivaylo Petrov, Andreas Richter, Annabell Schmieder, Ingrid Schulz, Mario Spanninger, Jana Sperling, Hans Strehlow, Günter Tannert, Claudia Weltz, Manja Wildenhain, Sandro Zimmermann
und
Joussef Safok
Video
Wir sind das Volk!
In Max Frischs „Graf Öderland“ wird ein Brodeln und Gären in der Gesellschaft zur Rebellion. Aber es ist ein Aufstand der Bürger „ohne Programm, ohne Vokabeln des Heils“. Es ist der Aufstand als Ventil für eine diffuse Angst, für Verunsicherung und Überforderung. Diese Stimmung hat auch den Dresdner Winter 2014/2015 geprägt. Wir baten den Journalisten Cornelius Pollmer, dieser Atmosphäre nachzuspüren.
Gibt es in Dresden einen Widerspruchsgeist? Aus der jüngeren Vergangenheit sind mir diesbezüglich zwei kleine Begebenheiten besonders in Erinnerung: Jahre ist es her, dass der Lampionumzug einer Kindertagesstätte nicht genehmigt worden war. Die Kita reagierte souverän und meldete stattdessen eine Demonstration an, um auf diese Weise und natürlich mit Lampions gegen die Nichtgenehmigung des Umzugs zu protestieren. Wie schön das klang, als jeder sang.
Erinnerung zwei geht zurück auf den Februar dieses Jahres. Wie an praktisch jedem Montag der Gegenwart hatte das Zentralkomitee der Pegida eine Demonstration angemeldet, also kamen die Leute, und sie kamen mit Laserpointern, leuchtenden Displays und diesen klobigen Handscheinwerfern aus dem Baumarkt. Ein derart bewaffneter älterer Mann stand an besagtem Montag mit seinem Sohn vor mir in der Menge. Bis zum Vortrag von Lutz Bachmann blieb noch etwas Zeit, also knipste der Vater den Scheinwerfer an und bestrahlte die Frauenkirche in wildkurvigen Bahnen. In seinen Augen glitzerte der bescheidene Stolz, sich an der großen Frauenkirche einmal sichtbar zu machen, den trägen Stein zu ärgern und dabei so etwas wie Macht zu spüren, und sei es auch eine denkbar sinnlose. All das meinte er gewiss, als er schließlich zu seinem Sohn sagte: „Geil, oder?“ Rabimmel, Rabammel, Raboom!
Der Widerspruchsgeist dieser Stadt liegt im arithmetischen Mittel vermutlich irgendwo zwischen diesen beiden Anekdoten. Denn, so banal das ist: Das Dresden gibt es genauso wenig wie die Dresdner. So wie es auch die Medien nicht gibt oder die Politiker.
Wie fühlt sich eine Stadt an, wie wirkt sie auf ihre Urbewohner und Gäste? Das bleibt ein fast tägliches Tauziehen. Und seit ein paar Monaten ist es schlicht so, dass Pegida viele kräftige Männer mehr ans Tau bringt als alle anderen zusammen.
Warum das so ist, haben vom Ortsbeirat bis zur Bundeskanzlerin nun fast alle zu deuten und auszuleuchten versucht. Manche nutzten dafür die feine Klinge des Laserpointers, andere versuchten es mit dem Handscheinwerfer als größtmöglicher Wumme. Viel Licht also. Und was haben wir da gesehen?
Wir haben gesehen, dass es eben doch ein verdammtes Problem ist, wenn es keinen Diskurs mehr gibt. Wir haben gesehen, dass Vereinzelung auch eine gefährliche Orientierungslosigkeit des Einzelnen bedeuten kann. Wir haben gesehen, dass bei vielen der grundsätzliche Glaube an das Gelingen der Dinge verloren gegangen ist, so er denn je fest und vorhanden gewesen war.
Wir haben Gräben gesehen, deren Ausmaße wir bislang nur geahnt hatten.
Nun ist das viele Licht wieder ein wenig gedimmt worden. Dresden wird vorerst trotzdem bleiben, was es geworden ist: eine nervöse und verängstigte Stadt. Weil Unversöhnlichkeit auf der Seite von Pegida eine Existenzbedingung ist – ohne Dissens keine Wut, und ohne Wut kein Widerstand. Weil auf der anderen Seite das Engagement sich auf einen nanoskopisch kleinen und damit überlasteten Teil der Bevölkerung bezieht – ausgestattet mit dem stillen Mandat einer sattsamen Mehrheit, die dann aber doch lieber am Wochenende wandern geht oder das samtene Polster im Staatsschauspiel besetzt als am nasskalten Montag danach den Platz davor.
Erinnerung zwei geht zurück auf den Februar dieses Jahres. Wie an praktisch jedem Montag der Gegenwart hatte das Zentralkomitee der Pegida eine Demonstration angemeldet, also kamen die Leute, und sie kamen mit Laserpointern, leuchtenden Displays und diesen klobigen Handscheinwerfern aus dem Baumarkt. Ein derart bewaffneter älterer Mann stand an besagtem Montag mit seinem Sohn vor mir in der Menge. Bis zum Vortrag von Lutz Bachmann blieb noch etwas Zeit, also knipste der Vater den Scheinwerfer an und bestrahlte die Frauenkirche in wildkurvigen Bahnen. In seinen Augen glitzerte der bescheidene Stolz, sich an der großen Frauenkirche einmal sichtbar zu machen, den trägen Stein zu ärgern und dabei so etwas wie Macht zu spüren, und sei es auch eine denkbar sinnlose. All das meinte er gewiss, als er schließlich zu seinem Sohn sagte: „Geil, oder?“ Rabimmel, Rabammel, Raboom!
Der Widerspruchsgeist dieser Stadt liegt im arithmetischen Mittel vermutlich irgendwo zwischen diesen beiden Anekdoten. Denn, so banal das ist: Das Dresden gibt es genauso wenig wie die Dresdner. So wie es auch die Medien nicht gibt oder die Politiker.
Wie fühlt sich eine Stadt an, wie wirkt sie auf ihre Urbewohner und Gäste? Das bleibt ein fast tägliches Tauziehen. Und seit ein paar Monaten ist es schlicht so, dass Pegida viele kräftige Männer mehr ans Tau bringt als alle anderen zusammen.
Warum das so ist, haben vom Ortsbeirat bis zur Bundeskanzlerin nun fast alle zu deuten und auszuleuchten versucht. Manche nutzten dafür die feine Klinge des Laserpointers, andere versuchten es mit dem Handscheinwerfer als größtmöglicher Wumme. Viel Licht also. Und was haben wir da gesehen?
Wir haben gesehen, dass es eben doch ein verdammtes Problem ist, wenn es keinen Diskurs mehr gibt. Wir haben gesehen, dass Vereinzelung auch eine gefährliche Orientierungslosigkeit des Einzelnen bedeuten kann. Wir haben gesehen, dass bei vielen der grundsätzliche Glaube an das Gelingen der Dinge verloren gegangen ist, so er denn je fest und vorhanden gewesen war.
Wir haben Gräben gesehen, deren Ausmaße wir bislang nur geahnt hatten.
Nun ist das viele Licht wieder ein wenig gedimmt worden. Dresden wird vorerst trotzdem bleiben, was es geworden ist: eine nervöse und verängstigte Stadt. Weil Unversöhnlichkeit auf der Seite von Pegida eine Existenzbedingung ist – ohne Dissens keine Wut, und ohne Wut kein Widerstand. Weil auf der anderen Seite das Engagement sich auf einen nanoskopisch kleinen und damit überlasteten Teil der Bevölkerung bezieht – ausgestattet mit dem stillen Mandat einer sattsamen Mehrheit, die dann aber doch lieber am Wochenende wandern geht oder das samtene Polster im Staatsschauspiel besetzt als am nasskalten Montag danach den Platz davor.
Wenn Dresden irgendwie Residenzstadt geblieben ist, dann auch in dem Sinne, dass viele hier noch immer zu selbstbezogen und sich zu fein sind, auch mal für etwas einzustehen, das größer ist als sie selbst. Dass sie sich, ohne größeres Unbehagen, einrichten in ihrer Unbeteiligtheit. Montagsdemos? Hab ich nichts mit zu tun. Gegenprotest? Sollen mal schön die anderen machen.
Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen, wer Pegida ist und wer Pegida folgt. Wir haben einerseits gesehen, welche nachvollziehbaren Ängste und Sorgen viele dieser Follower bewegen, und andererseits, zu welch kalter Gewalt und Hartherzigkeit ein Teil von ihnen in der Lage ist. Echte Teilmengen von Pegida, deren Grölen keine andere Botschaft aussendet als: Ich-mach-dich-platt. Weil du nicht von hier kommst. Weil du Politiker bist. Weil du Lohnschreiber bist. Letztlich: Weil du anders bist als ich. Ich-mach-dich-platt. Auf Sächsisch: Schmachddschbladd! Wir haben, abgesehen von beschämend wenigen Ausnahmen, nie überblicken können: Wer sind die anderen, und wenn ja, wie viele?
Wenn es Angst gibt in dieser Stadt, dann kommt sie auch aus diesem Licht-Schatten-Spiel von Gewissheit und Ungewissheit. Von der Gewissheit einerseits, wie groß und gewaltig das Potenzial von Pegida ist. Und von der Ungewissheit andererseits, wer und wie viele dem eigentlich entgegenstehen.
So gesehen ist natürlich dieser Text schon wieder Teil des Problems. Wenn wir die Angst loswerden wollen, die Verunsicherung und die Furcht, dann hilft das ganze – Verzeihung – salonlinke Gedöns nicht weiter. Wer einer so großen Kleingruppe wie Pegida nicht die Macht über die Öffentlichkeit überlassen will, der muss das Wort Macht auch als einen an sich gerichteten Imperativ verstehen: Macht! Und zwar etwas. Macht Konzerte, macht Bürgerforen, macht (Platz für Ihre Gedanken).
Und wenn es hilft, dann treffen wir uns nächste Woche alle zum Lampionumzug, in Ordnung? Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht. Rabimmel, rabammel, rabumm.
Cornelius Pollmer studierte in Dresden Volkswirtschaft und ist nach verschiedenen journalistischen Stationen seit 2013 Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen, wer Pegida ist und wer Pegida folgt. Wir haben einerseits gesehen, welche nachvollziehbaren Ängste und Sorgen viele dieser Follower bewegen, und andererseits, zu welch kalter Gewalt und Hartherzigkeit ein Teil von ihnen in der Lage ist. Echte Teilmengen von Pegida, deren Grölen keine andere Botschaft aussendet als: Ich-mach-dich-platt. Weil du nicht von hier kommst. Weil du Politiker bist. Weil du Lohnschreiber bist. Letztlich: Weil du anders bist als ich. Ich-mach-dich-platt. Auf Sächsisch: Schmachddschbladd! Wir haben, abgesehen von beschämend wenigen Ausnahmen, nie überblicken können: Wer sind die anderen, und wenn ja, wie viele?
Wenn es Angst gibt in dieser Stadt, dann kommt sie auch aus diesem Licht-Schatten-Spiel von Gewissheit und Ungewissheit. Von der Gewissheit einerseits, wie groß und gewaltig das Potenzial von Pegida ist. Und von der Ungewissheit andererseits, wer und wie viele dem eigentlich entgegenstehen.
So gesehen ist natürlich dieser Text schon wieder Teil des Problems. Wenn wir die Angst loswerden wollen, die Verunsicherung und die Furcht, dann hilft das ganze – Verzeihung – salonlinke Gedöns nicht weiter. Wer einer so großen Kleingruppe wie Pegida nicht die Macht über die Öffentlichkeit überlassen will, der muss das Wort Macht auch als einen an sich gerichteten Imperativ verstehen: Macht! Und zwar etwas. Macht Konzerte, macht Bürgerforen, macht (Platz für Ihre Gedanken).
Und wenn es hilft, dann treffen wir uns nächste Woche alle zum Lampionumzug, in Ordnung? Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht. Rabimmel, rabammel, rabumm.
Cornelius Pollmer studierte in Dresden Volkswirtschaft und ist nach verschiedenen journalistischen Stationen seit 2013 Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.









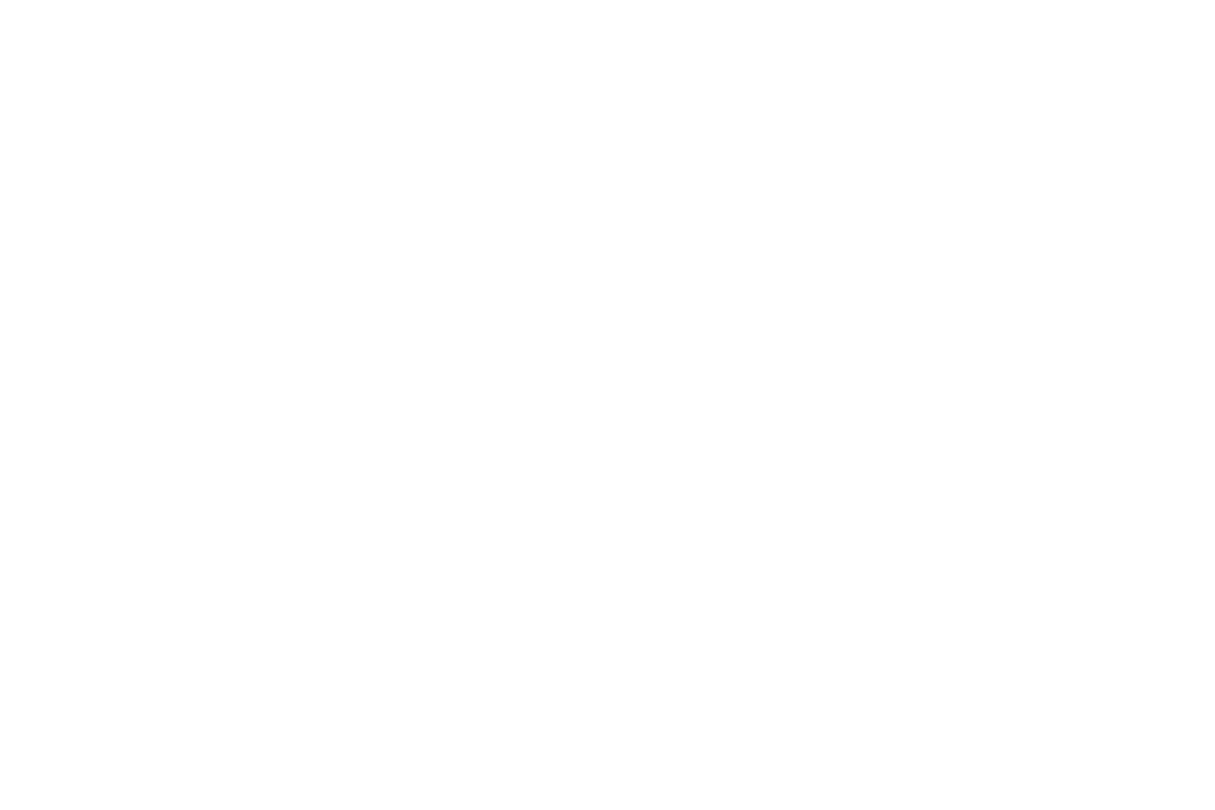



Volker Lösch hat eine fast diabolische Lust, die gärenden Widersprüche der Gesellschaft an die Oberfläche des Theaters zu ziehen. Manchmal wirkt das gewollt, hier ist es notwendig.
Theater ist Konflikt. In dieser Aufführung ist der Konflikt nicht dargestellt, sondern präsent. Das ist ihre Kraft.“
Da wird von einem Gefühl der totalen Unsicherheit in der Stadt berichtet. Und Annedore Bauer tobt sich in einer nicht enden wollenden furiosen Wutrede über die schweigende, brave Bürgerschaft aus. Dabei greift sie massiv die Inaktivität und Phrasen des Dresdner Bürgermeisters und des sächsischen Ministerpräsidenten an.
Torsten Ranft stellt virtuos eine traurig-komische Angela Merkel auf die Bühne und entlarvt dabei die Hohlheit ihrer Worte. Während seine Kollegin, die Sigmar Gabriel verkörpert, mit diesem das gleiche tut. Während der 17-jährige Syrer Joussef Safok still und eindringlich von seiner Flucht erzählt.
Mit diesem Panorama der Wahrnehmungen und Meinungen wird eine Haltungsentschiedenheit gefordert.
Fazit: Volker Lösch ist mit seinen Schauspielern und dem Bürgerchor eine virtuose Inszenierung mit vielen aufklärerischen Effekten gelungen. Natürlich, und das muss kein Nachteil sein, fand sie vor einem einverständigen Publikum statt, das mit Standing Ovations reagierte.“
Mehr und mehr wird das Publikum direkt involviert und unmittelbar einbezogen. Hierzu fallen einige Spieler vorm heruntergelassenen Vorhang aus ihren Rollen zur Zuschaueransprache, schildern ihre persönlichen Erfahrungen im gegenwärtigen Dresden, ihre Meinung über Pegida. Schauspielstudentin Andrea Weis will nur noch die Ausbildung abschließen, dann Reißaus nehmen. Antje Trautmann hält einen eindrücklich-anklagenden Monolog über das allumfassende Schweigen, das Nichtaufstehen und das Versagen der sächsischen CDU-Landespolitik. Das führt zu zahleichen Szenenapplausen, wobei dem Publikum angeraten wird, nicht zu klatschen, sondern montags lieber zur Gegendemo zu gehen. Zum Schluss hin steigern sich Ben Daniel Jöhnk – schon als Graf ein viriler Charismatiker – und Lea Ruckpaul zu einem absurd wirkenden Rededuett. Pegida sei das eigentliche Opfer eines ‚faschistischen‘ BRD-Systems, das das Land durch ‚ausländische Invasoren‘ vernichtet, ist da zum Beispiel zu hören. Wie sich Ruckpaul gestisch grotesk mit immer sexualisierter werdender Energie gegen ‚Gender-Wahnsinn‘ und ‚überzogenen Sexualscheiß‘ in die Hysterie geifert, ist großartig gespielt. Wenn man nicht wüsste, dass das alles Redefragmente der in Wahrheit noch vulgärer auftretenden Pegida-Galionsfiguren Lutz Bachmann und Tatjana Festerling sind, wäre das feinstes Kabarett.
Gut gebaut und toll gespielt, bleibt vom Abend der Charakter eines Lehrstücks zurück, das die Mühen knallharter Agitation mit Leichtigkeit nimmt. Hier muss keiner erst überzeugt werden. Der Saal feiert sich – und zu Recht Regie und Schauspieler – in der Selbstvergewisserung, dass es noch Widerspruch gibt. Pegida selbst wird man damit nicht erreichen. In Zeiten aber, wo hier Stadtspitze und residierende Landesregierung zu Aufmärschen und Übergriffen schweigen, ist das unerhört genug. ‚Ich will ein Theater, das die Wirklichkeit verunmöglicht‘, ruft Antje Trautmann frustriert wütend in den Saal. Hiervon, von einer neuen Form politischen Theaters, war beim perspektivisch etwas aufgefächertem alten Agitprop-Rezept nichts zu erfahren. Vielleicht aber ist es ein Anfang für Dresden, muss die Form auch einmal notwendig dem Inhalt folgen, wenn sich das Theater hier den demokratischen Ort und Akteur nicht nur behaupten will.“
In zwischengeschalteten Monologen geben die Schauspieler wiederum ihrer Empörung Raum: Sie klagen die Tatenlosigkeit an, die des Publikums, das sich montags keinen Gegendemonstrationen anschließt, die der Politiker, auch ihre eigene. Die Ansprache könnte nun direkter kaum sein, Öderland ist weit weg, es herrscht die aufgeheizte Atmosphäre der Gegenwart. Jedes Statement der Schauspieler wird beklatscht, eine grandiose Wutrede von Annedore Bauer, die immer wieder die Bühne entert und immer noch einen draufsetzt in ihrem Zorn über die halbherzige CDU-Politik in Stadt und Land, wird von Juchzern unterbrochen und zuletzt frenetisch bejubelt.
Torsten Ranft karikiert mit Merkel-Robe und -Raute die quietistisch angehauchte Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin. Und Ben Daniel Jöhnk, der in ‚Öderland‘ den Staatsanwalt gibt, und Lea Ruckpaul fetzen dem Publikum mit komischen Körperexplosionen und stimmlicher Selbstverausgabung einen grausig-grotesken Zusammenschnitt aus authentischen Pegida-Zitaten entgegen. Das stille Gegenprogramm schließlich liefert der 17-jährige Syrer Joussef Safok, der mit seinem Smiley-Shirt so gar nichts Bedrohliches ausstrahlt und mit ruhiger Dringlichkeit von den Motiven und Umständen seiner Flucht berichtet.
Die Entschiedenheit, mit der sich das Theater hier positioniert, ist schon beeindruckend. Sehr beeindruckend sogar.“
Volker Lösch und sein grandioses Ensemble haben einen Abend der Sprach- und Bildgewalt geschaffen, wie ihn Dresden dringend braucht. Man polemisiert nicht einfach gegen Pegida. Hier kämpft man differenziert gegen politische Faulheit der Bevölkerung.
Zur Aktivierung steigen Lea Ruckpaul, Ben Daniel Jöhnk, Benjamin Pauquet oder Annedore Bauer bisweilen aus ihren Rollen aus, treten vor und offenbaren ihre persönlichen Gedanken, Anschuldigungen, Ängste.
Ganz im Brecht’schen Verfremdungssinn gelingt dieses Konzept. Der Zuschauer ist von Merkel-Parodien belustigt, von Flüchtlingsberichten betroffen und gibt spontanen Zwischenapplaus. Und ab und zu entlarvt sich das Publikum, wenn es an der falschen Stelle lacht. Denn ‚links-versiffte Schundblätter‘ und ‚verkorkste Gendertanten‘ sind Vokabeln der Montagshetzer.
Am Ende tragen die Wutbürger auf der Bühne barocke Tarnkleidung und haben Äxte sowie lodernde Fackeln in der Hand.
Dazu persifliert Torsten Ranft kontrastreich August den Starken. In sächsischdümmlicher Manier übergibt er dem Grafen ein riesiges Schwert als Machtsymbol.
Doch der hat die Kontrolle verloren, denn die Wutgeister, die er rief, kann er nicht mehr stoppen. Jetzt herrscht Bürgerkrieg.
Ja, das ist eine düstere Vision. Aber gibt es in unserer verfahrenen Situation noch eine Chance? Der lange Beifall des stehenden Publikums ist zumindest ein politischer Hoffnungsschimmer.“
Sechs Minuten stehende Ovationen nach dem Vorhang. Wenige blieben betroffen sitzen, noch weniger verließen schnell den Saal. Die Premiere war ein Heimspiel, bei den Repertoirevorstellungen könnte das Echo geteilter ausfallen. Was immer noch für diese fulminante Aufführung spräche, denn sie gestattet kein bequemes Zurücklehnen auf der ‚Reservebank‘, nicht einmal die im Erbauungstheater liebgewordene Beobachterposition. Eine ‚Moritat‘ nennt Max Frisch sein Stück. Wir sind umso mehr mittendrin in dieser Schauergeschichte, als die Truppe Lösch gar nichts löscht, sondern das Menetekel zu Ende spielt. Was ist, wenn die ‚Bewegung‘ tatsächlich zur Axt greift, der von Pegida heraufbeschworene Bürgerkrieg ganz Europa erfasst? Wer hält uns dann noch auf einer staatlich subventionierten Bühne den Spiegel vor?“
Zwischendurch gibt’s eine lustige Merkel-Parodie (Torsten Ranft), die sich ob der Flüchtlingsschicksale Tränchen aus den Augen drückt: Rührend harmlos im Shirt mit einem großen Smiley erzählt der 17-jährige Syrer Joussef Safok seine Fluchtgeschichte. Und zum komödiantischen Höhepunkt wird die ‚Regierungserklärung‘ des Staatsanwalts (Ben Daniel Jöhnk) und seiner Partnerin (Lea Ruckpaul), die sich immer hitziger und neurotisch verdrehender hineinsteigern in ihre furchterregend schwachsinnige Rede, die aus Pegida-O-Tönen zusammengeschnitten ist.“
Als Gegenposition setzt Lösch einzelne Statements von Ensemblemitgliedern, die sich in furiosen Monologen in Rage reden oder von schlimmen persönlichen Erfahrungen der vergangenen Wochen berichten. Immer wieder gibt es dabei auch ganz direkte Aufrufe an das Publikum, doch Flagge zu zeigen und die Straße nicht den Fremdenfeinden zu überlassen. Denn: ‚Wir sind das Volk!‘, nicht die Wutbürger, sondern die WOD-Bürger, die wie das Staatsschauspiel die ‚Initiative weltoffenes Dresden‘ (#WOD) unterstützen.“
Für sich sprechen auch die Schauspieler. Sie würden gern für viel mehr Dresdner sprechen als für jene, die am Schluss sechs Minuten stehend applaudierten. Die Hauptdarsteller Ben Daniel Jöhnk und Lea Ruckpaul appellieren mit Verve, endlich etwas zu tun, den ‚Soziologenblick‘.
Annedore Bauer ätzt am unverblümtesten gegen 25 Jahre Ignoranz und schweigende Toleranz der CDU gegenüber dem Nazi-Gift, die der Radikalisierung Vorschub geleistet habe. Das kann man angesichts der Situation nicht als Agitprop abtun. Es ist auch kein Kabarett, wenn gegen Ende der Kommissar mit Sigmar-Gabriel-Bauch und der Innenminister im violetten Tantenkostüm der Kanzlerin auftreten. ‚Ihr gehört nicht zu uns!‘, rufen sie, aber in welch selbstgefälliger Weise sie sich teils schon im Führerduktus vom ‚Pack‘ distanzieren, schürt wiederum eher Empörung gegen ‚die da oben‘.
Eine fulminante Inszenierung, zu der man sich verhalten muss, die kein bequemes Zurücklehnen auf der ‚Reservebank‘ gestattet. Was ist, wenn die ‚Bewegung‘, wie im Stück, tatsächlich zur Axt greift, der von Pegida schon beschworene Bürgerkrieg ganz Europa erfasste?“
Viel Stoff zu nachhaltigem Nachdenken. Auch darüber, inwieweit das alles ein Zerrbild sei und allzu plakativ. Ein Schock ist es allemal. Obendrein im bravourösen Wechsel zwischen rasender Farce, greller Groteske und gellendem Kabarett toll gemacht von den Akteuren, die zwischendurch immer wieder aus ihren Rollen heraustreten und dem verblüfften Publikum ihre persönliche, schmerzliche Befindlichkeit im so zwielichtigen Elbtal vor den Kopf knallen.
Zum Finale schließlich, auch das noch, ein wuchtiges Menetekel: In der dicken braunen Luft von Öderelbeland eskaliert die Wutbewegung zum Bürgerkrieg. Stehende Ovationen. Dazu die Wutworte von der Rampe: Klatscht Euch bloß nicht frei von Verantwortlichkeit! Forscht nach dem korrekt verdrängten Fascho in Euch selbst! Werdet wachsam! Soviel Imperativ, soviel Agitprop muss sein. Von hehrer Kunst hat Dresden allemal im Übermaß, von Zivilcourage eher nicht.“