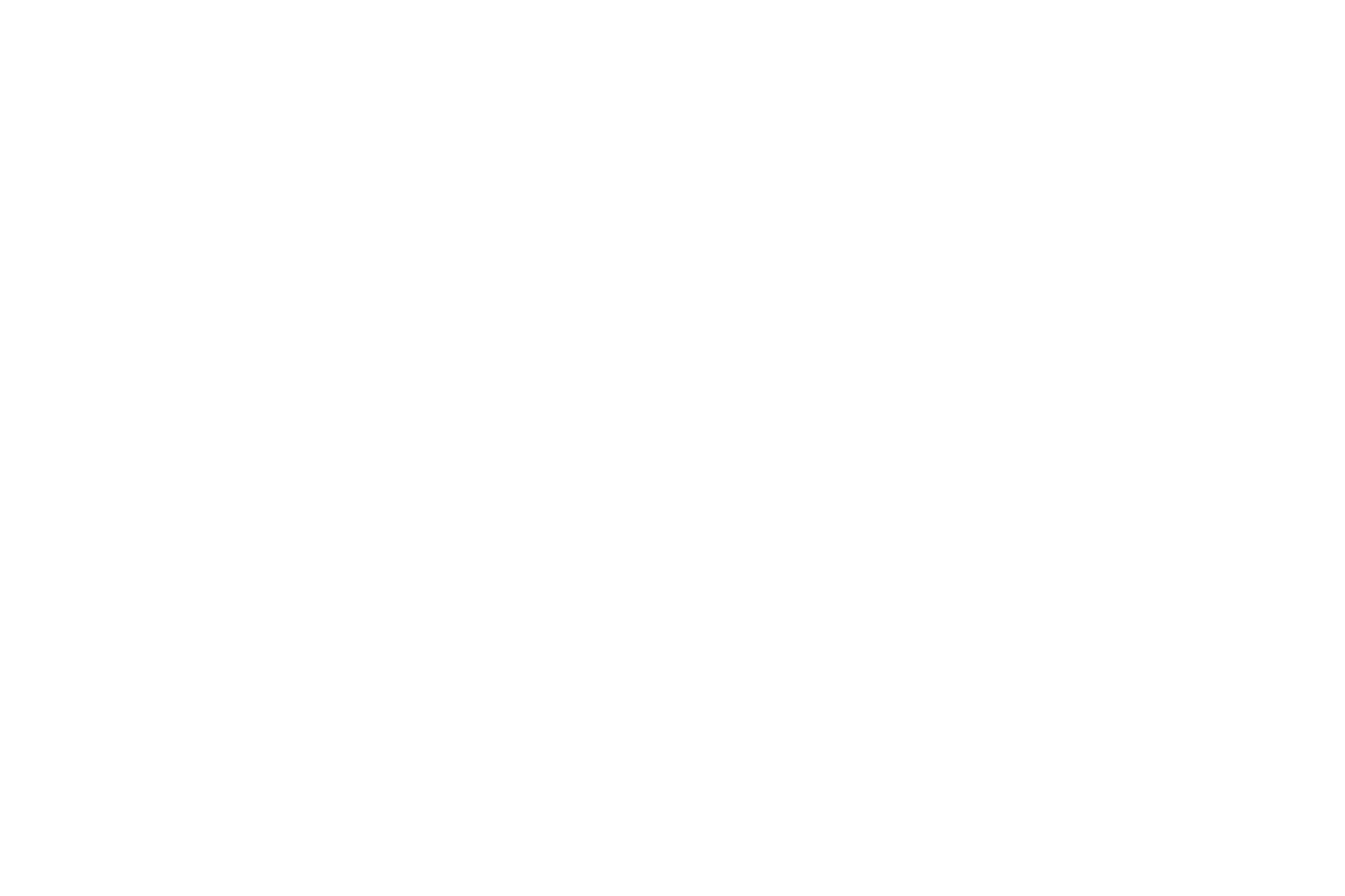Premiere 23.11.2013
› Schauspielhaus
Geschichten aus dem Wiener Wald
Volksstück von Ödön von Horváth
Handlung
Eine stille Straße: eine Fleischhauerei, eine Puppenklinik, ein Tabakladen und Menschen, die trinken, sich lieben oder zumindest davon reden – und am Ende stirbt ein Kind. In Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ aus dem Jahre 1931 sehnen sich alle nach Ruhe, Geborgenheit und Heimat. Und handeln doch nicht danach. Da ist Marianne, die Tochter des „Zauberkönigs“, die den reichen Fleischhauer Oskar heiraten soll, sich aber für den abgehalfterten Alfred entscheidet. Zwar beendet Alfred sein Verhältnis mit Valerie, die sein Lotterleben bisher finanzierte, und bald darauf bekommen er und Marianne ein Kind. Doch das Glück währt nicht lang: Der kleine Leopold wird aufs Land geschickt, Marianne verdingt sich aus existentieller Not im Nachtclub „Maxim“ als Tänzerin, und so nimmt das Unglück seinen Lauf ...
Ödön von Horváth schrieb „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in den späten 1920er Jahren während der Weltwirtschaftskrise, von der die Menschen nach dem 1. Weltkrieg unmittelbar betroffen waren und deren Auswirkungen ein Nährboden für die Ideologie der Nationalsozialisten waren. „Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit“, hat Horváth über sein Stück geschrieben. Eine Dummheit, die den Selbstbetrug forciert. In ihm lässt es sich eine Weile leben – aber eben nur eine Weile lang. Regie führt Barbara Bürk, die sich ihren Figuren mit einem liebevollen Blick nähert. Feiner Witz und eindrückliche Bilder gehören ebenso zu ihrer Regiehandschrift wie Milieugenauigkeit, deutliche Personenzeichnung und hohes Formbewusstsein. Am Staatsschauspiel hat sie bereits Falladas „Kleiner Mann, was nun?“, Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ sowie die Hübner-Uraufführungen „Frau Müller muss weg“ und zuletzt „Was tun“ inszeniert.
Ödön von Horváth schrieb „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in den späten 1920er Jahren während der Weltwirtschaftskrise, von der die Menschen nach dem 1. Weltkrieg unmittelbar betroffen waren und deren Auswirkungen ein Nährboden für die Ideologie der Nationalsozialisten waren. „Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit“, hat Horváth über sein Stück geschrieben. Eine Dummheit, die den Selbstbetrug forciert. In ihm lässt es sich eine Weile leben – aber eben nur eine Weile lang. Regie führt Barbara Bürk, die sich ihren Figuren mit einem liebevollen Blick nähert. Feiner Witz und eindrückliche Bilder gehören ebenso zu ihrer Regiehandschrift wie Milieugenauigkeit, deutliche Personenzeichnung und hohes Formbewusstsein. Am Staatsschauspiel hat sie bereits Falladas „Kleiner Mann, was nun?“, Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ sowie die Hübner-Uraufführungen „Frau Müller muss weg“ und zuletzt „Was tun“ inszeniert.
Besetzung
Regie
Barbara Bürk
Bühne
Anke Grot
Kostüme
Irène Favre de Lucascaz
Musik
Licht
Dramaturgie
Marianne
Yohanna Schwertfeger
Valerie
Rosa Enskat
Mutter / Großmutter
Oskar / Amerikaner
Christian Erdmann
Alfred
André Kaczmarczyk
Erich / Havlitschek
Benjamin Pauquet
Zauberkönig
Rittmeister
am Klavier
Video
Interview
Die Regisseurin Barbara Bürk im Gespräch über das Volkstheater Ödön von Horváths
In „Geschichten aus dem Wiener Wald“ aus dem Jahr 1931 demaskiert der österreichisch-ungarische Dramatiker die kleinbürgerliche Gemütlichkeit einer beschaulichen „stillen Straße“ in Wien und entlarvt die Gefühlskälte ihrer Bewohner.
Ödön von Horváth erzählt die Geschichte von Marianne, die auf den ersten Blick in einer wienerischen Kleinbürgeridylle lebt. Was hat Sie an ihrer Geschichte fasziniert? In was für einer Welt lebt Marianne?
Barbara Bürk: „Eine menschliche Beziehung wird erst dann echt, wenn man was voneinander hat“ – das sagt Mariannes Geliebter Alfred, der sich vor allem durch Pferdewetten und die Gunst reicher Witwen über Wasser hält, zu Beginn des Stückes. Damit wird auf ironische Weise ausgedrückt, in was für einer Welt Marianne lebt: Es ist eine verlogene Welt, in der die Menschen einander materiell und emotional ausnutzen. Die Gefahr, einen anderen bewusst oder unbewusst auszunutzen, um eigene Defizite zu kompensieren, ist immer groß. Das ist ein zeitloses Phänomen. Sowohl in Horváths Stück als auch im realen Leben gehen Täter- und Opferrolle oft ineinander über. Gerade das interessiert mich.
Alle Figuren haben den Ersten Weltkrieg erlebt, sie leiden an der wirtschaftliche Krise der 1930er-Jahre und können sich den Einflüssen des heraufdämmernden Nationalsozialismus nicht entziehen. Sie sind Teil einer verlorenen Generation und wirken doch seltsam gutgläubig und naiv. Steckt in Horváths Welt der kleinen Helden trotzdem auch eine komische Seite?
Komisch ist vor allem der Dialog, die Art zu sprechen. Es bildet sich darin immer ein Gefälle ab – „Was ich sein möchte“ und „Was ich tatsächlich bin“ ist an der Sprache der Horváth’schen Figuren gut abzulesen. Das ist oft lustig und traurig zugleich. Horváth sagt dazu: „Das dramatische Grundmotiv aller meiner Stücke ist der ewige Kampf zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein.“ Oder auch: „Das Wesen der Synthese aus Ernst und Ironie ist die Demaskierung des Bewusstseins.“
Nach Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ inszenieren Sie nun ein weiteres Mal ein sogenanntes Volksstück. Was ist reizvoll an dieser Gattung?
Ein „Volksstück“ bedeutet zunächst einmal nur, dass in einem Stück „Themen des Volkes“, also einfach nachvollziehbare Themen, auf eine möglichst volkstümliche Art behandelt und gestaltet werden. Dabei spielt auch der Unterhaltungswert eine große Rolle. Sowohl Brecht als auch Horváth haben aber keine traditionellen Volksstücke geschrieben. Sie haben, wie Horváth es formuliert, „das alte Volksstück formal und ethisch zerstört“, um eine neue Form des Volkstheaters zu schaffen. Dabei knüpften sie eher an die Tradition der Volkssänger wie Karl Valentin an als an die Autoren klassischer Volksstücke. Ihr Ziel war dabei immer die Demaskierung der Zustände, nicht deren Affirmation. Ich schätze an dieser Gattung vermutlich dasselbe, was Brecht und Horváth dazu veranlasst hat, sich mit ihr zu beschäftigen: die Allgemeingültigkeit der Themen, ihre Bodenständigkeit im besten Sinne, die Verbindung von Sinnlichkeit und Intellekt und die Gleichzeitigkeit von Komik und Tragik.
Ödön von Horváth erzählt die Geschichte von Marianne, die auf den ersten Blick in einer wienerischen Kleinbürgeridylle lebt. Was hat Sie an ihrer Geschichte fasziniert? In was für einer Welt lebt Marianne?
Barbara Bürk: „Eine menschliche Beziehung wird erst dann echt, wenn man was voneinander hat“ – das sagt Mariannes Geliebter Alfred, der sich vor allem durch Pferdewetten und die Gunst reicher Witwen über Wasser hält, zu Beginn des Stückes. Damit wird auf ironische Weise ausgedrückt, in was für einer Welt Marianne lebt: Es ist eine verlogene Welt, in der die Menschen einander materiell und emotional ausnutzen. Die Gefahr, einen anderen bewusst oder unbewusst auszunutzen, um eigene Defizite zu kompensieren, ist immer groß. Das ist ein zeitloses Phänomen. Sowohl in Horváths Stück als auch im realen Leben gehen Täter- und Opferrolle oft ineinander über. Gerade das interessiert mich.
Alle Figuren haben den Ersten Weltkrieg erlebt, sie leiden an der wirtschaftliche Krise der 1930er-Jahre und können sich den Einflüssen des heraufdämmernden Nationalsozialismus nicht entziehen. Sie sind Teil einer verlorenen Generation und wirken doch seltsam gutgläubig und naiv. Steckt in Horváths Welt der kleinen Helden trotzdem auch eine komische Seite?
Komisch ist vor allem der Dialog, die Art zu sprechen. Es bildet sich darin immer ein Gefälle ab – „Was ich sein möchte“ und „Was ich tatsächlich bin“ ist an der Sprache der Horváth’schen Figuren gut abzulesen. Das ist oft lustig und traurig zugleich. Horváth sagt dazu: „Das dramatische Grundmotiv aller meiner Stücke ist der ewige Kampf zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein.“ Oder auch: „Das Wesen der Synthese aus Ernst und Ironie ist die Demaskierung des Bewusstseins.“
Nach Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ inszenieren Sie nun ein weiteres Mal ein sogenanntes Volksstück. Was ist reizvoll an dieser Gattung?
Ein „Volksstück“ bedeutet zunächst einmal nur, dass in einem Stück „Themen des Volkes“, also einfach nachvollziehbare Themen, auf eine möglichst volkstümliche Art behandelt und gestaltet werden. Dabei spielt auch der Unterhaltungswert eine große Rolle. Sowohl Brecht als auch Horváth haben aber keine traditionellen Volksstücke geschrieben. Sie haben, wie Horváth es formuliert, „das alte Volksstück formal und ethisch zerstört“, um eine neue Form des Volkstheaters zu schaffen. Dabei knüpften sie eher an die Tradition der Volkssänger wie Karl Valentin an als an die Autoren klassischer Volksstücke. Ihr Ziel war dabei immer die Demaskierung der Zustände, nicht deren Affirmation. Ich schätze an dieser Gattung vermutlich dasselbe, was Brecht und Horváth dazu veranlasst hat, sich mit ihr zu beschäftigen: die Allgemeingültigkeit der Themen, ihre Bodenständigkeit im besten Sinne, die Verbindung von Sinnlichkeit und Intellekt und die Gleichzeitigkeit von Komik und Tragik.
Welche inszenatorischen Möglichkeiten bietet diese Art von Drama?
Horváths Dramen sind keine realistischen und schon gar keine naturalistischen Stücke. Er selbst hat sogar großen Wert darauf gelegt, dass seine Stücke stilisiert gespielt werden müssen, damit die Allgemeingültigkeit der dargestellten Charaktere betont wird. Das erfordert einerseits von der Regie einen sehr genauen Umgang mit der Sprache, auf der anderen Seite bietet es aber auch viel Freiraum.
Die typische Wiener Musik klingt nicht nur im Titel des Stückes an, sie ist auch immer wieder zu hören. Was verbinden Sie mit diesen Klängen? Wird man sie auch bei uns auf der Bühne hören?
Ich verbinde mit dieser Musik, wie wahrscheinlich die meisten, eine bestimmte Art von „falscher Idylle“. Da kommt einem eine sentimentale Verlogenheit – oder auch verlogene Sentimentalität – entgegen, wobei das Sentimentale sehr verführerisch sein kann. Wer kann sich denn davon freimachen? Musik, vor allem die volkstümliche Musik, rührt ja immer an tiefere Schichten der Seele. Und plötzlich erschrickt man über die Gefühle, die da hochkommen, und weiß gar nicht, ob man sie überhaupt haben will. Ich könnte mir denken, dass Horváth ähnlich empfunden hat – auch in der Musik kämpft dann das Bewusstsein mit dem Unterbewusstsein. Es liegt also erst einmal nahe, dass man diese Klänge auch bei uns hören wird. Aber es werden bestimmt auch noch andere dazukommen …
Das Interview führte die Dramaturgin Beret Evensen.
Horváths Dramen sind keine realistischen und schon gar keine naturalistischen Stücke. Er selbst hat sogar großen Wert darauf gelegt, dass seine Stücke stilisiert gespielt werden müssen, damit die Allgemeingültigkeit der dargestellten Charaktere betont wird. Das erfordert einerseits von der Regie einen sehr genauen Umgang mit der Sprache, auf der anderen Seite bietet es aber auch viel Freiraum.
Die typische Wiener Musik klingt nicht nur im Titel des Stückes an, sie ist auch immer wieder zu hören. Was verbinden Sie mit diesen Klängen? Wird man sie auch bei uns auf der Bühne hören?
Ich verbinde mit dieser Musik, wie wahrscheinlich die meisten, eine bestimmte Art von „falscher Idylle“. Da kommt einem eine sentimentale Verlogenheit – oder auch verlogene Sentimentalität – entgegen, wobei das Sentimentale sehr verführerisch sein kann. Wer kann sich denn davon freimachen? Musik, vor allem die volkstümliche Musik, rührt ja immer an tiefere Schichten der Seele. Und plötzlich erschrickt man über die Gefühle, die da hochkommen, und weiß gar nicht, ob man sie überhaupt haben will. Ich könnte mir denken, dass Horváth ähnlich empfunden hat – auch in der Musik kämpft dann das Bewusstsein mit dem Unterbewusstsein. Es liegt also erst einmal nahe, dass man diese Klänge auch bei uns hören wird. Aber es werden bestimmt auch noch andere dazukommen …
Das Interview führte die Dramaturgin Beret Evensen.