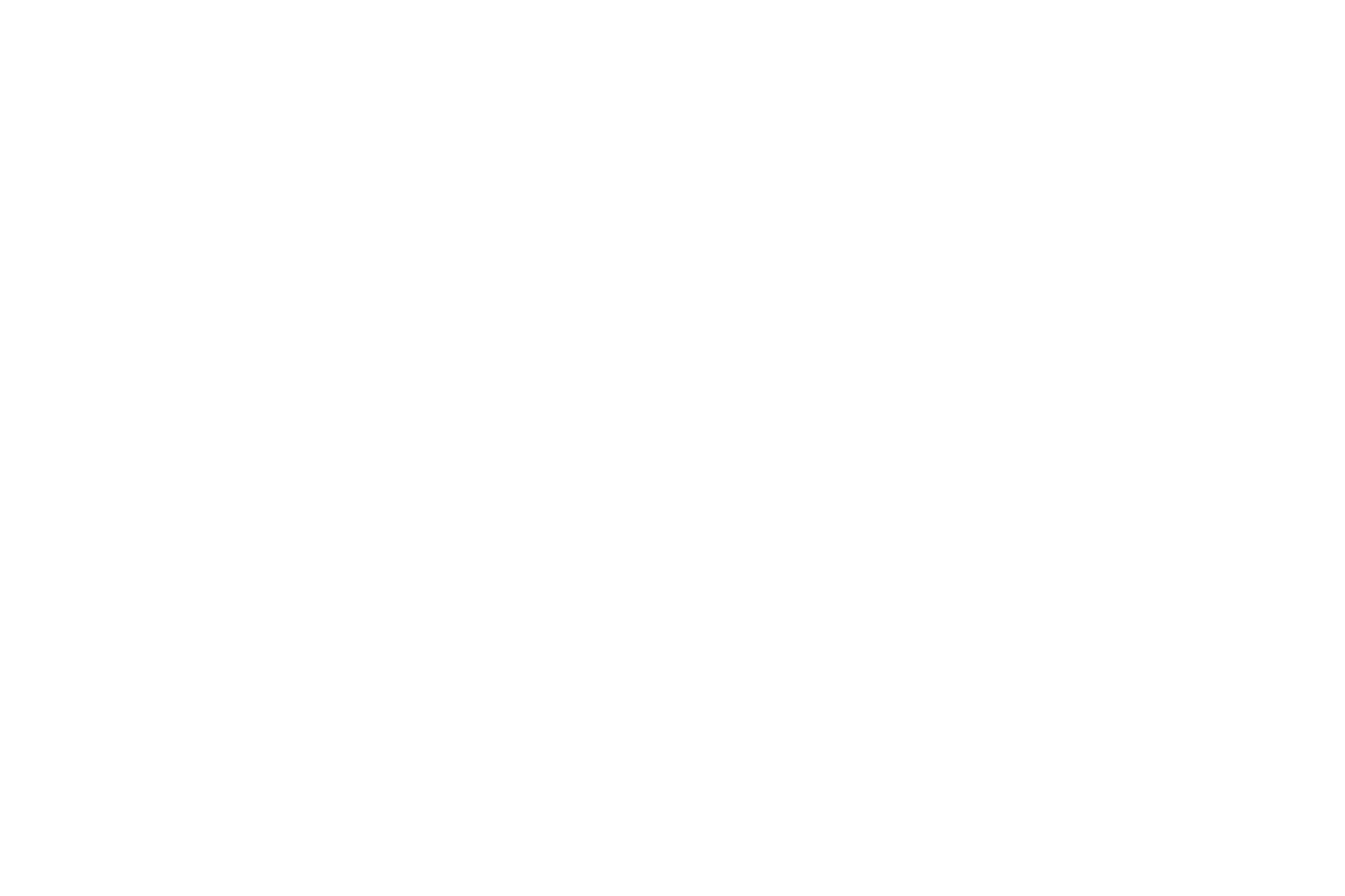Premiere 29.11.2014
› Schauspielhaus
Faust 1
von Johann Wolfgang von Goethe
Handlung
„Habe nun, ach ...“ Faust ist am Ende. Ausgebrannt, gescheitert. Er ist Jurist, Mediziner, Theologe, Philosoph ..., doch all das bringt ihm weder Glück noch Zufriedenheit. Zwar schreckt er vor dem letzten Schritt, dem Selbstmord, zurück, doch wünschen tut er sich den Tod. Da läuft ihm ein Pudel über den Weg, und ein Teufel namens Mephistopheles bietet ihm eine Wette an: Sollte er Faust je dazu bringen zu genießen, sich aufs Faulbett zu legen, dann gehört Fausts Seele im Jenseits dem Teufel. Faust schlägt ein, und Mephisto nimmt Faust mit auf eine Reise durch Welt und Magie, er zeigt ihm Genuss, Begierde und Ekstase, führt ihn in Auerbachs Keller, zu Gretchen und auf den Blocksberg zur Walpurgisnacht. Doch Faust bleibt Zyniker und Egozentriker, er bleibt fordernd und voller Hybris. Am Ende ist die Liebe entzaubert, Gretchen zahlt den Preis, aber zwischen Faust und Mephisto steht es patt.
Über dreißig Jahre lang hat Johann Wolfgang von Goethe an verschiedenen Fassungen des „Faust“ gearbeitet. Der Stoff beruht auf alten Volkssagen, und die Interpretationsgeschichte des Stückes füllt Bibliotheken – ob als Parabel auf „den deutschen Geist“, ob als philosophische Studie über das Subjekt, ob als Volkstheater. In Dresden nimmt sich der schwedische Regisseur Linus Tunström des deutschesten aller Stoffe an und erzählt mit einer Gruppe Schauspieler die Geschichte um den Alltagsmenschen Faust. Tunström ist Regisseur, Schauspieler und Filmemacher und seit 2007 Intendant des Stadttheaters Uppsala. Er hat in Stockholm, London, Kopenhagen und der Schweiz inszeniert und in Uppsala zuletzt große Stoffe wie „Hamlet“, „Anna Karenina“ und „Fanny und Alexander“ von Ingmar Bergman auf die Bühne gebracht.
Über dreißig Jahre lang hat Johann Wolfgang von Goethe an verschiedenen Fassungen des „Faust“ gearbeitet. Der Stoff beruht auf alten Volkssagen, und die Interpretationsgeschichte des Stückes füllt Bibliotheken – ob als Parabel auf „den deutschen Geist“, ob als philosophische Studie über das Subjekt, ob als Volkstheater. In Dresden nimmt sich der schwedische Regisseur Linus Tunström des deutschesten aller Stoffe an und erzählt mit einer Gruppe Schauspieler die Geschichte um den Alltagsmenschen Faust. Tunström ist Regisseur, Schauspieler und Filmemacher und seit 2007 Intendant des Stadttheaters Uppsala. Er hat in Stockholm, London, Kopenhagen und der Schweiz inszeniert und in Uppsala zuletzt große Stoffe wie „Hamlet“, „Anna Karenina“ und „Fanny und Alexander“ von Ingmar Bergman auf die Bühne gebracht.
Besetzung
Regie
Linus Tunström
Bühne und Kostüme
Esther Bialas
Musik
Dramaturgie
Armin Kerber, Felicitas Zürcher
Licht
Michael Gööck
Patient
Marius Ahrendt
Mephisto
Rosa Enskat
Gretchen
Faust
Mephisto
Jan Maak
Faust
Video
Ein Porträt
Ein Porträt des schwedischen Regisseurs Linus Tunström
von Armin Kerber
von Armin Kerber
Das schwedische Theater ist meist realistisch bis ins Mark. Ein Schauspieler, der in Schweden auf die Bühne kommt, ist in erster Linie eine klar umrissene Figur. Ein Stück, das im Theater erzählt wird, wird immer noch in erster Linie erzählt. Diese Liebe zum Realismus betrifft nicht nur das Theater, sondern genauso die Literatur und den Film, man könnte auch sagen, das ganze Land möchte vor allem eines sein: realistisch.
Geht es um das Trinkverhalten, dann ist es realistisch, die Alkoholvorräte in den Läden ab 18 Uhr zu verschließen und sie danach in den Bars sündhaft teuer zu verkaufen. Geht es um das Sterben auf den Autostraßen, ist das strikteste Tempolimit Europas realistisch. Geht es um eine Gesellschaft mit möglichst wenigen Risiken und Nebenwirkungen, dann sind Höchststeuersätze realistisch. Anders gesagt: Realismus ist in Schweden keine ästhetische Haltung, sondern eine Art Vollkaskoversicherung der Realität gegen sich selbst. „Protect me from what I want“ – dieser von Jenny Holzer zum geflügelten Kunstslogan geadelte Songtitel könnte als Schlüssel zu vielen Spielregeln des schwedischen Alltags dienen. Denn wer hier zu Höhenflügen anhebt, macht sich schnell der Abgehobenheit verdächtig, wen es in die Tiefe zieht, den umarmt die freundliche Gruppe, wer große Gefühle offenlegt, auf den wartet die Supervision – und nicht das Theater.
Linus Tunström liebt Höhenflüge und große Gefühle. Es ist hilfreich, dies zu wissen, denn Tunström kommt aus Schweden, macht Theater und geht gelegentlich am Wochenende Fallschirmspringen. Außerdem ist er leidenschaftlicher Taucher. Seine Theaterausbildung hat er nicht zu Hause in Schweden gemacht. Mit zwanzig Jahren ist er nach Paris gegangen auf die Schauspielschule von Jacques Lecoq, die für ihren antirealistischen, um intensiven Körperausdruck bemühten Ansatz bekannt ist. Nach seiner Rückkehr Mitte der 1990er-Jahre konnte er sich in Schweden mit Aufführungen, die sich dank ihrer Expressivität, ihrer körperlichen Rasanz und ihrer Lust am Pathos deutlich vom schwedischen Realismus abgrenzten, rasch als Regisseur durchsetzen – zunächst in der Offszene, dann an den Staatstheatern von Göteborg, Malmö und Stockholm, dazwischen gab es Ausflüge nach Kopenhagen, London, in die Schweiz und nach Cannes, wo er mit einem Kurzfilm den Preis der Kritik gewann.
Linus Tunström war gerade mal Mitte dreißig, als er zum Intendanten des Stadttheaters Uppsala berufen wurde. Im Unterschied zu diversen regieführenden Intendanten entschied er sich dafür, das Haus nicht als zentrifugales Gefäß für seine eigenen Inszenierungen zu benutzen, sondern nur einmal im Jahr selbst Regie zu führen. Mit dieser
Entscheidung verwandelte Tunström das kleine Theater Uppsala innerhalb von wenigen Jahren in ein theatrales Feldforschungslager, in dem Theaterleute mit den unterschiedlichsten Handschriften zusammentreffen. Er holte sie aus der Ukraine, aus Finnland und aus der schwedischen Offszene, aus Deutschland kam die Performancegruppe She She Pop, um in einem Workshop neue performative Abmischungsformen mit den Schauspielern des festen Ensembles auszuprobieren. Für eine Popmusikrevue im Dokumentartheaterstil engagierte er Tomas Alfredson, der später den Oscar-prämierten Hollywoodfilm „Dame, König, As, Spion“ drehte.
Innerhalb kürzester Zeit wurde aus Linus Tunström, dem „jungen Wilden“, eine der gewieftesten Führungskräfte der schwedischen Kulturszene. Im Jahr 2009 gewann er den Schwedischen Kritikerpreis, der normalerweise an Schauspieler oder Regisseure für ihre künstlerische Arbeit vergeben wird. Tunström erhielt ihn explizit als Intendant, der das beschauliche Stadttheater Uppsala in „Schwedens dynamischste Bühne“ verwandelt hatte. Als Regisseur zieht sich Linus Tunström zurück, um dann einmal jährlich mit Mut zu emotionalen Crashkursen, choreografischen Achterbahnfahrten und ästhetischen Wechselbädern künstlerische Akzente zu setzen.
Geht es um das Trinkverhalten, dann ist es realistisch, die Alkoholvorräte in den Läden ab 18 Uhr zu verschließen und sie danach in den Bars sündhaft teuer zu verkaufen. Geht es um das Sterben auf den Autostraßen, ist das strikteste Tempolimit Europas realistisch. Geht es um eine Gesellschaft mit möglichst wenigen Risiken und Nebenwirkungen, dann sind Höchststeuersätze realistisch. Anders gesagt: Realismus ist in Schweden keine ästhetische Haltung, sondern eine Art Vollkaskoversicherung der Realität gegen sich selbst. „Protect me from what I want“ – dieser von Jenny Holzer zum geflügelten Kunstslogan geadelte Songtitel könnte als Schlüssel zu vielen Spielregeln des schwedischen Alltags dienen. Denn wer hier zu Höhenflügen anhebt, macht sich schnell der Abgehobenheit verdächtig, wen es in die Tiefe zieht, den umarmt die freundliche Gruppe, wer große Gefühle offenlegt, auf den wartet die Supervision – und nicht das Theater.
Linus Tunström liebt Höhenflüge und große Gefühle. Es ist hilfreich, dies zu wissen, denn Tunström kommt aus Schweden, macht Theater und geht gelegentlich am Wochenende Fallschirmspringen. Außerdem ist er leidenschaftlicher Taucher. Seine Theaterausbildung hat er nicht zu Hause in Schweden gemacht. Mit zwanzig Jahren ist er nach Paris gegangen auf die Schauspielschule von Jacques Lecoq, die für ihren antirealistischen, um intensiven Körperausdruck bemühten Ansatz bekannt ist. Nach seiner Rückkehr Mitte der 1990er-Jahre konnte er sich in Schweden mit Aufführungen, die sich dank ihrer Expressivität, ihrer körperlichen Rasanz und ihrer Lust am Pathos deutlich vom schwedischen Realismus abgrenzten, rasch als Regisseur durchsetzen – zunächst in der Offszene, dann an den Staatstheatern von Göteborg, Malmö und Stockholm, dazwischen gab es Ausflüge nach Kopenhagen, London, in die Schweiz und nach Cannes, wo er mit einem Kurzfilm den Preis der Kritik gewann.
Linus Tunström war gerade mal Mitte dreißig, als er zum Intendanten des Stadttheaters Uppsala berufen wurde. Im Unterschied zu diversen regieführenden Intendanten entschied er sich dafür, das Haus nicht als zentrifugales Gefäß für seine eigenen Inszenierungen zu benutzen, sondern nur einmal im Jahr selbst Regie zu führen. Mit dieser
Entscheidung verwandelte Tunström das kleine Theater Uppsala innerhalb von wenigen Jahren in ein theatrales Feldforschungslager, in dem Theaterleute mit den unterschiedlichsten Handschriften zusammentreffen. Er holte sie aus der Ukraine, aus Finnland und aus der schwedischen Offszene, aus Deutschland kam die Performancegruppe She She Pop, um in einem Workshop neue performative Abmischungsformen mit den Schauspielern des festen Ensembles auszuprobieren. Für eine Popmusikrevue im Dokumentartheaterstil engagierte er Tomas Alfredson, der später den Oscar-prämierten Hollywoodfilm „Dame, König, As, Spion“ drehte.
Innerhalb kürzester Zeit wurde aus Linus Tunström, dem „jungen Wilden“, eine der gewieftesten Führungskräfte der schwedischen Kulturszene. Im Jahr 2009 gewann er den Schwedischen Kritikerpreis, der normalerweise an Schauspieler oder Regisseure für ihre künstlerische Arbeit vergeben wird. Tunström erhielt ihn explizit als Intendant, der das beschauliche Stadttheater Uppsala in „Schwedens dynamischste Bühne“ verwandelt hatte. Als Regisseur zieht sich Linus Tunström zurück, um dann einmal jährlich mit Mut zu emotionalen Crashkursen, choreografischen Achterbahnfahrten und ästhetischen Wechselbädern künstlerische Akzente zu setzen.
2008 brachte Linus Tunström in seiner ersten Inszenierung in Uppsala die Dramatisierung des Romans „Der Dieb“ zur Uraufführung, geschrieben von seinem Vater Göran Tunström, einem in Schweden viel gelesenen Schriftsteller. Die schwer zu ertragende Realität des Buches gründet in einem Sumpf aus Inzucht, Gewalt, Alkoholismus und Depressivität, den Linus Tunström trockenlegte, indem er jeden Realismus im Keim erstickte und die geknechtete, vom Unglück gekreuzigte Hauptfigur in einen Stand-up-Comedian verwandelte, der großzügig Alkohol ans Publikum ausschenkt und die Bitterkeit seines Schicksals in Lachsalven ertränkt.
Ingmar Bergmans nordisches Weihnachtsmärchen „Fanny und Alexander“ holte Tunström aus der protestantischen Kühle heraus und versetzte es in ein südlich-magisches Dämmerlicht à la Visconti. Nicht die Bestrafungsrituale eines sadistischen Priesters bildeten den Grundakkord für seine Inszenierung, sondern – in einer Art Gegenentwurf zu Thomas Mann – die erotischen Sehnsuchtsträume und Lustorgien des untergehenden Bürgertums mit seinen surrealen Höhenflügen und Albträumen, alle gemeinsam getrieben von einer fast kindlichen Heimatliebe zum Theater.
Auf die melodramatische Publikumsverführung mit Ingmar Bergman folgte vor einem Jahr ein pechschwarzer „Hamlet“ ohne Netz, aber mit einigen doppelten Böden, die lautstark aufeinanderkrachten. Mit filmischen Anleihen bei David Lynch schuf Tunström einen dreckigen Zombie-Reigen, sein Hamlet ist kein zweifelnder Intellektueller, sondern ein Wikinger-Körperpaket im schmutzigen Unterhemd, als wäre ein blonder Marlon Brando dem Nordmeer entstiegen. Das tödliche Finale bildet ein Motocross-Splatter-Spektakel, bei dem Hamlet plötzlich von auferstandenen Untoten umzingelt wird, zum Revolver greift und sich selbst in die Schläfe schießt, ohne dabei zu sterben. Immer und immer wieder drückt er ab, bis er erkennt, dass er aus demselben unzerstörbar-zerstörerischen Fleisch geschaffen ist wie alle seine Gegenspieler: Die Frage nach Sein oder Nichtsein hatte sich genauso radikal selbst erledigt, wie sich das Publikum und die Kritik bereits bei der Premiere in zwei unversöhnliche Lager gespalten hatten – ein Vorgang, der in Schweden etwa so selten vorkommt wie ein Autorennen auf der Autobahn. Ein Realismus, der so weit auf die Spitze getrieben wird, dass er die Realität erschlägt, die er zeigt, steht quer zum schwedischen Kanon der Freundlichkeit und der gesellschaftlichen Transparenz. In Dresden wird Linus Tunström zum ersten Mal in Deutschland inszenieren: Goethes „Faust I“, der mit Höhenflügen, Tiefenschürfungen und großen Gefühlen nicht geizt und sich in seiner Formenvielfalt jedem Realismus a priori entzieht. Wie kein anderes deutsches Stück Literatur hat „Faust“ die Zerrissenheit als Lieblingskategorie im deutschen Befindlichkeitshaushalt etabliert. Auf der Bühne erscheint gewöhnlich unter dem Leitmotiv „Zwei Seelen wohnen, Ach! in meiner Brust“ das virtuose Duett zweier widersprüchlicher Männer, die gemeinsam ein junges Mädchen verführen und zerstören. Linus Tunström nimmt sich Goethes „Faust“ wohl etwas anders zur Brust. Ihm geht es um die Transparenz der Triebkräfte, um den Moment, wenn alle Sicherungen der Realität durchzubrennen drohen. Vielleicht haben aus seiner Sicht alle Beteiligten im „Faust“ einfach zu wenig auf das schwedische Credo gehört: „Protect me from what I want.“ Und damit kennt sich Linus Tunström wirklich aus.
Armin Kerber lebt in Zürich und ist seit einigen Jahren als freier Dramaturg und Autor vorwiegend in Schweden, Griechenland und der Schweiz engagiert. Zuvor war er u. a. Intendant am Theaterhaus Gessnerallee Zürich sowie Chefdramaturg auf Kampnagel Hamburg und am Stadttheater Bern. Seit 2010 ist er auch Redakteur beim Schweizer Kulturmagazin „DU“. Er unterrichtet an der Zürcher Hochschule der Künste und schreibt für „Theater heute“ und „Theater der Zeit“. Mit Linus Tunström arbeitet Armin Kerber seit acht Jahren regelmäßig zusammen.
Ingmar Bergmans nordisches Weihnachtsmärchen „Fanny und Alexander“ holte Tunström aus der protestantischen Kühle heraus und versetzte es in ein südlich-magisches Dämmerlicht à la Visconti. Nicht die Bestrafungsrituale eines sadistischen Priesters bildeten den Grundakkord für seine Inszenierung, sondern – in einer Art Gegenentwurf zu Thomas Mann – die erotischen Sehnsuchtsträume und Lustorgien des untergehenden Bürgertums mit seinen surrealen Höhenflügen und Albträumen, alle gemeinsam getrieben von einer fast kindlichen Heimatliebe zum Theater.
Auf die melodramatische Publikumsverführung mit Ingmar Bergman folgte vor einem Jahr ein pechschwarzer „Hamlet“ ohne Netz, aber mit einigen doppelten Böden, die lautstark aufeinanderkrachten. Mit filmischen Anleihen bei David Lynch schuf Tunström einen dreckigen Zombie-Reigen, sein Hamlet ist kein zweifelnder Intellektueller, sondern ein Wikinger-Körperpaket im schmutzigen Unterhemd, als wäre ein blonder Marlon Brando dem Nordmeer entstiegen. Das tödliche Finale bildet ein Motocross-Splatter-Spektakel, bei dem Hamlet plötzlich von auferstandenen Untoten umzingelt wird, zum Revolver greift und sich selbst in die Schläfe schießt, ohne dabei zu sterben. Immer und immer wieder drückt er ab, bis er erkennt, dass er aus demselben unzerstörbar-zerstörerischen Fleisch geschaffen ist wie alle seine Gegenspieler: Die Frage nach Sein oder Nichtsein hatte sich genauso radikal selbst erledigt, wie sich das Publikum und die Kritik bereits bei der Premiere in zwei unversöhnliche Lager gespalten hatten – ein Vorgang, der in Schweden etwa so selten vorkommt wie ein Autorennen auf der Autobahn. Ein Realismus, der so weit auf die Spitze getrieben wird, dass er die Realität erschlägt, die er zeigt, steht quer zum schwedischen Kanon der Freundlichkeit und der gesellschaftlichen Transparenz. In Dresden wird Linus Tunström zum ersten Mal in Deutschland inszenieren: Goethes „Faust I“, der mit Höhenflügen, Tiefenschürfungen und großen Gefühlen nicht geizt und sich in seiner Formenvielfalt jedem Realismus a priori entzieht. Wie kein anderes deutsches Stück Literatur hat „Faust“ die Zerrissenheit als Lieblingskategorie im deutschen Befindlichkeitshaushalt etabliert. Auf der Bühne erscheint gewöhnlich unter dem Leitmotiv „Zwei Seelen wohnen, Ach! in meiner Brust“ das virtuose Duett zweier widersprüchlicher Männer, die gemeinsam ein junges Mädchen verführen und zerstören. Linus Tunström nimmt sich Goethes „Faust“ wohl etwas anders zur Brust. Ihm geht es um die Transparenz der Triebkräfte, um den Moment, wenn alle Sicherungen der Realität durchzubrennen drohen. Vielleicht haben aus seiner Sicht alle Beteiligten im „Faust“ einfach zu wenig auf das schwedische Credo gehört: „Protect me from what I want.“ Und damit kennt sich Linus Tunström wirklich aus.
Armin Kerber lebt in Zürich und ist seit einigen Jahren als freier Dramaturg und Autor vorwiegend in Schweden, Griechenland und der Schweiz engagiert. Zuvor war er u. a. Intendant am Theaterhaus Gessnerallee Zürich sowie Chefdramaturg auf Kampnagel Hamburg und am Stadttheater Bern. Seit 2010 ist er auch Redakteur beim Schweizer Kulturmagazin „DU“. Er unterrichtet an der Zürcher Hochschule der Künste und schreibt für „Theater heute“ und „Theater der Zeit“. Mit Linus Tunström arbeitet Armin Kerber seit acht Jahren regelmäßig zusammen.