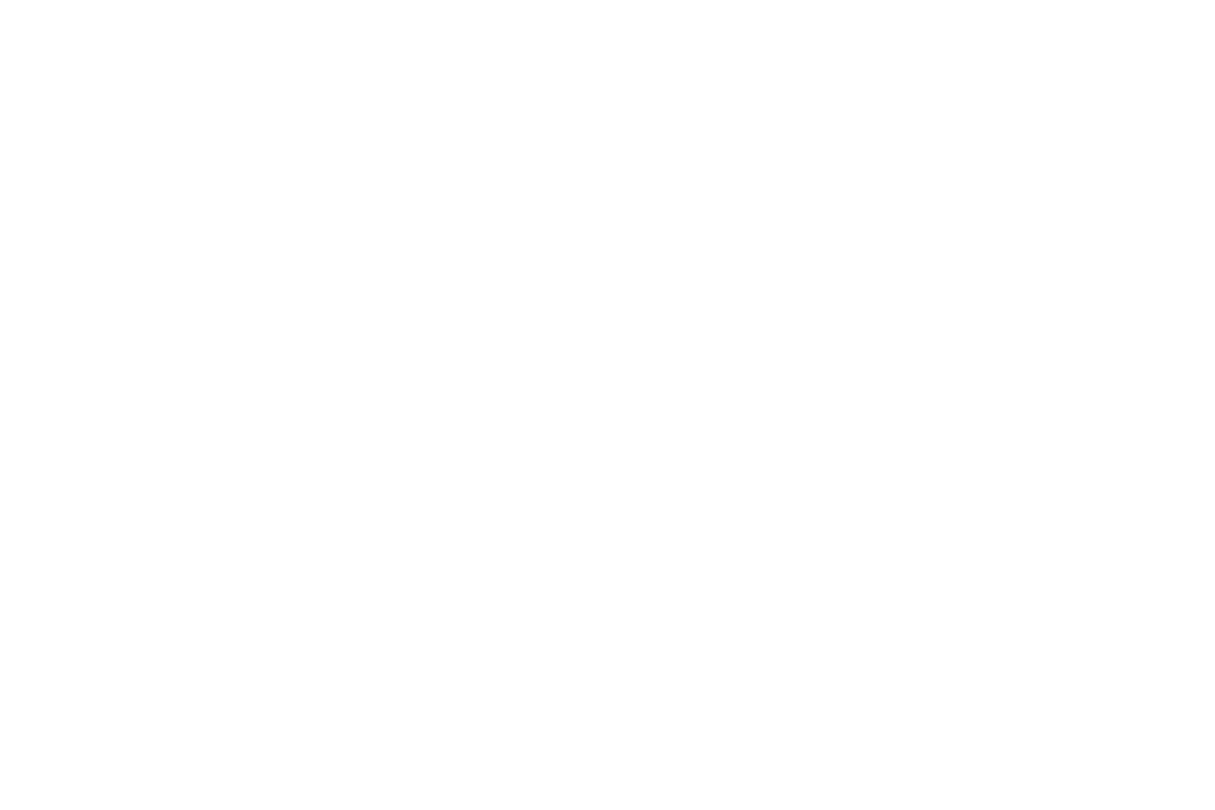Premiere 14.02.2015
› Schauspielhaus
Die Verschwörung des Fiesko zu Genua
ein Republikanisches Trauerspiel von Friedrich Schiller
Handlung
Es ist das Jahr 1547, und in Genua steht ein Machtwechsel an. Der greise Herzog Doria will seinen Neffen als Nachfolger einsetzen, Prinz Gianettino Doria, der jetzt schon die Stadt tyrannisiert. Dagegen regt sich Widerstand. Volk und Adel murren, und eine Handvoll Republikaner plant mit großer Geste den Umsturz. Und Fiesko? Des Prinzen gefährlichster Konkurrent und früher ein charismatischer Anführer ist jetzt ein Lebemann, der rauschende Feste feiert und mit noblen Damen tändelt. Das zumindest macht er alle glauben, während er im Verborgenen Verbündete sucht und Soldaten sammelt. Denn Fiesko ist ein Spieler und liebt das Spiel mit Masken. Außerdem ist er sich selber nicht im Klaren: Soll er wirklich mit den Umstürzlern für eine Republik kämpfen oder doch lieber die Alleinherrschaft ergreifen und Genuas nächster Herzog werden? Warum auf die Macht verzichten, wenn man sie haben kann? So spielt er einstweilen weiter, bis er am Ende selbst Opfer seiner eigenen Verschwörung wird.
„Fiesko“ ist das Drama eines Mannes, der über seine eigenen Fähigkeiten stolpert. Jung, beliebt, brillant und erfolgreich opfert er seine frühere politische Überzeugung dem Spiel mit der Macht. Nicht eine Idee treibt ihn an, sondern die Versuchung der Macht – inhaltsleer, selbstverliebt und trotzdem faszinierend. „Meine Räuber mögen untergehen! Mein Fiesko soll bleiben“, hat Schiller über sein zweites Stück gesagt, in dem er sich erstmals eines historischen Stoffes annahm. In Dresden wird der Schauspiel- und Opernregisseur Jan Philipp Gloger das Stück auf die Bühne bringen. Gloger war in den letzten Jahren Oberspielleiter in Mainz und hat u. a. an der Schaubühne in Berlin, in Karlsruhe, an der Semperoper Dresden und in Bayreuth („Der fliegende Holländer“) inszeniert.
„Fiesko“ ist das Drama eines Mannes, der über seine eigenen Fähigkeiten stolpert. Jung, beliebt, brillant und erfolgreich opfert er seine frühere politische Überzeugung dem Spiel mit der Macht. Nicht eine Idee treibt ihn an, sondern die Versuchung der Macht – inhaltsleer, selbstverliebt und trotzdem faszinierend. „Meine Räuber mögen untergehen! Mein Fiesko soll bleiben“, hat Schiller über sein zweites Stück gesagt, in dem er sich erstmals eines historischen Stoffes annahm. In Dresden wird der Schauspiel- und Opernregisseur Jan Philipp Gloger das Stück auf die Bühne bringen. Gloger war in den letzten Jahren Oberspielleiter in Mainz und hat u. a. an der Schaubühne in Berlin, in Karlsruhe, an der Semperoper Dresden und in Bayreuth („Der fliegende Holländer“) inszeniert.
Besetzung
Regie
Jan Philipp Gloger
Bühne
Marc Bausback
Kostüme
Eva Martin
Musik
Kostia Rapoport
Kampfchoreografie
Dramaturgie
Felicitas Zürcher
Licht
Fiesko, Graf von Lavagna
Christian Erdmann
Leonore, Fieskos Gemahlin
Ines Marie Westernströer
Verrina, Verschworener
Tom Quaas
Kalkagno, Verschworener
Sascha Göpel
Bourgognino, Verschworener
Kilian Land
Gianettino Doria, Kronprinz von Genua
Jan Maak
Julia, Dorias Schwester
Lomellino, Gianettinos Vertrauter
Tobias Krüger
Muley Hassan, Mohr von Tunis
Thomas Braungardt
Video
Spiel mit der Macht
Fieskos Spiel mit der Macht
Was ist los mit Fiesko? Seine Freunde erkennen ihn nicht mehr, seine früheren Überzeugungen hat er scheinbar aufgegeben: „Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Gichter bekommen hättest“, sagt der alte Republikaner Verrina zu ihm, und auch seine Frau Leonore beklagt die Veränderung seines Wesens. Ist das alles nur Schein, hinter dem Fiesko seine Pläne verbirgt? Täuscht er so vollkommen, oder hat er sich wirklich verändert? Ist er noch Politiker, oder ist er „ganz Epikuräer worden“? Fiesko ist vor allem Spieler, und es ist das Wesen des Spiels, gleichzeitig ernst und unernst, gleichzeitig wahr und unwahr zu sein. Seine Gegen-Spieler müssten das eigentlich wissen, denn auch sie beherrschen das Intrigen- und Machtspiel. In diesem Stück verfolgen alle Figuren ihre Ziele indirekt, mit Strategien und Intrigen: Die eine versucht, die Rivalin zu vergiften, der zweite will einen Aufstand anzetteln, um bei seiner Geliebten zu landen, der dritte benutzt ein Gemälde als Psycho-Test, der vierte knüpft geheime militärische Bündnisse, die fünfte versucht es mit emotionaler Erpressung ... alle sind Strategen, Intriganten und Spieler – aber niemand ist so kühn und geschickt wie Fiesko.
In dieser (höfischen) Welt ist Schein und Wirkung alles; der Auftritt muss stimmen, die Performance gut sein, dann hat man Erfolg. Das Moment des Spiels, der Darstellung ist dem Stück denn auch eingeschrieben: Die Show, die der Mohr vor Fiesko abzieht, ist gleichzeitig ein Einstellungsgespräch, Leonores Ankündigung ihrer Abreise wird als „Auftritt“ kommentiert und Verrinas Appell an Fieskos Vergangenheit mit Kriterien des Theaters bewertet. Fiesko selber wiederum ist ein Meister des perfekten Auftritts: Er stellt sich mit blutendem Arm auf den Marktplatz wie der Erlöser selber und inszeniert zur Ehrenrettung seiner Frau eine erotische Komödie vor Publikum. Es ist ein Spiel mit Effekten, und die Wirkung ist der Erfolg, denn Erfolg beim Publikum bedeutet in diesem Fall Macht. „Nichts fehlt, als die Larve herabzureißen und Genuas Patrioten den Fiesko zu zeigen“, nimmt sich er vor, als die gesamte politische Intrige vorbereitet ist. Aber was wird hinter der Larve zum Vorschein kommen?
Schiller selbst konnte sich nicht entscheiden: Sollte er dem moralischen Impetus folgen und Fiesko als guten Republikaner zeigen, der auf Purpur, Macht und Herzogwürde verzichtet? Oder sollte er ihn zu seinem Machtwillen stehen und die Alleinherrschaft ergreifen lassen? Er hat das gesamte Stück fertig gestellt – und immer noch über den Schluss gebrütet, denn der Zwiespalt, den Fiesko in seinem Monolog in der Mitte des Stückes empfindet, ist nicht zu lösen, nur zu entscheiden: „Ein Diadem erkämpfen ist groß. Es wegwerfen ist göttlich. Geh unter, Tyrann! Sei frei, Genua, und ich dein glücklichster Bürger!“ sagt er im einen Moment, um kurz darauf festzustellen: „Diese majestätische Stadt. Mein! – Ein Augenblick Fürst hat das Mark des ganzen Daseins verschlungen. – Ich bin entschlossen!“ Schiller hat beides ausprobiert: In der ersten, der sogenannten Buchversion wird Fiesko nach Gianettinos Tod im herzoglichen Purpurmantel von Verrina ins Meer gestoßen und ertrinkt. In der zweiten, der Bühnenfassung, die Schiller kurz darauf für das Theater Mannheim erstellt hat, zerbricht Fiesko nach getaner Revolution den Herzogstab und endet mit den Worten: „Steht auf, Genueser! den Monarchen hab ich euch geschenkt – umarmt euern glücklichsten Bürger.“
In dieser (höfischen) Welt ist Schein und Wirkung alles; der Auftritt muss stimmen, die Performance gut sein, dann hat man Erfolg. Das Moment des Spiels, der Darstellung ist dem Stück denn auch eingeschrieben: Die Show, die der Mohr vor Fiesko abzieht, ist gleichzeitig ein Einstellungsgespräch, Leonores Ankündigung ihrer Abreise wird als „Auftritt“ kommentiert und Verrinas Appell an Fieskos Vergangenheit mit Kriterien des Theaters bewertet. Fiesko selber wiederum ist ein Meister des perfekten Auftritts: Er stellt sich mit blutendem Arm auf den Marktplatz wie der Erlöser selber und inszeniert zur Ehrenrettung seiner Frau eine erotische Komödie vor Publikum. Es ist ein Spiel mit Effekten, und die Wirkung ist der Erfolg, denn Erfolg beim Publikum bedeutet in diesem Fall Macht. „Nichts fehlt, als die Larve herabzureißen und Genuas Patrioten den Fiesko zu zeigen“, nimmt sich er vor, als die gesamte politische Intrige vorbereitet ist. Aber was wird hinter der Larve zum Vorschein kommen?
Schiller selbst konnte sich nicht entscheiden: Sollte er dem moralischen Impetus folgen und Fiesko als guten Republikaner zeigen, der auf Purpur, Macht und Herzogwürde verzichtet? Oder sollte er ihn zu seinem Machtwillen stehen und die Alleinherrschaft ergreifen lassen? Er hat das gesamte Stück fertig gestellt – und immer noch über den Schluss gebrütet, denn der Zwiespalt, den Fiesko in seinem Monolog in der Mitte des Stückes empfindet, ist nicht zu lösen, nur zu entscheiden: „Ein Diadem erkämpfen ist groß. Es wegwerfen ist göttlich. Geh unter, Tyrann! Sei frei, Genua, und ich dein glücklichster Bürger!“ sagt er im einen Moment, um kurz darauf festzustellen: „Diese majestätische Stadt. Mein! – Ein Augenblick Fürst hat das Mark des ganzen Daseins verschlungen. – Ich bin entschlossen!“ Schiller hat beides ausprobiert: In der ersten, der sogenannten Buchversion wird Fiesko nach Gianettinos Tod im herzoglichen Purpurmantel von Verrina ins Meer gestoßen und ertrinkt. In der zweiten, der Bühnenfassung, die Schiller kurz darauf für das Theater Mannheim erstellt hat, zerbricht Fiesko nach getaner Revolution den Herzogstab und endet mit den Worten: „Steht auf, Genueser! den Monarchen hab ich euch geschenkt – umarmt euern glücklichsten Bürger.“
Und das Volk?
Im „Fiesko“ wird die Macht zwischen den Eliten der Gesellschaft verhandelt. Es ist die herrschende Schicht, die sich um sich selber dreht und sich zwischen Eitelkeit und Dekadenz um Politik kümmert. Die Welt bleibt draußen, es herrscht „geschlossene Gesellschaft“. Das Volk auf der Straße, von dem berichtet wird, entrüstet sich über Gianettinos Symbole von Macht und Herrschaft, es leidet unter Willkür und Machtmissbrauch. Doch es hat weder konkrete Forderungen noch Handlungsspielräume. Was der Mohr berichtet, beschränkt sich auf diffuse Empörung: Auf den Straßen Genuas herrscht zwar Unmut, aber noch ist es eine Revolte ohne Kopf. Die politische Elite ist handlungsunfähig, Verrina und seinen Mitstreitern fehlt Durchsetzungswillen und letztlich auch der Wille zur Tat. Gianettino wird über kurz oder lang den Aufstand niederschlagen, seine Macht mit Hilfe von Kaiser Karl und Soldaten aus Böhmen und Mailand militärisch verteidigen. Und Fiesko, zu dem das Volk sich hingezogen fühlt wie zu einem neuen Führer, benutzt das Volk für seine Pläne: Eine „dumpfige Schwüle“ liegt über der Stadt, „Mißmut hängt wie ein schweres Wetter über der Republik“, und Fiesko macht sich diese Stimmung zunutze: „Ich muss diesen Wind benutzen! Ich muss diesen Hass verstärken!“ Sogar die fremdenfeindlichen Ressentiments im Volk helfen ihm dabei: „Man steckt die Köpfe zusammen, rottiert sich zuhauf, ruft: Hum! spukt ein Fremder vorbei“, berichtet der Mohr Hassan, und Fiesko schreckt nicht davor zurück, ihn, den Fremden, vorzuführen als denjenigen, der ihn zu ermorden versuchte. Das Volk wird manipuliert, um politische, persönliche Ziele zu erreichen, es wird sogar benutzt, um eine Revolution zu machen. Aber weder Hassan noch das Volk werden Teil haben an dem, wofür sie gekämpft haben.
Im Monolog über das Reich der Tiere, den Fiesko im Stück vor zwölf empörten Handwerkern hält, führt er vor, dass das Volk nicht gemacht ist für Demokratie, die geeignete Staatsform auch nicht der Ausschuss ist, sondern die Monarchie: „Und Genua solls nachmachen, und Genua hat seinen Mann schon“, ist die prompte Antwort. Verführung der Massen – auch dieses Mittel der Macht beherrscht der Spieler und Stratege Fiesko, und gleichzeitig hat er mit seiner Staatsform-Diagnose wahrscheinlich nicht so unrecht.
Fiesko spielt brillant, es ist ein Spiel, das ihm sehr viel Spaß macht. Aber das Spiel mit der Macht, mit der Menge, mit seinen Rivalen und Konkurrenten ist so verführerisch, dass sich Fiesko selber damit verführt. Als Gastgeber von rauschenden Festen und politischer Strippenzieher in einem spielt Fiesko auf jeder Ebene: Er spielt den Liebhaber und den Politiker, den Verführer und den Anführer, den Revolutionär und den Herzog. Besonders in dieser Rolle gefällt sich Fiesko so gut, dass er nicht mehr auf sie verzichten will, dass er den Ausstieg aus seinem Spiel nicht mehr findet.
Felicitas Zürcher
Im „Fiesko“ wird die Macht zwischen den Eliten der Gesellschaft verhandelt. Es ist die herrschende Schicht, die sich um sich selber dreht und sich zwischen Eitelkeit und Dekadenz um Politik kümmert. Die Welt bleibt draußen, es herrscht „geschlossene Gesellschaft“. Das Volk auf der Straße, von dem berichtet wird, entrüstet sich über Gianettinos Symbole von Macht und Herrschaft, es leidet unter Willkür und Machtmissbrauch. Doch es hat weder konkrete Forderungen noch Handlungsspielräume. Was der Mohr berichtet, beschränkt sich auf diffuse Empörung: Auf den Straßen Genuas herrscht zwar Unmut, aber noch ist es eine Revolte ohne Kopf. Die politische Elite ist handlungsunfähig, Verrina und seinen Mitstreitern fehlt Durchsetzungswillen und letztlich auch der Wille zur Tat. Gianettino wird über kurz oder lang den Aufstand niederschlagen, seine Macht mit Hilfe von Kaiser Karl und Soldaten aus Böhmen und Mailand militärisch verteidigen. Und Fiesko, zu dem das Volk sich hingezogen fühlt wie zu einem neuen Führer, benutzt das Volk für seine Pläne: Eine „dumpfige Schwüle“ liegt über der Stadt, „Mißmut hängt wie ein schweres Wetter über der Republik“, und Fiesko macht sich diese Stimmung zunutze: „Ich muss diesen Wind benutzen! Ich muss diesen Hass verstärken!“ Sogar die fremdenfeindlichen Ressentiments im Volk helfen ihm dabei: „Man steckt die Köpfe zusammen, rottiert sich zuhauf, ruft: Hum! spukt ein Fremder vorbei“, berichtet der Mohr Hassan, und Fiesko schreckt nicht davor zurück, ihn, den Fremden, vorzuführen als denjenigen, der ihn zu ermorden versuchte. Das Volk wird manipuliert, um politische, persönliche Ziele zu erreichen, es wird sogar benutzt, um eine Revolution zu machen. Aber weder Hassan noch das Volk werden Teil haben an dem, wofür sie gekämpft haben.
Im Monolog über das Reich der Tiere, den Fiesko im Stück vor zwölf empörten Handwerkern hält, führt er vor, dass das Volk nicht gemacht ist für Demokratie, die geeignete Staatsform auch nicht der Ausschuss ist, sondern die Monarchie: „Und Genua solls nachmachen, und Genua hat seinen Mann schon“, ist die prompte Antwort. Verführung der Massen – auch dieses Mittel der Macht beherrscht der Spieler und Stratege Fiesko, und gleichzeitig hat er mit seiner Staatsform-Diagnose wahrscheinlich nicht so unrecht.
Fiesko spielt brillant, es ist ein Spiel, das ihm sehr viel Spaß macht. Aber das Spiel mit der Macht, mit der Menge, mit seinen Rivalen und Konkurrenten ist so verführerisch, dass sich Fiesko selber damit verführt. Als Gastgeber von rauschenden Festen und politischer Strippenzieher in einem spielt Fiesko auf jeder Ebene: Er spielt den Liebhaber und den Politiker, den Verführer und den Anführer, den Revolutionär und den Herzog. Besonders in dieser Rolle gefällt sich Fiesko so gut, dass er nicht mehr auf sie verzichten will, dass er den Ausstieg aus seinem Spiel nicht mehr findet.
Felicitas Zürcher
Der junge Journalist Simon Strauß lässt sich von Schiller verstören, denkt über die Revolution nach und wirft eine Kaffeetasse gegen die Wand
Er sitzt und hört zu und zählt die vielen „sozusagen“, die Füllsel, die neben ihm der gemütlich klagende Freund in seine Rede streut. Der Mut zum Wagnis sei ihnen längst abhandengekommen. Der Wohlstand habe alle schläfrig gemacht. Eigener Vorteil und Zukunftsangst stünden im Zentrum, schwach der Blick fürs Ganze, das Allgemeine interessiere nicht mehr. Sport und Ernährung, beinah fromme Güter, fast schon Religionsersatz. Sozusagen. Kein Kampf sei mehr zu führen, keine Väter zu morden. Die Ideologien hätten längst alle Trümpfe ausgespielt. Was dagegen lebe, seien Facebook und das Bioobst. Sozusagen. Ein Achselzucken, ein Blick auf den schimmernden Schirm – vor der Tür steht ein Car to go, und zu Hause wartet die Freundin.
„Tatort“ und Yogitee – wer braucht da noch Revolutionen? Auf ein nächstes Mal. Von sich selber satt schlendert die Gegenwartsanalyse durch den Feierabend. Aber im „Fiesko“ steht: „Wer will sich zum Pharao setzen und die Zeit mit Spielen betrügen? Wir sind gewohnt, sie mit Taten zu bezahlen.“
Er sitzt im Café und empfängt seine Mitteilungen. „Keine Zeit“, schreibt er hastig zurück. „Viel zu tun.“ Draußen eilen die Lebensziele vorbei. Er ahnt: Sein Denken und Fühlen bewegt sich auf längst schon ausgetretenen Pfaden. Ein Pionier zu sein, dazu fehlt ihm die Kraft, das starke Motiv. Da gibt es doch klügere Menschen, erfahrenere als ihn. Aber hat er selbst nicht hin und wieder besser geredet als andere, tiefer gedacht und mehr gesehen? Ihm, gerade ihm müsste doch etwas Eigenes, Schneisenschlagendes gelingen. Ein Gedanke, eine Rede, ein Aufruf. Er müsste nur die Angst vor dem Grinsen der Zyniker überwinden, sich nicht scheuen, pathetisch zu klingen, naiv sogar. Es gäbe doch so viele Gründe, unduldsam zu sein, scharfe Sätze zu sagen: gegen den Egoismus und für das Gemeinsame, für Moral, Freiheit und Recht – vor allem gegen die Kälte, fürs Feuer im Blut. Maximen könnten auf den Tisch geschleudert, Banner entrollt werden, risk, risk anything – aber der Fiesko fragt listig: „Die Worte, die du mir hinterbracht hast, sind gut; lassen sich Taten draus schließen?“ Schon verliert er den Mut, hastig kehrt er zurück zum Gewohnten. Beim Aufstehen zieht er den Kopf ein, duckt sich weg vor der Verachtung, denn der Fiesko ruft hämisch: „Machst Republiken mit einem Pinsel frei – kannst eigene Ketten nicht brechen? Geh! Deine Arbeit ist Gaukelwerk – der Schein weiche der Tat.“
Er schleicht nach Hause. Gekrümmt und zerknirscht. Wieder ein Tag ohne Tat. Und wieder verlacht vom Fiesko. Am Abend bleibt er allein. Er liest weiter und träumt von Verschwörung. Träumt von Geheimbund und Heldentat. Die Angst packt ihn und die Sehnsucht, am Ende, wenn Schiller das Publikum mahnt, „dass unsere besten Keime zu Großem und Gutem unter dem Druck des bürgerlichen Lebens begraben sind“. Auf der Straße sieht er die Freunde laufen, hört ihr Gequengel und trauriges Allerlei. Zu Begrüßung und Abschied tauschen sie flüchtig Wangenküsse, als sei nichts weiter – Mitte zwanzig und schon alles vorbei. Und der Mohr warnt, „dass Genuas großer Mann Genuas großen Fall verschlafe“. Er nimmt es sich vor, morgen also. Das Spiel ohne Maske. Anstiftung zum Krieg oder zur Liebe.
„Tatort“ und Yogitee – wer braucht da noch Revolutionen? Auf ein nächstes Mal. Von sich selber satt schlendert die Gegenwartsanalyse durch den Feierabend. Aber im „Fiesko“ steht: „Wer will sich zum Pharao setzen und die Zeit mit Spielen betrügen? Wir sind gewohnt, sie mit Taten zu bezahlen.“
Er sitzt im Café und empfängt seine Mitteilungen. „Keine Zeit“, schreibt er hastig zurück. „Viel zu tun.“ Draußen eilen die Lebensziele vorbei. Er ahnt: Sein Denken und Fühlen bewegt sich auf längst schon ausgetretenen Pfaden. Ein Pionier zu sein, dazu fehlt ihm die Kraft, das starke Motiv. Da gibt es doch klügere Menschen, erfahrenere als ihn. Aber hat er selbst nicht hin und wieder besser geredet als andere, tiefer gedacht und mehr gesehen? Ihm, gerade ihm müsste doch etwas Eigenes, Schneisenschlagendes gelingen. Ein Gedanke, eine Rede, ein Aufruf. Er müsste nur die Angst vor dem Grinsen der Zyniker überwinden, sich nicht scheuen, pathetisch zu klingen, naiv sogar. Es gäbe doch so viele Gründe, unduldsam zu sein, scharfe Sätze zu sagen: gegen den Egoismus und für das Gemeinsame, für Moral, Freiheit und Recht – vor allem gegen die Kälte, fürs Feuer im Blut. Maximen könnten auf den Tisch geschleudert, Banner entrollt werden, risk, risk anything – aber der Fiesko fragt listig: „Die Worte, die du mir hinterbracht hast, sind gut; lassen sich Taten draus schließen?“ Schon verliert er den Mut, hastig kehrt er zurück zum Gewohnten. Beim Aufstehen zieht er den Kopf ein, duckt sich weg vor der Verachtung, denn der Fiesko ruft hämisch: „Machst Republiken mit einem Pinsel frei – kannst eigene Ketten nicht brechen? Geh! Deine Arbeit ist Gaukelwerk – der Schein weiche der Tat.“
Er schleicht nach Hause. Gekrümmt und zerknirscht. Wieder ein Tag ohne Tat. Und wieder verlacht vom Fiesko. Am Abend bleibt er allein. Er liest weiter und träumt von Verschwörung. Träumt von Geheimbund und Heldentat. Die Angst packt ihn und die Sehnsucht, am Ende, wenn Schiller das Publikum mahnt, „dass unsere besten Keime zu Großem und Gutem unter dem Druck des bürgerlichen Lebens begraben sind“. Auf der Straße sieht er die Freunde laufen, hört ihr Gequengel und trauriges Allerlei. Zu Begrüßung und Abschied tauschen sie flüchtig Wangenküsse, als sei nichts weiter – Mitte zwanzig und schon alles vorbei. Und der Mohr warnt, „dass Genuas großer Mann Genuas großen Fall verschlafe“. Er nimmt es sich vor, morgen also. Das Spiel ohne Maske. Anstiftung zum Krieg oder zur Liebe.
Und er geht auf die Feiern und Plätze, in die Parlamente, Seminare und Redaktionen der Stadt. Brüllt laut ins Gesicht der Arglosen und Überraschten: „Ein Diadem erkämpfen ist groß. Es wegwerfen ist göttlich.“ Sogar eine Kaffeetasse schmeißt er gegen die Wand. Aber zurück blicken nur glasig-blasse Augen. Müde lächeln sie sein Pathos zu Boden. „Seitdem das Pulver erfunden ist, kampieren die Engel nicht mehr“, höhnt Schillers ausgetrockneter Hofmann und zuckt mit den Achseln. „Leben heißt träumen. Weise sein heißt angenehm träumen.“
Aber er denkt jetzt groß und hitzig. Er bäumt sich auf: gegen die lustlose Ironie, den kranken Zynismus. So geht es nicht weiter. Ihr selbst zerbrecht doch beim ersten Windstoß.
Los jetzt. Was ist euer innerster Antrieb? Kennt ihr den Zweifel, die Anfechtung, die Gefahr? Was bedeuten euch Politik und die Pflicht, ein Bürger zu sein? Schätzt ihr den Wert eures Gemeinwesens? „Scheitert der Euro, scheitert Europa.“ Kann das ein Bannerspruch sein? Ließen sich damit Tyrannen stürzen, Unfreiheit und Terror vertreiben? Seid ihr im Geringsten gewappnet für einen Kampf? Denn was, wenn morgen einer käme und riefe laut und überzeugend: „Republikaner Fiesko? Herzog Fiesko?“ Würdet ihr ihm antworten können? Ihr, die ihr den Unterschied nicht kennt, nie gefühlt habt, was Entscheidung heißt. Kann nicht nur der, der selbst einmal gefährlich gedacht, selbst einmal am Tisch des Feindes gesessen hat, darauf eine entschiedene Antwort geben? Kann nicht nur der den Herzog von der Brücke stoßen, wenn er prahlt, „dass ich der größte Mann bin in ganz Genua und die kleinen Seelen sollen sich nicht unter die große versammeln“?
Längst sind ihm da schon die Zuhörer abhandengekommen. Die ewig Unberührbaren! Sie wissen alles und fühlen nichts. Zurück bleibt der Kaffeefleck, ein Zornesmal an der Wand. Und er träumt weiter. Sehnt sich. „Wer keinen Menschen zu fürchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen?“ Er müsste doch einmal so einen treffen, einen, der keine Angst hat vor blinder Leidenschaft. Der würde sein Freund werden. Und dann sein Feind? Gegen ihn könnte er seine Ideale verteidigen. Mit ihm könnte er träumen von der großen Veränderung. Allein wird es damit nichts werden. Jungsein für sich ist kein Programm. So läuft er abends – den „Fiesko“ unterm Arm – durch die Straßen und fragt einen jeden wie ganz nebenbei: Gibt es denn nichts zu tun? Nichts zu wagen? Und einer weist ihm den Weg zum Theater. Da gäbe es Antwort auf seine Fragen ...
Simon Strauß, geboren 1988, promoviert derzeit in Alter Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin und schreibt als freier Mitarbeiter für das Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.
Aber er denkt jetzt groß und hitzig. Er bäumt sich auf: gegen die lustlose Ironie, den kranken Zynismus. So geht es nicht weiter. Ihr selbst zerbrecht doch beim ersten Windstoß.
Los jetzt. Was ist euer innerster Antrieb? Kennt ihr den Zweifel, die Anfechtung, die Gefahr? Was bedeuten euch Politik und die Pflicht, ein Bürger zu sein? Schätzt ihr den Wert eures Gemeinwesens? „Scheitert der Euro, scheitert Europa.“ Kann das ein Bannerspruch sein? Ließen sich damit Tyrannen stürzen, Unfreiheit und Terror vertreiben? Seid ihr im Geringsten gewappnet für einen Kampf? Denn was, wenn morgen einer käme und riefe laut und überzeugend: „Republikaner Fiesko? Herzog Fiesko?“ Würdet ihr ihm antworten können? Ihr, die ihr den Unterschied nicht kennt, nie gefühlt habt, was Entscheidung heißt. Kann nicht nur der, der selbst einmal gefährlich gedacht, selbst einmal am Tisch des Feindes gesessen hat, darauf eine entschiedene Antwort geben? Kann nicht nur der den Herzog von der Brücke stoßen, wenn er prahlt, „dass ich der größte Mann bin in ganz Genua und die kleinen Seelen sollen sich nicht unter die große versammeln“?
Längst sind ihm da schon die Zuhörer abhandengekommen. Die ewig Unberührbaren! Sie wissen alles und fühlen nichts. Zurück bleibt der Kaffeefleck, ein Zornesmal an der Wand. Und er träumt weiter. Sehnt sich. „Wer keinen Menschen zu fürchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen?“ Er müsste doch einmal so einen treffen, einen, der keine Angst hat vor blinder Leidenschaft. Der würde sein Freund werden. Und dann sein Feind? Gegen ihn könnte er seine Ideale verteidigen. Mit ihm könnte er träumen von der großen Veränderung. Allein wird es damit nichts werden. Jungsein für sich ist kein Programm. So läuft er abends – den „Fiesko“ unterm Arm – durch die Straßen und fragt einen jeden wie ganz nebenbei: Gibt es denn nichts zu tun? Nichts zu wagen? Und einer weist ihm den Weg zum Theater. Da gäbe es Antwort auf seine Fragen ...
Simon Strauß, geboren 1988, promoviert derzeit in Alter Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin und schreibt als freier Mitarbeiter für das Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.