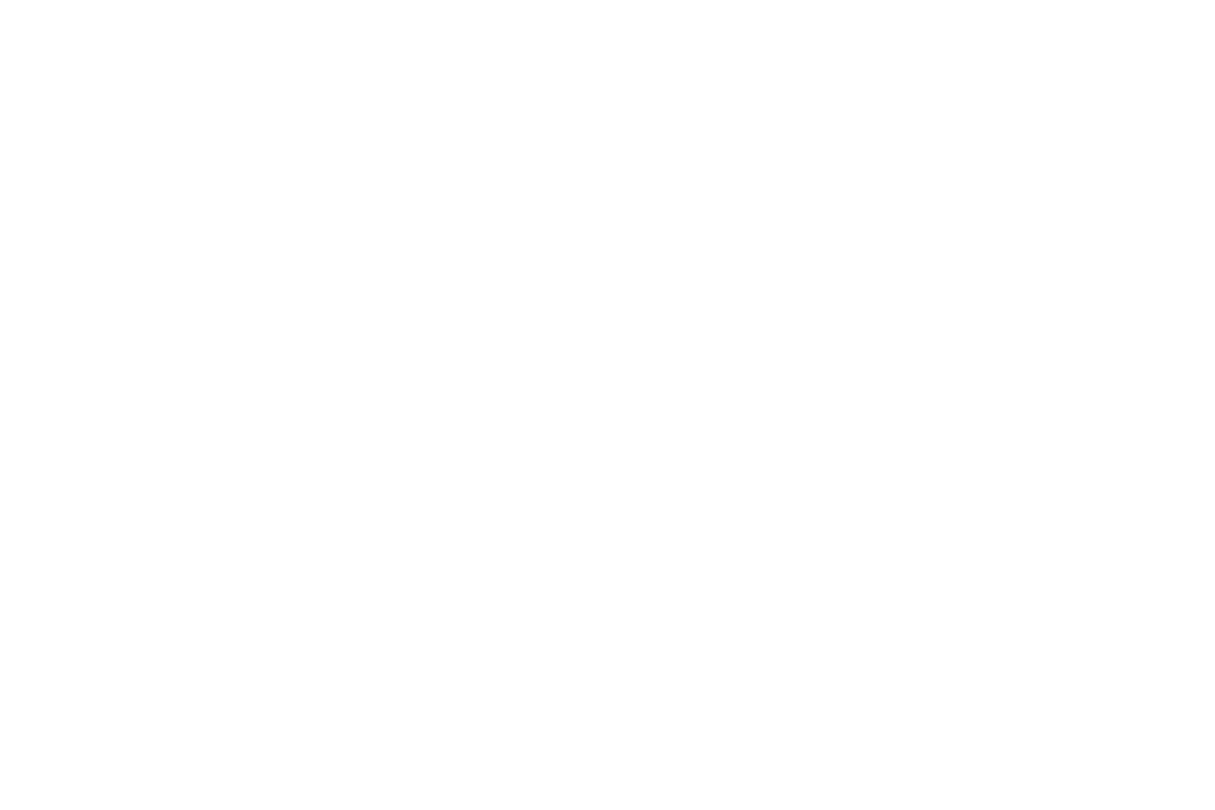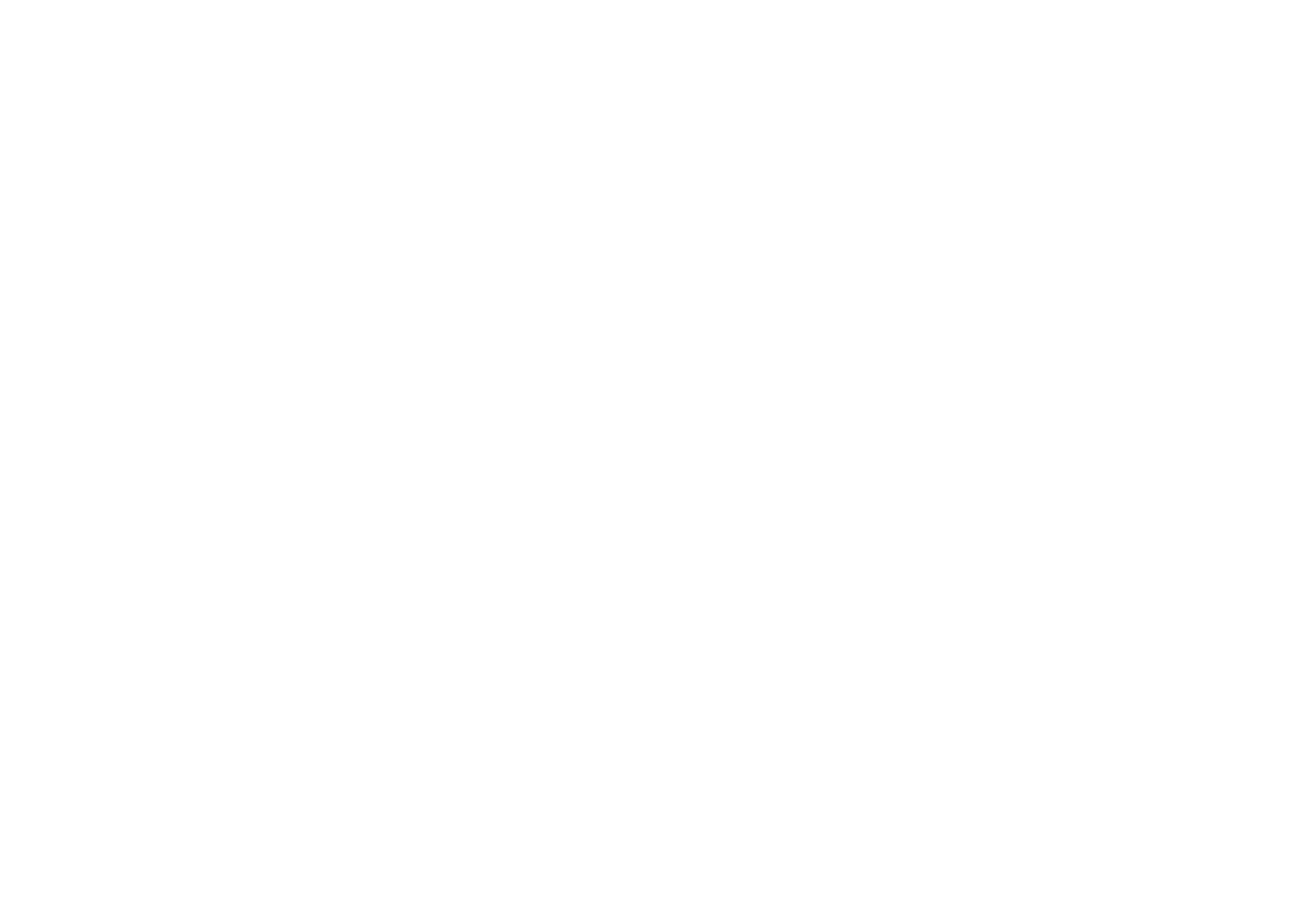Premiere 10.05.2013
› Schauspielhaus
Die Ratten
Berliner Tragikomödie von Gerhart Hauptmann
Handlung
Auf dem Dachboden einer verkommenen Mietskaserne hat Ex-Theaterdirektor Hassenreuter seinen Fundus eingelagert. Während er auf den nächsten Karriereschritt hofft, gibt Hassenreuter Schauspielunterricht und deklariert seinen Besitz zum Kostümverleih um. Seine Tochter Walburga nutzt den verwinkelten Speicher ihres Vaters, um dort ihren Geliebten Erich Spitta zu treffen, der einen Entschluss gefasst hat: Er will sein Studium der Theologie aufgeben, um Schauspieler zu werden. Unten im Haus lebt Frau John, die den Theaterfundus in Ordnung hält. Da ihr Mann die meiste Zeit außerhalb arbeitet, gelingt es Frau John, einen lang gehegten Plan in die Tat umzusetzen: Sie kauft einer jungen Mutter ihr Baby ab und gibt das Kind als ihr eigenes aus. Denn seit sie vor Jahren ihren leiblichen Sohn verloren hat, ist Frau John von dem Wunsch besessen, wieder Mutter zu werden. Als ihr das hochschwangere verzweifelte Dienstmädchen Pauline Piperkarcka begegnet, ergreift die John ihre Chance. Sie nimmt das Kind zu sich, und für eine kurze Weile scheint das Familienglück möglich. Doch als Pauline ihr Kind zurückfordert, reagiert Frau John panisch. Sie schickt ihren Bruder Bruno vor, um die junge Frau einzuschüchtern. Als man kurz darauf Paulines Leiche entdeckt, verstrickt sich Frau John in ein Gespinst aus Widersprüchen und Ausflüchten, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt.
Die Berliner Tragikomödie, die 1911 uraufgeführt wurde, ist bis heute eines der bekanntesten Dramen Gerhart Hauptmanns. Unter dem Dach des Mietshauses stellt der Autor nicht nur die klassische gegen die moderne Auffassung von Theater, sondern auch das bürgerliche und das proletarische Milieu wie zwei isoliert existierende Kosmen nebeneinander und beweist damit ein unfehlbares Gespür für die Zerbrechlichkeit gesellschaftlicher Zustände.
Die Berliner Tragikomödie, die 1911 uraufgeführt wurde, ist bis heute eines der bekanntesten Dramen Gerhart Hauptmanns. Unter dem Dach des Mietshauses stellt der Autor nicht nur die klassische gegen die moderne Auffassung von Theater, sondern auch das bürgerliche und das proletarische Milieu wie zwei isoliert existierende Kosmen nebeneinander und beweist damit ein unfehlbares Gespür für die Zerbrechlichkeit gesellschaftlicher Zustände.
Besetzung
Regie
Susanne Lietzow
Bühne
Aurel Lenfert
Kostüme
Marie-Luise Lichtenthal
Video
Petra Zöpnek
Musik
Gilbert Handler
Licht
Dramaturgie
Beret Evensen
Harro Hassenreuther, ehemaliger Theaterdirektor
Therese Hassenreuther, Harro Hassenreuthers Frau
Walburga, Harro Hassenreuthers Tochter
Laina Schwarz
Pastor Spitta
Hanns-Jörn Weber
Erich Spitta, Kandidat der Theologie, Pastor Spittas Sohn
Thomas Braungardt
Alice Rütterbusch, Schauspielerin
Cathleen Baumann
Käferstein, Schüler Hassenreuthers
Sascha Göpel
Dr. Kegel, Schüler Hassenreuters / Bruno Mechelke, Frau Johns Bruder
Jonas Friedrich Leonhardi
John, Maurerpolier
Frau John
Rosa Enskat
Pauline Piperkarcka, Dienstmädchen
Marie Smolka
Frau Sidonie Knobbe
Antje Trautmann
Frau Sidonie Knobbe alternierend
Cathleen Baumann
Selma, Frau Knobbes Tochter
Lea Ruckpaul
Quaquaro, Hausmeister
Jan Maak
Video
Der Sozialanthropologe Felix Ringel liest Hauptmanns „Die Ratten“ auf ihre Menschlichkeit
Hauptmanns Theaterdirektor ermahnt uns: „Möge das Schicksal jeden davor bewahren, sich eines Tages mittellos in die Subura Berlins geschleudert zu finden, um mit andern Verzweifelten, Brust an Brust, in unterirdischen Löchern und Röhren um das nackte Leben für sich und die Seinen zu ringen.“ Irgendwo in Berlin gibt es also Ratten. Irgendwo in Berlin wird man also zur Ratte. Vielleicht in Marzahn, vielleicht in Neukölln. „Was hier an Not, Hunger, Elend existiert und an lasterhaftem Lebenswandel geleistet wird, das ist auf keine Kuhhaut zu schreiben.“ In Dresden ist das anders. Da geht man ins Theater. Oder wo machen Armut und Unmoral geografisch und sozial Halt?
„Die Ratten“ versetzt uns in eine Zeit nach einer anderen deutschen Vereinigung, eine Zeit, die ähnlich geprägt ist von stetem Auf-, Ab- und Umschwung wie die unsere. Die industrielle Revolution war gerade im Deutschen Kaiserreich so richtig angekommen: Gründerzeit, Gründerboom, Gründerkrise. Die Landschaften sollten damals nicht blühen; eher sollten die Städte wachsen. Aber darin lag auch das Problem: Das Weltbild des 19. Jahrhunderts kam umso näher an seine moralischen Grenzen, je mehr diese Städte geografisch explodierten. Die zunehmend kapitalistische Moderne hatte nicht nur Wachstum und Fortschritt gebracht, sondern stellte auch mit aller Konsequenz die sogenannte Arbeiterfrage. Bei aller erhoffter Veränderung fielen – wie man heutzutage gerne euphemistisch sagt – nicht wenige durch die sozialen Maschen: das aus Polen eingewanderte Fräulein; die allein gelassene Frau des Berufspendlers; die vom sozialen Abstieg betroffene Großfamilie. Das Stück hinterlässt dann auch zwei tote Mütter und ein totes Kind. Ein weiteres starb schon vor Jahren im Kindbett; das Leben eines dritten Kindes ist im Stück gerade mal 123 Mark wert.
Heute werden keine Kinder mehr verkauft, wenigstens nicht in Deutschland, nicht einmal in Berlin. In Zeiten eines unerwarteten Aufschwungs mag man derlei soziale Schaudergeschichten eh nicht gerne hören. Man ist schließlich weder in Somalia – noch in Griechenland. Trotzdem ist die postindustrielle Revolution genauso unaufhaltsam im Gange wie ihre Vorgängerin. Zwar ist die Arbeiterfrage beantwortet (denn „den Arbeiter“ gibt es so anscheinend gar nicht mehr), doch schrumpfen Städte (nein, nicht Dresden!) ähnlich drastisch, wie sie damals expandierten, und in neuen Spannungsfeldern neoliberaler Wirtschaftspolitik geht unter den Augen der demokratisch-interessierten Bevölkerung die berühmte Schere zwischen Arm und Reich stetig weiter auseinander. Will der reiche globale Norden die Frage von Hunger und Armut nicht nur weiterhin auf den Süden der Erde projizieren, so muss er sein Augenmerk hierzulande vom Proletariat zum Prekariat lenken. Wer hätte das gedacht im steten „Höher, schneller, weiter“ entfesselter Marktwirtschaft? Und darum jetzt also die theatrale Rückbesinnung auf die sozial-moralischen Probleme von Verstädterung und Bevölkerungsexplosion Ende des 19. Jahrhunderts?
Im hauptmannschen Sinne ist Moral natürlich kein Hartz-IV-Problem. Ob man aber dem Direktor glauben will, dass „Tragik nich’ an Stände gebunden“ ist? Denn Tragik macht Moral zwingend – auf der Bühne und im sogenannten wahren Leben. Des Direktors zukünftiger Schwiegersohn hat sich dementsprechend „niemals eingebildet, dass das sogenannte Mittelalter eine überwundene Sache ist“. Auch der Maurerpolier John bemerkt: „Horchen Se ma, wie det knackt, wie Putz hinter de Tapete runterjeschoddert kommt! Allens is hier morsch! Allens faulet Holz! Allens unterminiert, von Unjeziefer, von Ratten und Mäuse zerfressen! Allens kann jeden Oojenblick bis in Keller durchbrechen.“ Tatsächlich, „Wohlanständigkeit“ ist nicht garantiert, doch das ist sie weder in den Mietskasernen oder Plattenbauten der Metropolen noch im goldenen Westen Straßburgs, wohin es den von der Tragik freudig versehrten Theaterdirektor samt Familie verschlägt. Trotzdem bleibt Tragik ungleich verteilt zwischen Menschen, denen es gut geht, und Menschen, die täglich um ihr soziales, kulturelles oder ökonomisches Überleben kämpfen müssen. Wie viele echt „tragische“ Situationen, in denen Menschen an Mord, Selbstmord (Pauline: „Ick spring im Landwehrkanal und versaufe!“) oder Kindesmord als Ausweg denken, kann eine Gesellschaft willentlich ertragen? Wie viel soziale Ungleichheit hält sie bei diesem neuerlichen Epochenbruch aus? Wie viel Unglück kann ein „reines Gewissen“ erleiden?
Der Fokus auf Mord und Totschlag ist dabei irreführend. Das Stück ist eher voller kleiner menschlicher Tiefpunkte und Tragödien: die schwere Kindheit, die unerwiderte Liebe, das kinderlose Ehepaar, die verstoßene Tochter und (wie so weitverbreitet im Osten der Republik) die Abwesenheit des Partners, weil dieser gezwungen ist, die Woche über anderswo Geld zu verdienen; dazu Verwahrlosung, Hunger, keine Bleibe über dem Kopf, kein Geld. Erst all das zusammen macht es möglich, dass ein Kind verkauft wird und ein anderes stirbt.
„Die Ratten“ versetzt uns in eine Zeit nach einer anderen deutschen Vereinigung, eine Zeit, die ähnlich geprägt ist von stetem Auf-, Ab- und Umschwung wie die unsere. Die industrielle Revolution war gerade im Deutschen Kaiserreich so richtig angekommen: Gründerzeit, Gründerboom, Gründerkrise. Die Landschaften sollten damals nicht blühen; eher sollten die Städte wachsen. Aber darin lag auch das Problem: Das Weltbild des 19. Jahrhunderts kam umso näher an seine moralischen Grenzen, je mehr diese Städte geografisch explodierten. Die zunehmend kapitalistische Moderne hatte nicht nur Wachstum und Fortschritt gebracht, sondern stellte auch mit aller Konsequenz die sogenannte Arbeiterfrage. Bei aller erhoffter Veränderung fielen – wie man heutzutage gerne euphemistisch sagt – nicht wenige durch die sozialen Maschen: das aus Polen eingewanderte Fräulein; die allein gelassene Frau des Berufspendlers; die vom sozialen Abstieg betroffene Großfamilie. Das Stück hinterlässt dann auch zwei tote Mütter und ein totes Kind. Ein weiteres starb schon vor Jahren im Kindbett; das Leben eines dritten Kindes ist im Stück gerade mal 123 Mark wert.
Heute werden keine Kinder mehr verkauft, wenigstens nicht in Deutschland, nicht einmal in Berlin. In Zeiten eines unerwarteten Aufschwungs mag man derlei soziale Schaudergeschichten eh nicht gerne hören. Man ist schließlich weder in Somalia – noch in Griechenland. Trotzdem ist die postindustrielle Revolution genauso unaufhaltsam im Gange wie ihre Vorgängerin. Zwar ist die Arbeiterfrage beantwortet (denn „den Arbeiter“ gibt es so anscheinend gar nicht mehr), doch schrumpfen Städte (nein, nicht Dresden!) ähnlich drastisch, wie sie damals expandierten, und in neuen Spannungsfeldern neoliberaler Wirtschaftspolitik geht unter den Augen der demokratisch-interessierten Bevölkerung die berühmte Schere zwischen Arm und Reich stetig weiter auseinander. Will der reiche globale Norden die Frage von Hunger und Armut nicht nur weiterhin auf den Süden der Erde projizieren, so muss er sein Augenmerk hierzulande vom Proletariat zum Prekariat lenken. Wer hätte das gedacht im steten „Höher, schneller, weiter“ entfesselter Marktwirtschaft? Und darum jetzt also die theatrale Rückbesinnung auf die sozial-moralischen Probleme von Verstädterung und Bevölkerungsexplosion Ende des 19. Jahrhunderts?
Im hauptmannschen Sinne ist Moral natürlich kein Hartz-IV-Problem. Ob man aber dem Direktor glauben will, dass „Tragik nich’ an Stände gebunden“ ist? Denn Tragik macht Moral zwingend – auf der Bühne und im sogenannten wahren Leben. Des Direktors zukünftiger Schwiegersohn hat sich dementsprechend „niemals eingebildet, dass das sogenannte Mittelalter eine überwundene Sache ist“. Auch der Maurerpolier John bemerkt: „Horchen Se ma, wie det knackt, wie Putz hinter de Tapete runterjeschoddert kommt! Allens is hier morsch! Allens faulet Holz! Allens unterminiert, von Unjeziefer, von Ratten und Mäuse zerfressen! Allens kann jeden Oojenblick bis in Keller durchbrechen.“ Tatsächlich, „Wohlanständigkeit“ ist nicht garantiert, doch das ist sie weder in den Mietskasernen oder Plattenbauten der Metropolen noch im goldenen Westen Straßburgs, wohin es den von der Tragik freudig versehrten Theaterdirektor samt Familie verschlägt. Trotzdem bleibt Tragik ungleich verteilt zwischen Menschen, denen es gut geht, und Menschen, die täglich um ihr soziales, kulturelles oder ökonomisches Überleben kämpfen müssen. Wie viele echt „tragische“ Situationen, in denen Menschen an Mord, Selbstmord (Pauline: „Ick spring im Landwehrkanal und versaufe!“) oder Kindesmord als Ausweg denken, kann eine Gesellschaft willentlich ertragen? Wie viel soziale Ungleichheit hält sie bei diesem neuerlichen Epochenbruch aus? Wie viel Unglück kann ein „reines Gewissen“ erleiden?
Der Fokus auf Mord und Totschlag ist dabei irreführend. Das Stück ist eher voller kleiner menschlicher Tiefpunkte und Tragödien: die schwere Kindheit, die unerwiderte Liebe, das kinderlose Ehepaar, die verstoßene Tochter und (wie so weitverbreitet im Osten der Republik) die Abwesenheit des Partners, weil dieser gezwungen ist, die Woche über anderswo Geld zu verdienen; dazu Verwahrlosung, Hunger, keine Bleibe über dem Kopf, kein Geld. Erst all das zusammen macht es möglich, dass ein Kind verkauft wird und ein anderes stirbt.
Hier geht es also nicht um Brechts „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. In den „Ratten“ geht es um gefühlte Ausweglosigkeit und soziale Entfremdung (Pauline: „Wat du ick denn, dass man mir so verachtet und von die Leute ausstoßen muss?“), um gebrochene Herzen, unerfüllte Hoffnungen und enttäuschte Erwartungen. Menschliche Konstanten. Systembrüche und unterschwellige Revolutionen erzeugen derlei Kollateralschäden in größeren Maßen. Man kann sie hinnehmen oder bekämpfen. Schuld ist dabei nicht „an Stände gebunden“, Tragik jedoch ist es.
Wo sind sie heute also, die Ratten, die in des Direktors „Garten der deutschen Kunst die Wurzeln des Baumes des Idealismus“ abfressen? In Sarrazins vermeintlicher Migrantenwelt? In der angeblich braunen ostdeutschen Provinz? Im billig sanierten sozialen Wohnungsbau? In Mainhattans Hochhäusern? In Kraftklubs neuem Berlin der Möchtegern-Metropoliten? Oder im wulffschen kleinbürgerlichen Eigenheim? Wie steht es mit der Moral in unseren Tagen?
Hauptmann hat das Problem der Moral den repräsentativen Konventionen seiner Zeit entsprechend im Kontext der überfüllten Arbeiterbezirke der Großstädte präsentiert. Das war natürlich damals schon nur begrenzt gerechtfertigt. Anthropologisch sind eher die oft unerwartet ausdauernden Formen menschlicher Kreativität, die überraschend vielfältigen sozialen Ressourcen und die facettenreiche, kontinuierliche Aushandlung von komplexer Realität interessant. Allerdings bleibt trotz Hauptmanns engagierter Sozialkritik der Mensch, vor allem der prekäre (anteilig rechtmäßig, wie gesagt), Opfer seiner Verhältnisse. Nur am Rande streift der Autor Formen gelebter Solidarität: gemeinsame Kinderbetreuung, geteilte Mahlzeiten, Arbeiterstolz und Arbeitertugenden. Gerade das damals rote Sachsen kann als einst am stärksten industrialisiertes Land Deutschlands und mit seiner jüngeren Vergangenheit als Teil eines anfänglich stolzen Arbeiter- und Bauernstaates ein Lied davon singen, dass sich entgegen Schönbohms Äußerungen der späten 1990er-Jahre (Sie erinnern sich?) Proletariat und Moral nicht ausschließen müssen.
Gilt das auch für das heutige Prekariat? Für die junge Mutter mit zwei oder drei Jobs oder eben überhaupt keinem, die in aller Öffentlichkeit lautstark ihre rotzfrechen Gören anschreit; für den Langzeitarbeitslosen, der schon mit einem Bein auf der Straße steht und sich nicht mehr dazugehörig fühlt; oder für den Alki vom nächstbesten Stehimbiss, dessen Selbstwertgefühl nur noch in Relation zum Alkoholspiegel steigt? Diese Menschen von vornherein moralisch zu degradieren steht keinem zu. Auf (moralischer) Augenhöhe nur kann man den vermeintlichen Ratten begegnen; nicht mit paternalistisch-entmündigendem oder wohlwollend-ängstlichem Blick, sondern mit Verständnis, Selbstkritik und der Einsicht in die weitaus komplexeren Zusammenhänge, in denen soziales Elend entsteht und wirkt. Heutige moralische Diskurse stellen deswegen auch ganz andere Fragen: nach erkauften oder erschlichenen Doktortiteln, verlorener Finanzmoral und fehlender politischer Anständigkeit, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und wenn es nach den Worten des künftigen Schwiegersohns stimmt, dass „vor der Kunst wie vor dem Gesetz alle Menschen gleich“ sind (und das darf gewiss bezweifelt werden), dann sollte man im Sinne Hauptmanns auch entsprechend wohlständiger Personen (potenzielle) Tragik und (unwohlanständige) Moral hinterfragen. Tragik wiederum kann man in den gedachten Konträrwelten „Arm“ und „Reich“ gesellschaftlich über Regeln, Solidarität und Sicherheit eindämmen; oder, besser gesagt, man sollte dies gerade aus moralischen Gründen tun. Dazu muss man dann doch leider ab und zu mal nach Berlin gehen, zu den Ratten. Oder als Anfang auch erst einmal in Dresden ins Theater.
Felix Ringel hat an der Universität von Cambridge seine Doktorarbeit zur Zukunft und zum Schrumpfen der Stadt Hoyerswerda eingereicht. Der Sozialanthropologe betrieb dafür anderthalb Jahre Feldforschung in Deutschlands am schnellsten schrumpfender Stadt und lebte in dieser Zeit für jeweils mehrere Monate bei Gastfamilien. Er publizierte regelmäßig zum Thema demografischer Wandel und leitete eine Hoyerswerdaer Jugendtheatergruppe.
Wo sind sie heute also, die Ratten, die in des Direktors „Garten der deutschen Kunst die Wurzeln des Baumes des Idealismus“ abfressen? In Sarrazins vermeintlicher Migrantenwelt? In der angeblich braunen ostdeutschen Provinz? Im billig sanierten sozialen Wohnungsbau? In Mainhattans Hochhäusern? In Kraftklubs neuem Berlin der Möchtegern-Metropoliten? Oder im wulffschen kleinbürgerlichen Eigenheim? Wie steht es mit der Moral in unseren Tagen?
Hauptmann hat das Problem der Moral den repräsentativen Konventionen seiner Zeit entsprechend im Kontext der überfüllten Arbeiterbezirke der Großstädte präsentiert. Das war natürlich damals schon nur begrenzt gerechtfertigt. Anthropologisch sind eher die oft unerwartet ausdauernden Formen menschlicher Kreativität, die überraschend vielfältigen sozialen Ressourcen und die facettenreiche, kontinuierliche Aushandlung von komplexer Realität interessant. Allerdings bleibt trotz Hauptmanns engagierter Sozialkritik der Mensch, vor allem der prekäre (anteilig rechtmäßig, wie gesagt), Opfer seiner Verhältnisse. Nur am Rande streift der Autor Formen gelebter Solidarität: gemeinsame Kinderbetreuung, geteilte Mahlzeiten, Arbeiterstolz und Arbeitertugenden. Gerade das damals rote Sachsen kann als einst am stärksten industrialisiertes Land Deutschlands und mit seiner jüngeren Vergangenheit als Teil eines anfänglich stolzen Arbeiter- und Bauernstaates ein Lied davon singen, dass sich entgegen Schönbohms Äußerungen der späten 1990er-Jahre (Sie erinnern sich?) Proletariat und Moral nicht ausschließen müssen.
Gilt das auch für das heutige Prekariat? Für die junge Mutter mit zwei oder drei Jobs oder eben überhaupt keinem, die in aller Öffentlichkeit lautstark ihre rotzfrechen Gören anschreit; für den Langzeitarbeitslosen, der schon mit einem Bein auf der Straße steht und sich nicht mehr dazugehörig fühlt; oder für den Alki vom nächstbesten Stehimbiss, dessen Selbstwertgefühl nur noch in Relation zum Alkoholspiegel steigt? Diese Menschen von vornherein moralisch zu degradieren steht keinem zu. Auf (moralischer) Augenhöhe nur kann man den vermeintlichen Ratten begegnen; nicht mit paternalistisch-entmündigendem oder wohlwollend-ängstlichem Blick, sondern mit Verständnis, Selbstkritik und der Einsicht in die weitaus komplexeren Zusammenhänge, in denen soziales Elend entsteht und wirkt. Heutige moralische Diskurse stellen deswegen auch ganz andere Fragen: nach erkauften oder erschlichenen Doktortiteln, verlorener Finanzmoral und fehlender politischer Anständigkeit, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und wenn es nach den Worten des künftigen Schwiegersohns stimmt, dass „vor der Kunst wie vor dem Gesetz alle Menschen gleich“ sind (und das darf gewiss bezweifelt werden), dann sollte man im Sinne Hauptmanns auch entsprechend wohlständiger Personen (potenzielle) Tragik und (unwohlanständige) Moral hinterfragen. Tragik wiederum kann man in den gedachten Konträrwelten „Arm“ und „Reich“ gesellschaftlich über Regeln, Solidarität und Sicherheit eindämmen; oder, besser gesagt, man sollte dies gerade aus moralischen Gründen tun. Dazu muss man dann doch leider ab und zu mal nach Berlin gehen, zu den Ratten. Oder als Anfang auch erst einmal in Dresden ins Theater.
Felix Ringel hat an der Universität von Cambridge seine Doktorarbeit zur Zukunft und zum Schrumpfen der Stadt Hoyerswerda eingereicht. Der Sozialanthropologe betrieb dafür anderthalb Jahre Feldforschung in Deutschlands am schnellsten schrumpfender Stadt und lebte in dieser Zeit für jeweils mehrere Monate bei Gastfamilien. Er publizierte regelmäßig zum Thema demografischer Wandel und leitete eine Hoyerswerdaer Jugendtheatergruppe.