Premiere 09.09.2011
› Schauspielhaus
Der Kaufmann von Venedig
von William Shakespeare
Deutsch von Elisabeth Plessen
Deutsch von Elisabeth Plessen
Handlung
Tragisch-komisch wird im „Kaufmann“ über die Liebe zwischen Männern und Frauen, wie auch zwischen Männern und Männern erzählt. Aber es ist auch ein Stück über Hass und Geldgier: Bassanio braucht dringend Geld, um die reiche Portia zu umwerben. Er bittet seinen Freund Antonio, ihm die Summe zu borgen. Und weil Antonio Bassanio liebt, sichert er es ihm zu. Antonio, der selbst keinen Zugriff auf sein Geld hat, muss dafür bei seinem Erzfeind, dem Juden Shylock, um einen Kredit betteln. Shylock gewährt ihm diesen mit der Auflage, dass er ihm, wenn er das Geld nicht zum vereinbarten Termin zurückzahlt, ein Pfund Fleisch aus dem Leib schneiden darf. Die Geschichte nimmt kein gutes Ende.
Tilmann Köhler und sein 12-köpfiges Männerensemble erzählen diese alte Geschichte neu und versuchen herauszufinden, in welchem Verhältnis unsere Kultur heute allem „Fremden“ gegenübersteht. Der „Kaufmann“ – ideologisch missbraucht von den Nationalsozialisten und auch von anderen politischen Seiten instrumentalisiert – ist ein höchst polarisierender Stoff. Genau darin liegt seine Herausforderung: Zu Shakespeares Zeit ist Venedig ein Zentrum des Welthandels. Hier treffen jüdische auf christliche Werte, begegnen sich verschiedene Kulturen und Sprachen. Tauschgeschäfte und Kriege verlangen nach einer Vermehrung des Kapitals. Deshalb braucht man die Juden: Man ist auf ihr Geld angewiesen, und allein darin – so scheint es – liegt ihre Daseinsberechtigung. Ansonsten ghettoisiert man sie, lässt sie nicht am gesellschaftlichen Leben mit den Christen teilnehmen; sie werden als Fremde stigmatisiert. In dieser Welt treffen die zwei Kaufleute Antonio und Shylock aufeinander, mischen sich ihre verschiedenen Wertvorstellungen mit persönlichen Ressentiments. In einer Stadt wie Dresden, die sich nach wie vor schwer tut mit dem Fremden, untersuchen Tilmann Köhler und sein Team, inwieweit die Vorurteilsstrukturen, unterschiedlichen Wertesysteme und Rechtsauffassungen noch immer bestehen, welcher Art die Projektionen von Fremdheit sind sowie den Ursprung und die vermeintliche Notwendigkeit von Feindbildern.
Tilmann Köhler und sein 12-köpfiges Männerensemble erzählen diese alte Geschichte neu und versuchen herauszufinden, in welchem Verhältnis unsere Kultur heute allem „Fremden“ gegenübersteht. Der „Kaufmann“ – ideologisch missbraucht von den Nationalsozialisten und auch von anderen politischen Seiten instrumentalisiert – ist ein höchst polarisierender Stoff. Genau darin liegt seine Herausforderung: Zu Shakespeares Zeit ist Venedig ein Zentrum des Welthandels. Hier treffen jüdische auf christliche Werte, begegnen sich verschiedene Kulturen und Sprachen. Tauschgeschäfte und Kriege verlangen nach einer Vermehrung des Kapitals. Deshalb braucht man die Juden: Man ist auf ihr Geld angewiesen, und allein darin – so scheint es – liegt ihre Daseinsberechtigung. Ansonsten ghettoisiert man sie, lässt sie nicht am gesellschaftlichen Leben mit den Christen teilnehmen; sie werden als Fremde stigmatisiert. In dieser Welt treffen die zwei Kaufleute Antonio und Shylock aufeinander, mischen sich ihre verschiedenen Wertvorstellungen mit persönlichen Ressentiments. In einer Stadt wie Dresden, die sich nach wie vor schwer tut mit dem Fremden, untersuchen Tilmann Köhler und sein Team, inwieweit die Vorurteilsstrukturen, unterschiedlichen Wertesysteme und Rechtsauffassungen noch immer bestehen, welcher Art die Projektionen von Fremdheit sind sowie den Ursprung und die vermeintliche Notwendigkeit von Feindbildern.
Besetzung
Regie
Tilmann Köhler
Bühne
Karoly Risz
Kostüme
Susanne Uhl
Musik
Jörg-Martin Wagner
Dramaturgie
Licht
Michael Gööck
Der Doge von Venedig / Tubal, ein Jude / Alter Gobbo, Lanzelots Vater
Antonio, ein Kaufmann von Venedig
Christian Erdmann
Bassanio, Freund des Antonio und Freier Portias
Christian Clauß
Gratiano, Freund des Bassanio
Benjamin Pauquet
Salerio, Freund des Antonio und Bassanio
Thomas Kitsche
Solanio, Freund des Antonio und Bassanio
Jonas Friedrich Leonhardi
Shylock, ein Jude
Jessica, Tochter des Shylock
André Kaczmarczyk
Lorenzo, Liebhaber der Jessica / Prinz von Marocco
Lanzelot Gobbo, Diener des Shylock / Prinz von Arragon
Thomas Braungardt
Portia, Herrin auf Belmont
Nerissa, Begleiterin der Portia
Violine
Florian Mayer
Violoncello
Dietrich Zöllner
Video
Über das Stück
Der Dramaturg Robert Koall zu Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“
Shakespeares bitterernste Komödie, die um 1600 erstmals veröffentlich wurde, stellt uns zwei Außenseiter vor, zwei tragisch und monströs schief ins Leben gebaute Figuren, die beide nicht wirklich dazu angetan sind, unsere Herzen zu erobern.
Der erste, Antonio, der titelgebende Kaufmann, ist ein unter die Adligen geworfener Bürger, ein Neureicher, dem doch sein Reichtum kein Glück beschert. Er bleibt allein, er muss sogar mitansehen, wie sein Freund Bassanio auf Brautwerbung geht. Schnell begreifen wir, dass ihn das mehr kostet, als nur den guten Freund – er liebt Bassanio. Doch seine Homosexualität kann er weder sich noch der Gesellschaft eingestehen und so begräbt er seine Neigungen in seiner Brust und legt sie sich schwer auf seine Seele.
Doch es gibt noch einen anderen Antonio, der es uns viel schwerer macht; das ist der antisemitische Bürger, der den Juden Shylock bespuckt, wo er ihn trifft, der sich in Tiraden ergeht und ihm nachstellt. Widerlich kommt er uns hier entgegen, maßlos in seinem Hass.
Noch komplizierter macht es uns der zweite Außenseiter, eben jener Jude Shylock. Der hasst zurück, ebenso blind und rasend, wie er gehasst wird. Nur wächst seine Figur im Verlaufe des Stücks weit über die des Rächers und des Zurückschlagenden hinaus. Seine berühmte Forderung, dem Antonio ein Pfund Fleisch aus der Herzregion zu schneiden, um seine Schulden bei ihm zu tilgen, macht ihn zum Monster, hebt ihn ins Dämonische.
Umso wichtiger ist es, immer wieder darauf hinzuweisen, dass sowohl die Homosexualität Antonios als auch das Jüdischsein des Shylock lediglich Markierungen des Autors Shakespeare sind, um das Außenseitertum seiner Figuren auf eine (im historischen Kontext) maximale Höhe zu treiben. Es liegen hierin nicht per se charakterliche Zuschreibungen verborgen, sondern gesellschaftliche Verortungen – in diesem Fall weit außerhalb der Gesellschaft. Der Literaturwissenschaftler Harold Bloom schrieb über Shylock: „Ich bezweifle, das Shakespeare mit der Geschichte des jüdischen Volkes in nach-biblischer Zeit genügend vertraut war, um sich tiefgründige Gedanken darüber zu machen, und schon deswegen kann man wohl nicht behaupten, dass Shylock die jüdische Geschichte verkörpere, es sei denn insofern, als leider Gottes Shakespeares machtvolle Wirkung das ihre dazu beigetragen hat, die spätere jüdische Geschichte nach Shylocks Bild zu modeln.“
So sind also Antonio und Shylock für uns weniger interessant in dem, was sie vertreten, als vielmehr in dem, was sie zu Außenseitern macht, was sie in ihre Rollen treibt, die sie im „Kaufmann“ innehaben.
Es ist die Stadt, es ist die Gesellschaft ihrer Bürger, die sie in ihre Ecken treibt, von wo aus sie so furchterregend zurückkeilen. Es ist die Stadt, diese „Metapher für die Geld- und Warengesellschaft, in der alles käuflich ist, einschließlich der Menschen, in der nur gilt, wer Geld hat, ob Jude oder Christ, eine Welt, die die Menschen böse macht, geizig, zynisch, aggressiv, ausbeutend und die nur mühsam ihre Feindseligkeiten gegen Fremde, in denen sie zuerst die Konkurrenten sieht, unter Kontrolle bringt, eine unsolidarische Gesellschaft.“ So beschreibt der Autor Ekkehart Krippendorff das shakespearsche Venedig.
Der erste, Antonio, der titelgebende Kaufmann, ist ein unter die Adligen geworfener Bürger, ein Neureicher, dem doch sein Reichtum kein Glück beschert. Er bleibt allein, er muss sogar mitansehen, wie sein Freund Bassanio auf Brautwerbung geht. Schnell begreifen wir, dass ihn das mehr kostet, als nur den guten Freund – er liebt Bassanio. Doch seine Homosexualität kann er weder sich noch der Gesellschaft eingestehen und so begräbt er seine Neigungen in seiner Brust und legt sie sich schwer auf seine Seele.
Doch es gibt noch einen anderen Antonio, der es uns viel schwerer macht; das ist der antisemitische Bürger, der den Juden Shylock bespuckt, wo er ihn trifft, der sich in Tiraden ergeht und ihm nachstellt. Widerlich kommt er uns hier entgegen, maßlos in seinem Hass.
Noch komplizierter macht es uns der zweite Außenseiter, eben jener Jude Shylock. Der hasst zurück, ebenso blind und rasend, wie er gehasst wird. Nur wächst seine Figur im Verlaufe des Stücks weit über die des Rächers und des Zurückschlagenden hinaus. Seine berühmte Forderung, dem Antonio ein Pfund Fleisch aus der Herzregion zu schneiden, um seine Schulden bei ihm zu tilgen, macht ihn zum Monster, hebt ihn ins Dämonische.
Umso wichtiger ist es, immer wieder darauf hinzuweisen, dass sowohl die Homosexualität Antonios als auch das Jüdischsein des Shylock lediglich Markierungen des Autors Shakespeare sind, um das Außenseitertum seiner Figuren auf eine (im historischen Kontext) maximale Höhe zu treiben. Es liegen hierin nicht per se charakterliche Zuschreibungen verborgen, sondern gesellschaftliche Verortungen – in diesem Fall weit außerhalb der Gesellschaft. Der Literaturwissenschaftler Harold Bloom schrieb über Shylock: „Ich bezweifle, das Shakespeare mit der Geschichte des jüdischen Volkes in nach-biblischer Zeit genügend vertraut war, um sich tiefgründige Gedanken darüber zu machen, und schon deswegen kann man wohl nicht behaupten, dass Shylock die jüdische Geschichte verkörpere, es sei denn insofern, als leider Gottes Shakespeares machtvolle Wirkung das ihre dazu beigetragen hat, die spätere jüdische Geschichte nach Shylocks Bild zu modeln.“
So sind also Antonio und Shylock für uns weniger interessant in dem, was sie vertreten, als vielmehr in dem, was sie zu Außenseitern macht, was sie in ihre Rollen treibt, die sie im „Kaufmann“ innehaben.
Es ist die Stadt, es ist die Gesellschaft ihrer Bürger, die sie in ihre Ecken treibt, von wo aus sie so furchterregend zurückkeilen. Es ist die Stadt, diese „Metapher für die Geld- und Warengesellschaft, in der alles käuflich ist, einschließlich der Menschen, in der nur gilt, wer Geld hat, ob Jude oder Christ, eine Welt, die die Menschen böse macht, geizig, zynisch, aggressiv, ausbeutend und die nur mühsam ihre Feindseligkeiten gegen Fremde, in denen sie zuerst die Konkurrenten sieht, unter Kontrolle bringt, eine unsolidarische Gesellschaft.“ So beschreibt der Autor Ekkehart Krippendorff das shakespearsche Venedig.
So wird „Der Kaufmann von Venedig“ von einer Komödie über zwei Außenseiter zu einer Gesellschaftsüberprüfung. Zu einem Nachdenken auf dem Theater darüber, was das für eine Gesellschaft sein muss, die solche Hervorbringungen hat. Unter was für Bedingungen soviel Hass und Perfidie überhaupt erst entstehen kann. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb der Shakespeare-Übersetzer Gustav Landauer: „Dass der Druck so wirkt, das gilt für alle Getretenen. Ja, Shylock löst mit ewig-gültigen Worten, die er selbst spricht, sein eigenes Rätsel: er ist das Produkt niederträchtiger Behandlung; er ist niederträchtig.“
„Der Kaufmann von Venedig“ handelt von der Stadt. Von ihrer Angst vor dem Fremden, vor dem Anderen, dem ihr scheinbar nicht Gemäßen. Auch von dem Umgang damit. Im Stück bleiben zwei Unglückliche zurück, weil die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihre Andersartigkeit zu akzeptieren und ihnen die eigenen Spielregeln aufzwingt.
Dresden ist ein guter Ort für den „Kaufmann“. Diese Stadt, die sich nach wie vor schwer tut mit dem Fremden. Die sich dem Tourismus als Wirtschaftsfaktor weit öffnet – die aber einen eklatant niedrigen Ausländeranteil in der Stadtbevölkerung hat. Die einst in dunklen Zeiten eine Hochburg der nationalsozialistischen Bewegung war – sich aber heute schwer tut mit der eigenen Vergangenheit und sich oft in der Opferrolle wohler fühlt als mit offen eingestandener, historischer Schuld. Die die meisten Zuschauer deutschlandweit bei einer Lesung des Populisten Sarrazin hat – obwohl sie doch mit dem Fremden, vor dem der Buchautor so dumpf raunend warnt, kaum je in Berührung kommt.
Das Stück „Der Kaufmann von Venedig“ lebt, um es mit den Worten des Autors James Shapiro zu sagen, davon, „dass es sich an fundamentalen Überzeugungen bezüglich des rassischen, nationalen, sexuellen und religiösen Andersseins anderer reibt. Wenn wir unseren Blick von dem abwenden, was das Stück über die Beziehung zwischen kulturellen Mythen und den Identitäten der Menschen lehrt, so bringt dies irrationale, das Andere ausgrenzende Haltungen nicht zum Verschwinden. Diese dunklen Strebungen entziehen sich normalerweise dem Blick, sie sind im gewöhnlichen Leben kaum je zu fassen – nur ganz bestimmte Ereignisse, und dazu zählen Inszenierungen dieses Stücks, machen diese kulturellen Verwerfungslinien sichtbar.“
Jeder Stadt, jeder Gesellschaft tut eine solche Sichtbarmachung ihrer kulturellen Verwerfungslinien von Zeit zu Zeit gut.
„Der Kaufmann von Venedig“ handelt von der Stadt. Von ihrer Angst vor dem Fremden, vor dem Anderen, dem ihr scheinbar nicht Gemäßen. Auch von dem Umgang damit. Im Stück bleiben zwei Unglückliche zurück, weil die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihre Andersartigkeit zu akzeptieren und ihnen die eigenen Spielregeln aufzwingt.
Dresden ist ein guter Ort für den „Kaufmann“. Diese Stadt, die sich nach wie vor schwer tut mit dem Fremden. Die sich dem Tourismus als Wirtschaftsfaktor weit öffnet – die aber einen eklatant niedrigen Ausländeranteil in der Stadtbevölkerung hat. Die einst in dunklen Zeiten eine Hochburg der nationalsozialistischen Bewegung war – sich aber heute schwer tut mit der eigenen Vergangenheit und sich oft in der Opferrolle wohler fühlt als mit offen eingestandener, historischer Schuld. Die die meisten Zuschauer deutschlandweit bei einer Lesung des Populisten Sarrazin hat – obwohl sie doch mit dem Fremden, vor dem der Buchautor so dumpf raunend warnt, kaum je in Berührung kommt.
Das Stück „Der Kaufmann von Venedig“ lebt, um es mit den Worten des Autors James Shapiro zu sagen, davon, „dass es sich an fundamentalen Überzeugungen bezüglich des rassischen, nationalen, sexuellen und religiösen Andersseins anderer reibt. Wenn wir unseren Blick von dem abwenden, was das Stück über die Beziehung zwischen kulturellen Mythen und den Identitäten der Menschen lehrt, so bringt dies irrationale, das Andere ausgrenzende Haltungen nicht zum Verschwinden. Diese dunklen Strebungen entziehen sich normalerweise dem Blick, sie sind im gewöhnlichen Leben kaum je zu fassen – nur ganz bestimmte Ereignisse, und dazu zählen Inszenierungen dieses Stücks, machen diese kulturellen Verwerfungslinien sichtbar.“
Jeder Stadt, jeder Gesellschaft tut eine solche Sichtbarmachung ihrer kulturellen Verwerfungslinien von Zeit zu Zeit gut.
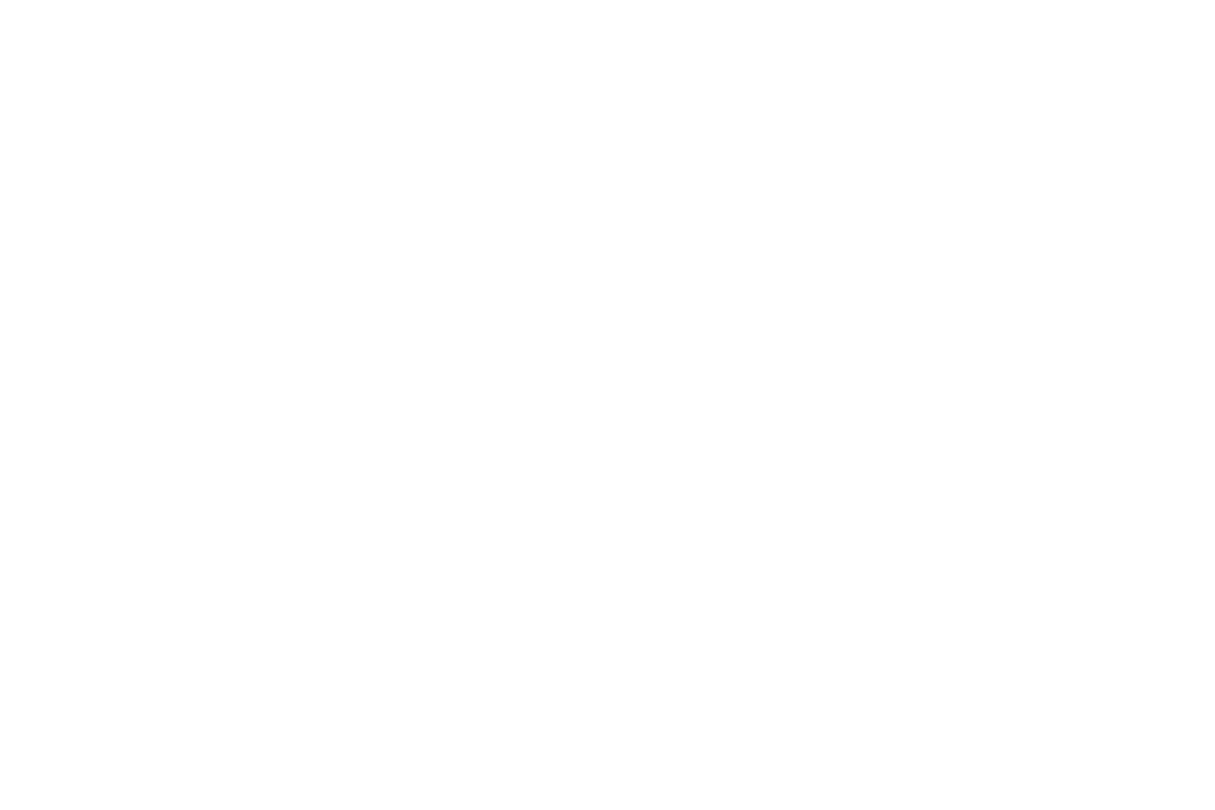



Am Ende steigen sie alle wieder aus den Kostümen, den Hosen, den Kleidern und den Rollen. Als ‚Leute wie du und ich‘ stehen die 12 Männer vor 800 begeisterten Zuschauern. Es war nur ein Spiel, aber was für eins!“
Köhler balanciert geschickt, mit gelegentlichen Schwindelanfällen, auf dem schmalen Grat zwischen Komödie und bitterer Tragödie. Er lässt alle Rollen, wie in der Shakespearezeit üblich, von Männern spielen. Ein gefundenes Fressen für den überragenden Christian Friedel. Er schlüpft ins weiße Brautkleid der klug-witzigen Portia, stöckelt Po und Busen hebend über die Bühne, lässt einen Freier nachdem anderen abblitzen und staunt kopfschüttelnd über die Dummheit der Männer. Auch später, im Zweitauftritt als Richter, zeigt Friedel, welche Wandlungskraft in ihm steckt. Unsicher und tastend in den Prozess einsteigend, wird er höhnisch und schneidend, macht den Juden fertig, als stünde Hitlers Blutrichter Freisler auf der Kanzel.
Dieses plötzliche Umschlagen von Arglosigkeit in Aggression, von Männerspaß zum Pogrom macht die Stärke der Inszenierung aus. Das Beste kommt im vierten Akt: die Gerichtsverhandlung. Sie knistert vor Spannung, Hass und Rache, Kalkül und Kälte schlagen aufeinander. Der dreißigjährige Matthias Reichwald spielt den Shylock: federnd und dynamisch, gedemütigt und gnadenlos. So jung hat man Shylock noch auf keiner Bühne gesehen.“
Was Friedel zeigt, ist weniger eine doppelte Travestie als der Beweis, wie gleichgültig und zugleich höchst witzig Tüll und Spitze auf einen Leib gehängt werden, dem eigentlich jede Rundung dafür fehlt. Jede Nuance stimmt, die feinste Pointe sitzt.“