Premiere 16.01.2016
› Schauspielhaus
Der Idiot
nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewskij
Deutsch von Swetlana Geier
Bühnenfassung von Matthias Hartmann, Janine Ortiz und Ensemble
Deutsch von Swetlana Geier
Bühnenfassung von Matthias Hartmann, Janine Ortiz und Ensemble
Handlung
Eine russische Gesellschaft, die sich zwischen Feudalismus und Kapitalismus häuslich einrichtet: Hochzeiten dienen der Absicherung prekärer Verhältnisse, mit Erbschaften wird noch vor dem Tod des zu Beerbenden spekuliert, und Mätressen sind eine Frage des Geldes. In diese Welt platzt Fürst Myschkin, Dostojewskijs Entwurf eines „wahrhaft vollkommenen und schönen Menschen“. Nach mehreren Jahren im Sanatorium kehrt er aus der Schweiz zurück. Mit den Spielregeln der Sankt Petersburger Gesellschaft ist der Fürst nicht vertraut, deshalb, und weil er unfähig ist zu Intrige und Misstrauen, fliegen ihm alle Herzen zu. „Mitleid ist das einzige Gesetz menschlichen Seins.“ Myschkins konsequent gelebte Devise stellt die scheinbar rationalen Entscheidungen seiner Mitmenschen in Frage. Mit dem Fürsten als Katalysator ist es plötzlich möglich, sich zu zweckbefreitem Handeln aufzuschwingen: Ein Paket mit 100.000 Rubeln landet im Feuer, und eine bevorstehende Erbschaft entwertet einen Heiratsantrag. – Doch auf den Rausch folgt der Kater. Dostojewskij lässt seinen Bilderbuch-Humanisten gnadenlos am nicht totzukriegenden Konkurrenzverhalten der anderen scheitern. „Man hörte Lachen“ ist eine häufig wiederkehrende Reaktion auf das Verhalten des Fürsten. Regisseur Matthias Hartmann inszeniert auf den großen Bühnen des deutschsprachigen Theaters, u. a. am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Schauspielhaus Zürich und am Residenztheater München. Er war Intendant des Schauspielhauses Bochum, des Zürcher Schauspielhauses und des Wiener Burgtheaters. Seine Inszenierungen wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und mehrfach zum Berliner Theatertreffen eingeladen, zuletzt 2014 die Produktion „Die letzten Zeugen“, die auch als Gastspiel in Dresden zu sehen war. Auch seine mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnete Inszenierung „Krieg und Frieden“ wurde hier mit großem Erfolg gezeigt. Matthias Hartmann arbeitet ebenfalls als Musiktheaterregisseur u. a am Opernhaus Zürich, an der Wiener Staatsoper und an der Mailänder Skala. Zudem entwirft er Programme für einen österreichischen Fernsehsender.
Besetzung
Regie
Matthias Hartmann
Bühne
Johannes Schütz
Kostüme
Tina Kloempken
Musik
Parviz Mir-Ali
Video
Moritz Grewenig
Licht
Michael Gööck
Dramaturgie
Janine Ortiz
Dramaturgische Mitarbeit
Nora Otte
Alexandra Iwanowna Jepantschina / Adelaida Iwanowna Jepantschina / Warwara „Warja“ Ardalionowa Iwolgina
Cathleen Baumann
Lisaweta Prokofjewna Jepantschina / Nina Alexandrowna Iwolgina
Rosa Enskat
Parfjon Semjonowitsch Rogoschin
Christian Erdmann
Aglaja Iwanowna Jepantschina
Lieke Hoppe
Iwan Fjodorowitsch Jepantschin
Fürst Lew Nikolajewitsch Myschkin
André Kaczmarczyk
Nastassja Filippowna Baraschkowa
Yohanna Schwertfeger
Afanassij Iwanowitsch Tozkij
Rainer Philippi
Ardalion Alexandrowitsch Iwolgin / Kammerdiener des General Jepantschin
Jan Maak
Gawrila „Ganja“ Ardalionowitsch Iwolgin / Rogoschins Diener
Kilian Land
Lukjan Timofejewitsch Lebedjew
Video
Ein Gespräch mit dem Regisseur Matthias Hartmann
Ein Gespräch mit dem Regisseur Matthias Hartmann über das Inszenieren von Romanen und die Gefährdung in der Kunst
Matthias Hartmann, auf dem Dresdner Spielplan stehen immer wieder Inszenierungen, die auf Romanvorlagen basieren. Auch Sie haben sich in den letzten Jahren großer epischer Stoffe angenommen, also Texte inszeniert, die nicht originär dramatisch sind. Zum Beispiel „Das Trojanische Pferd“ oder „Krieg und Frieden“, eine Inszenierung der Wiener Burg, die als Gastspiel in Dresden gefeiert wurde. Beim Publikum und beim Feuilleton ist das nicht unumstritten. Was antworten Sie auf die Frage, ob es denn wirklich nötig sei, Romane nun auch noch fürs Theater zu inszenieren?
Es gibt doch kein Regelwerk, welches erlaubt oder verbietet, was auf der Bühne zu sehen sein soll. Entscheidend ist, ob der Abend gut ist. Wenn einer auf dem Kopf stehend das Telefonbuch aufsagt und mir dabei den Eindruck vermittelt, dass das „zwingend“ ist und ich beim Zusehen meine Zeit nicht verschwende, dann reicht mir das schon. Man soll Stoffe wie die von Dostojewskij der Bühne vorenthalten, weil sie nicht als Dramen geschrieben wurden? Also bitte.
Was bietet Ihnen der Roman denn mehr als das Stück? Anders gefragt: Welches ist der Schlüsselreiz?
Jede Inszenierung ist zunächst einmal eine Fahrt ins Ungewisse. Bei der Arbeit an Texten, die im Ursprung nicht für das Theater geschrieben wurden, erhöht sich das Risiko noch. Das ist wie der Reiz, den Sex mit einer schönen Unbekannten ausstrahlt. Auf der Fahrt ins Ungewisse lernen wir vieles kennen, das wir vorher nicht wussten. Es ist aufregend, wenn Kunst diesen Grad von Gefährdung erreicht. Und ich glaube fest daran, dass es Gefährdung notwendig braucht, um ein gültiges Kunstwerk entstehen zu lassen.
In welches Verhältnis setzen Sie dabei Form und Fabel? Ist das eine wichtiger als das andere?
Form entwickelt sich immer eigendynamisch. Sie zeigt sich erst, wenn das Kunstwerk es im Prozess der Arbeit fordert. Da muss man hellhörig und gehorsam sein.
Inszenieren Sie anders, wenn Sie einen Roman als Vorlage haben?
Schon, ja. Weil man dabei noch mehr Angst hat als so schon. Der erprobte und starke Partner, der geübte Dramatiker, der sonst rettet und hilft, der fehlt jetzt. Man ist allein. Man kann sich nur noch auf sich selbst verlassen und auf seine Spieler. Das ist eine Mutprobe.
Gibt es Spezifika eines Romans, die Sie auch auf der Bühne für bewahrenswert halten? Oder ändert sich bei der Transponierung vom Buch auf die Bühne der Text?
In einem Roman klingen Töne, weht Licht herein. Das sind Wasserzeichen, die immer wieder aufscheinen und sichtbar werden. Diese Töne hört man während der Arbeit immer mal wieder. Ah, da ist ja wieder dieses Licht, das so parallel einfällt und alles kalt macht oder alles auflöst! Ah, da ist ja wieder dieser Groove, den man schon beim Lesen des Romans gehört hat. Dann bin ich ja vielleicht auf dem richtigen Weg. Dann stimmt anscheinend die Richtung. Weitergehen!
Was ist dabei Ihre Rolle als Regisseur? Sind Sie Spielleiter? Ermöglicher? Interpret? Teil eines Kollektivs? Primus inter pares?
In den existenziellen Momenten des Inszenierens bekomme ich plötzlich Zugang zu einer Sphäre, die mir sonst verschlossen ist. Da stimmt’s dann auf einmal. Als ob eine künstlerische Wahrheit zwei bis drei Zentimeter über meinem Kopf schwebt, und ich kann sie in die Wirklichkeit hinunterahnen.
Ist das der Punkt, an dem Sie mit Ihrer Kunst „zufrieden“ sind? Gibt es diesen Punkt überhaupt? Und liegt er vor oder nach der Premiere?
Am schönsten ist es doch immer, wenn sich etwas fügt und man beschenkt wird dadurch, dass man den richtigen Weg findet. Und natürlich auch dann, wenn es hinterher Anerkennung gibt. Da muss man ehrlich sein. Das tritt während der Arbeit aber in den Hintergrund.
Es gibt doch kein Regelwerk, welches erlaubt oder verbietet, was auf der Bühne zu sehen sein soll. Entscheidend ist, ob der Abend gut ist. Wenn einer auf dem Kopf stehend das Telefonbuch aufsagt und mir dabei den Eindruck vermittelt, dass das „zwingend“ ist und ich beim Zusehen meine Zeit nicht verschwende, dann reicht mir das schon. Man soll Stoffe wie die von Dostojewskij der Bühne vorenthalten, weil sie nicht als Dramen geschrieben wurden? Also bitte.
Was bietet Ihnen der Roman denn mehr als das Stück? Anders gefragt: Welches ist der Schlüsselreiz?
Jede Inszenierung ist zunächst einmal eine Fahrt ins Ungewisse. Bei der Arbeit an Texten, die im Ursprung nicht für das Theater geschrieben wurden, erhöht sich das Risiko noch. Das ist wie der Reiz, den Sex mit einer schönen Unbekannten ausstrahlt. Auf der Fahrt ins Ungewisse lernen wir vieles kennen, das wir vorher nicht wussten. Es ist aufregend, wenn Kunst diesen Grad von Gefährdung erreicht. Und ich glaube fest daran, dass es Gefährdung notwendig braucht, um ein gültiges Kunstwerk entstehen zu lassen.
In welches Verhältnis setzen Sie dabei Form und Fabel? Ist das eine wichtiger als das andere?
Form entwickelt sich immer eigendynamisch. Sie zeigt sich erst, wenn das Kunstwerk es im Prozess der Arbeit fordert. Da muss man hellhörig und gehorsam sein.
Inszenieren Sie anders, wenn Sie einen Roman als Vorlage haben?
Schon, ja. Weil man dabei noch mehr Angst hat als so schon. Der erprobte und starke Partner, der geübte Dramatiker, der sonst rettet und hilft, der fehlt jetzt. Man ist allein. Man kann sich nur noch auf sich selbst verlassen und auf seine Spieler. Das ist eine Mutprobe.
Gibt es Spezifika eines Romans, die Sie auch auf der Bühne für bewahrenswert halten? Oder ändert sich bei der Transponierung vom Buch auf die Bühne der Text?
In einem Roman klingen Töne, weht Licht herein. Das sind Wasserzeichen, die immer wieder aufscheinen und sichtbar werden. Diese Töne hört man während der Arbeit immer mal wieder. Ah, da ist ja wieder dieses Licht, das so parallel einfällt und alles kalt macht oder alles auflöst! Ah, da ist ja wieder dieser Groove, den man schon beim Lesen des Romans gehört hat. Dann bin ich ja vielleicht auf dem richtigen Weg. Dann stimmt anscheinend die Richtung. Weitergehen!
Was ist dabei Ihre Rolle als Regisseur? Sind Sie Spielleiter? Ermöglicher? Interpret? Teil eines Kollektivs? Primus inter pares?
In den existenziellen Momenten des Inszenierens bekomme ich plötzlich Zugang zu einer Sphäre, die mir sonst verschlossen ist. Da stimmt’s dann auf einmal. Als ob eine künstlerische Wahrheit zwei bis drei Zentimeter über meinem Kopf schwebt, und ich kann sie in die Wirklichkeit hinunterahnen.
Ist das der Punkt, an dem Sie mit Ihrer Kunst „zufrieden“ sind? Gibt es diesen Punkt überhaupt? Und liegt er vor oder nach der Premiere?
Am schönsten ist es doch immer, wenn sich etwas fügt und man beschenkt wird dadurch, dass man den richtigen Weg findet. Und natürlich auch dann, wenn es hinterher Anerkennung gibt. Da muss man ehrlich sein. Das tritt während der Arbeit aber in den Hintergrund.
Warum ist eine Inszenierung eigentlich immer erst fertig, wenn Publikum sie anschaut? Oder ist sie das gar nicht? Wann ist sie fertig?
Eine Inszenierung ist am Tag der Premiere so unfertig, wie man sie sich anschauen kann. Manchmal noch unfertiger. Das ist das große Dilemma.
Sie inszenieren zum ersten Mal in Dresden. Welche Rolle spielt für Sie die Stadt, in der Sie arbeiten?
Alles, was durch einen hindurchgeht, nimmt Einfluss auf die Arbeit. Theaterleute leben im Resonanzraum des Publikums und der Kritik. Sonst würden sie sich einer anderen Kunstform widmen und Bildhauer oder Schriftsteller werden. Man nimmt also mit der Arbeit Kontakt auf, man will die Menschen erreichen und verführen. Dafür muss man auch wissen, wer die sind und wie die so ticken.
Gilt das auch für die Spieler?
Natürlich. Man begibt sich schließlich zusammen auf diese Reise ins Ungewisse. Da steht man Schulter an Schulter und braucht Mut und Unterstützung. In so einer furchterregenden Zeit mag man jeden mutigen Mitstreiter immer nur beschützen und bewundern. Da liebt man seine Spieler. Und manchmal möchte man an ihnen verzweifeln: wenn sie immer nur diskutieren wollen und nicht probieren.
Ein kreuznaive Abschlussfrage: Ist Theater schwer?
Manchmal scheint es zwar vom Himmel zu fallen. Aber dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Dann muss man durchs Dickicht. Nehmen Sie „Der Idiot“: Das ist ein Text, der gültig ist. Der oszilliert und der vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen immer wieder andere Facetten ausspielt. Aber uns direkt angeht. Und uns Fragen stellt. Ökonomie als leitendes Denkmodell funktioniert z. B. im „Idioten“ nicht, auch wenn noch so viele Zweckehen angestrebt werden. Stattdessen wird das Geld ins Feuer geworfen, ein Schwindsüchtiger will seine Lebenszeit durch Selbstmord verkürzen, eine bevorstehende Erbschaft entwertet einen Heiratsantrag, zweimal bestraft eine Frau die Untreue ihres Geliebten durch Selbstkasteiung … Ist das jetzt eine Anleitung fürs echte Leben? Oder kann man so was nur im Theater ausleben? Das ist so eine Kernfrage, finde ich: ob das Theater vom Leben abschaut oder das Leben vom Theater. Die großen Fragen und das Dilemma unserer Existenz werden auf der Bühne stellvertretend durchgespielt. Und dann? Was folgt daraus? Macht mich das schlauer, glücklicher? Oder wiederhole ich in der Kunst nur die Nöte des Lebens?
Sie haben aber eigentlich eine kurze Frage gestellt und sollen eine kurze Antwort bekommen.
Also: Ist Theater schwer?
Ja.
Matthias Hartmann war von 2000 bis 2005 Intendant des Schauspielhauses Bochum, im Anschluss übernahm er die Intendanz des Zürcher Schauspielhauses. Bis 2014 war er Direktor des Wiener Burgtheaters, wo er u. a. KRIEG UND FRIEDEN nach dem Roman von Leo Tolstoi (ausgezeichnet mit dem Nestroy-Spezialpreis 2010) sowie 2013 DIE LETZTEN ZEUGEN inszenierte, eine Produktion, die zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Beide Arbeiten waren als Gastspiele auch am Staatsschauspiel Dresden zu sehen.
Eine Inszenierung ist am Tag der Premiere so unfertig, wie man sie sich anschauen kann. Manchmal noch unfertiger. Das ist das große Dilemma.
Sie inszenieren zum ersten Mal in Dresden. Welche Rolle spielt für Sie die Stadt, in der Sie arbeiten?
Alles, was durch einen hindurchgeht, nimmt Einfluss auf die Arbeit. Theaterleute leben im Resonanzraum des Publikums und der Kritik. Sonst würden sie sich einer anderen Kunstform widmen und Bildhauer oder Schriftsteller werden. Man nimmt also mit der Arbeit Kontakt auf, man will die Menschen erreichen und verführen. Dafür muss man auch wissen, wer die sind und wie die so ticken.
Gilt das auch für die Spieler?
Natürlich. Man begibt sich schließlich zusammen auf diese Reise ins Ungewisse. Da steht man Schulter an Schulter und braucht Mut und Unterstützung. In so einer furchterregenden Zeit mag man jeden mutigen Mitstreiter immer nur beschützen und bewundern. Da liebt man seine Spieler. Und manchmal möchte man an ihnen verzweifeln: wenn sie immer nur diskutieren wollen und nicht probieren.
Ein kreuznaive Abschlussfrage: Ist Theater schwer?
Manchmal scheint es zwar vom Himmel zu fallen. Aber dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Dann muss man durchs Dickicht. Nehmen Sie „Der Idiot“: Das ist ein Text, der gültig ist. Der oszilliert und der vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen immer wieder andere Facetten ausspielt. Aber uns direkt angeht. Und uns Fragen stellt. Ökonomie als leitendes Denkmodell funktioniert z. B. im „Idioten“ nicht, auch wenn noch so viele Zweckehen angestrebt werden. Stattdessen wird das Geld ins Feuer geworfen, ein Schwindsüchtiger will seine Lebenszeit durch Selbstmord verkürzen, eine bevorstehende Erbschaft entwertet einen Heiratsantrag, zweimal bestraft eine Frau die Untreue ihres Geliebten durch Selbstkasteiung … Ist das jetzt eine Anleitung fürs echte Leben? Oder kann man so was nur im Theater ausleben? Das ist so eine Kernfrage, finde ich: ob das Theater vom Leben abschaut oder das Leben vom Theater. Die großen Fragen und das Dilemma unserer Existenz werden auf der Bühne stellvertretend durchgespielt. Und dann? Was folgt daraus? Macht mich das schlauer, glücklicher? Oder wiederhole ich in der Kunst nur die Nöte des Lebens?
Sie haben aber eigentlich eine kurze Frage gestellt und sollen eine kurze Antwort bekommen.
Also: Ist Theater schwer?
Ja.
Matthias Hartmann war von 2000 bis 2005 Intendant des Schauspielhauses Bochum, im Anschluss übernahm er die Intendanz des Zürcher Schauspielhauses. Bis 2014 war er Direktor des Wiener Burgtheaters, wo er u. a. KRIEG UND FRIEDEN nach dem Roman von Leo Tolstoi (ausgezeichnet mit dem Nestroy-Spezialpreis 2010) sowie 2013 DIE LETZTEN ZEUGEN inszenierte, eine Produktion, die zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Beide Arbeiten waren als Gastspiele auch am Staatsschauspiel Dresden zu sehen.










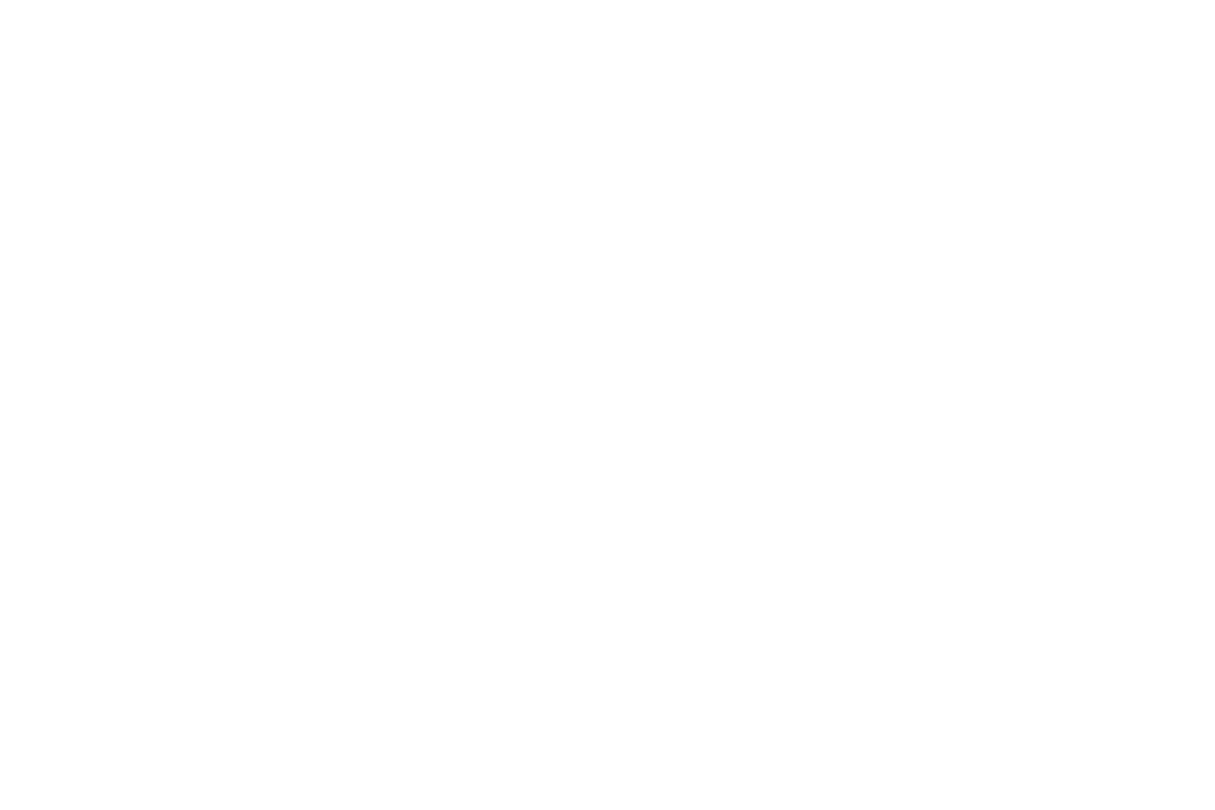



Zur Rendite der Jahre des bald nach Düsseldorf entschwindenden Intendanten gehört eben auch ein famoses Ensemble, das in der Lage ist, aus fast tausend Romanseiten in einer Mischung aus referierter Beschreibung, direkter Rede und lebendigem Spiel mit Witz und Ironie Theater zu machen. Einen Text zu komponieren, dass im Ernst der Witz lauert. Und die Heiterkeit immer auch Traurigkeit durchzieht. Samt jener Fallhöhe, die den boulevardesken Zugriff legitimiert, wenn er so souverän durchgehalten wird wie in diesen vier, kein bisschen langweiligen Stunden.“
Zu komödiantischer Hochform läuft Rosa Enskat als verschrobene Generalin auf, die ihren Gemahl und ihre drei Töchter (zwei auf einen Streich spielt Cathleen Baumann) barsch auf Trab hält. Wie sie zuckend, in schräger Stellung und lauernd Myschkin empfängt und ihm dann butterweich und versonnen an die Schulter sinkt, das muss man gesehen haben. Eine feine Studie als verarmter, ewig betrunkener Offizier, von der Familie verachtet, den letzten Stolz aufbringend, bietet Jan Maak. Die meisten Akteure müssen mehrmals ran, mal als wüstes, grölendes, grapschendes Volk, mal in kleinen, gut ausgefüllten Charakterrollen. Zu nennen wäre unbedingt Holger Hübner als bärbeißiger General mit sanftem Gemüt.“
Nach der Pause schält sich aus dem unterhaltsamen Reigen ein mitreißendes, immer bissigeres kleines Theaterinferno – die Regie stellt ihre Kunstgriffe offensiver aus, das Ensemble tritt mit doppelbödigen Kommentaren aus den Rollen (‚Diese Geschichte ist gestrichen.‘), und in fesselnden Szenen wird die bodenlose Korruptheit lächelnder Triebwesen und händereibender Strippenzieher freigelegt, die ihre Mätressenwirtschaft mit arrangierten Ehen und Mitgift-Kalkül zu kitten sucht, und doch statt Brautkleidern nur Totenhemden (Kostüme: Tina Kloempken) näht. Myschkin ist der göttliche Narr, der die Spielregeln dieser Schachpartie nicht kennt und arglos übers Spielbrett stolpert, die in knappen Strichen von Cathleen Baumann und Lieke Hoppe eindrücklich gezeichneten Jepantschin-Töchter bezaubert und am Schluss gerade so mit dem Leben, wenn auch nicht mit seiner geistigen Gesundheit davonkommt.“