Premiere 27.02.2010
› Schauspielhaus
Der goldne Topf
Ein Märchen aus der neuen Zeit nach der Novelle von E. T. A. Hoffmann
Handlung
ins Kristall bald dein Fall Am Himmelfahrtstag im biedermeierlichen Dresden stößt der junge Student Anselmus den Korb einer alten Apfelhändlerin um, und nichts ist mehr wie es einmal war. Er verliebt sich in die blauen Augen einer Schlange, die sich im Weiteren als die Tochter des seltsamen Archivars Lindhorst herausstellt, für den er Texte abschreiben muss. In diesen Texten erkennt Anselmus die Geschichte des Archivars, der eigentlich ein Salamander ist und aus der sagenhaften Welt Atlantis verbannt wurde. Um heimkehren zu dürfen, muss er seine Schlangentochter verheiraten. Dies will die Bürgerstochter Veronika verhindern, die sich eine gemeinsame Zukunft mit dem künftigen Hofrat Anselmus erhofft und zu diesem Zweck eine Hexe beauftragt, ihn zu verzaubern, damit er zu ihr zurückkehrt. Im Wechselspiel zwischen Alltag und Zauberhaftem gerät Anselmus in einen Zweikampf, den das Fantastische und die Poesie gegen eine ernüchternde Realität von damals und heute führen.
E. T. A. Hoffmann (1776 – 1822) war Schriftsteller, Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner, Theatermaler, Karikaturist und ist einer der wichtigsten Prosadichter der Romantik. Sein Werk ist gekennzeichnet vom Thema des Dualismus, den er variationsreich darstellt, beispielsweise als Gegensatz von fantasiereicher Kunst und bürgerlicher Normalität. Oftmals sind seine Texte in einer gebrochenen Perspektive geschrieben, die die Grenzen von Fiktion und Realität verwischt. Mit den sonderbaren Verfremdungen in seinen Kunstmärchen und Novellen bereicherte er dieses Genre. E. T. A. Hoffmann war von 1813 bis 1815 als Kapellmeister in Dresden angestellt.
E. T. A. Hoffmann (1776 – 1822) war Schriftsteller, Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner, Theatermaler, Karikaturist und ist einer der wichtigsten Prosadichter der Romantik. Sein Werk ist gekennzeichnet vom Thema des Dualismus, den er variationsreich darstellt, beispielsweise als Gegensatz von fantasiereicher Kunst und bürgerlicher Normalität. Oftmals sind seine Texte in einer gebrochenen Perspektive geschrieben, die die Grenzen von Fiktion und Realität verwischt. Mit den sonderbaren Verfremdungen in seinen Kunstmärchen und Novellen bereicherte er dieses Genre. E. T. A. Hoffmann war von 1813 bis 1815 als Kapellmeister in Dresden angestellt.
Besetzung
Regie
Sebastian Baumgarten
Bühne
Kathrin Frosch
Kostüme
Musik
Jörg Follert, Max Renne
Video
Stefan Bischoff
Licht
Dramaturgie
Jens Groß
Student Anselm
Sebastian Wendelin
Konrektor Paulmann
Wolfgang Michalek
Veronika
Picco von Groote
Archivar Lindhorst
Serpentina / Angelika / Hexe
Cathleen Baumann
Registrator Heerbrand
Fabian Gerhardt
Musiker
Max Renne
Video
Über das Stück
Dresden als konkreter Ort und Ort der Verklärung
von Harald Marx
von Harald Marx
Es war einmal, so beginnen eigentlich alle Märchen; und gemeint ist damit immer auch: Es war einmal irgendwo! E.T.A. Hoffmann hingegen erzählt eine absonderliche, als Märchen deklarierte Geschichte, die am Schwarzen Tor in Dresden beginnt, am Himmelfahrtstage, nachmittags um drei Uhr. Wir kennen also Ort und Zeit, fühlen uns dementsprechend auf gesichertem Boden. Beinahe sofort aber wechselt der Dichter ins Reich der Märchen hinüber und pendelt hinfort beständig zwischen möglicher Wirklichkeit und offensichtlicher Fantasie. Das Geister- und Hexenwesen wird angesiedelt in einer konkreten Stadt!
Man erfährt den Ort der Handlung, selbst die Uhrzeit des Beginns, aber der weitere Verlauf ist verwirrend und bleibt rätselhaft; der Leser verliert den Boden unter den Füßen, ob er will oder nicht. Gegenwärtiges und Vergangenes, Nachprüfbares und Erfundenes, zumindest Unerklärliches sind derart ineinander verwoben, dass man schließlich anfängt, an allem zu zweifeln, sogar am vorgeblich Faktischen.
Denn was bedeutet eine Wirklichkeit, in der jeder alles, und alles jeder sein kann? Und es ist durchaus nicht alles für jeden von gleicher Art. Darum ändert sich beständig auch der Ton der Dichtung. Manchmal sind es ganze Kapitel, bisweilen nur einzelne Passagen, die sich in eine Traumwelt entfernen und durch ihren übersteigerten Ton abheben von den sachlichen Schilderungen der Armseligkeiten des kleinlichen Alltagslebens, von der prosaischen Gegenwart: Aber in der Mitte des Tals war ein schwarzer Hügel, der hob sich auf und nieder wie die Brust des Menschen, wenn glühende Sehnsucht sie schwellt ... da brach im Übermaß des Entzückens eine herrliche Feuerlilie hervor, die schönen Blätter wie holdselige Lippen öffnend, der Mutter süße Küsse zu empfangen. Man ahnt, dass hier das Gute sich ankündigt: Nun schritt ein glänzendes Leuchten in das Tal; es war der Jüngling Phosphorus, den sah die Feuerlilie und flehte, von heißer sehnsüchtiger Liebe befangen: Sei doch mein ewiglich.
Auch das Böse hat seinen gewichtigen Platz in diesem Märchen: Da war ein altes hässliches Weib, mit gellender, krächzender Stimme, die etwas Entsetzliches hatte. Sie verkaufte Äpfel, die ihre Söhne gewesen sind, und trat später selbst als bronzener Türklopfer auf, der lebendig wurde aber nur in besonderen Situationen; und sogar der Aberglaube, ein Wesen könnte dadurch beeinflusst werden, dass man eine Sache verzaubert, erscheint als möglich. Doch alles Erzählte wird einerseits vom Dichter glaubhaft gemacht, andererseits scheint es irgendwie ironisch gemeint. Denn das Märchen entwickelt sich in immer verwirrteren Kreisen: Brücken werden geschlagen zwischen den Zeiten, zwischen vermeintlicher Realität und Fantasie, zwischen Menschen, Pflanzen und Tieren, ja selbst Dingen.
Ein alter Archivarius mit Namen Lindhorst entpuppt sich als jahrhundertealter Salamander, seine Töchter sind drei verführerische kleine grüne Schlangen, deren Großmutter die erwähnte Lilie in dem Märchenland Atlantis gewesen ist: Erlauben Sie, das ist orientalischer Schwulst, werter Herr Archivarius! So jedenfalls empfand es der Registrator und spätere Hofrat Heerbrand und hatte er nicht recht? Wir aber folgen dem Dichter und wissen darum auch: Die böse Hexe verdankte ihre Existenz der Vereinigung von schwarzer Drachenfeder und Runkelrübe und der gute Fürst aus einem fernen Märchenreich, der den Namen Phosphorus trägt, nimmt indirekt teil am gegenwärtigen Schicksal eines tolpatschigen Studenten, der Anselmus heißt und von einem Missgeschick ins nächste stolpert.
Dieser Student beschreibt gleich eingangs ausführlich, dass ihm alles misslungen sei, was er bisher begonnen habe; und dabei ist es wenig gewesen, wonach er anfangs strebte: eine Anstellung als geheimer Sekretär. Auch seine sonstigen Wünsche blieben bescheiden: eine halbe Portion Kaffee und eine Flasche Doppelbier! Dazu sehr allgemein die Nähe herrlich geputzter schöner Mädchen; und auch das nur am Himmelfahrtstag. Später versteigt er sich allerdings zu der Vorstellung, er könne es vielleicht sogar zum Hofrat bringen.
Eine solche bürgerliche Existenz, zuerst erstrebt, erweist sich jedoch mehr und mehr als wenig geeignet für ihn. Ein darauf gebautes Familienglück mit einer Frau, die bei aller Liebe in ihrer gesellschaftlichen Stellung aufgehen würde, ohne weitergehende geistige Interessen, konnte keine Erfüllung seiner Hoffnungen sein. Hat E.T.A. Hoffmann also mit Der goldne Topf nicht nur ein Märchen geschrieben, sondern einen kleinen Entwicklungsroman, bei dem sich die Charaktere erst langsam formen und dadurch anders antreten, als sie am Ende sind?
Allerdings erfahren wir vom Leben des Studenten Anselmus wenig: Was war das für eine Familie, aus der er kam; was hat er studiert und wo? Auch von seinen intellektuellen Begabungen hören wir nichts, dafür wird betont, dass er die Schönschrift beherrschte; und wir lesen, dass er Förderer hatte, die ihn vermitteln wollten: den Konrektor Paulmann und den Registrator Heerbrand. Anselmus musste sich und sein Studium also selbst finanzieren. Dabei passiert alles in unserer Welt: Die Orts- und Zeitangaben sind präzise, aber nur der Versager, der Mensch mit dem kindlich-naiven, poetischen Gemüt, der Student mit dem besten Willen, aber ohne sichtbare äußere Erfolge im Leben, gleitet in ein Paralleluniversum, in dem Zeit und Raum völlig aufgehoben sind.
Man erfährt den Ort der Handlung, selbst die Uhrzeit des Beginns, aber der weitere Verlauf ist verwirrend und bleibt rätselhaft; der Leser verliert den Boden unter den Füßen, ob er will oder nicht. Gegenwärtiges und Vergangenes, Nachprüfbares und Erfundenes, zumindest Unerklärliches sind derart ineinander verwoben, dass man schließlich anfängt, an allem zu zweifeln, sogar am vorgeblich Faktischen.
Denn was bedeutet eine Wirklichkeit, in der jeder alles, und alles jeder sein kann? Und es ist durchaus nicht alles für jeden von gleicher Art. Darum ändert sich beständig auch der Ton der Dichtung. Manchmal sind es ganze Kapitel, bisweilen nur einzelne Passagen, die sich in eine Traumwelt entfernen und durch ihren übersteigerten Ton abheben von den sachlichen Schilderungen der Armseligkeiten des kleinlichen Alltagslebens, von der prosaischen Gegenwart: Aber in der Mitte des Tals war ein schwarzer Hügel, der hob sich auf und nieder wie die Brust des Menschen, wenn glühende Sehnsucht sie schwellt ... da brach im Übermaß des Entzückens eine herrliche Feuerlilie hervor, die schönen Blätter wie holdselige Lippen öffnend, der Mutter süße Küsse zu empfangen. Man ahnt, dass hier das Gute sich ankündigt: Nun schritt ein glänzendes Leuchten in das Tal; es war der Jüngling Phosphorus, den sah die Feuerlilie und flehte, von heißer sehnsüchtiger Liebe befangen: Sei doch mein ewiglich.
Auch das Böse hat seinen gewichtigen Platz in diesem Märchen: Da war ein altes hässliches Weib, mit gellender, krächzender Stimme, die etwas Entsetzliches hatte. Sie verkaufte Äpfel, die ihre Söhne gewesen sind, und trat später selbst als bronzener Türklopfer auf, der lebendig wurde aber nur in besonderen Situationen; und sogar der Aberglaube, ein Wesen könnte dadurch beeinflusst werden, dass man eine Sache verzaubert, erscheint als möglich. Doch alles Erzählte wird einerseits vom Dichter glaubhaft gemacht, andererseits scheint es irgendwie ironisch gemeint. Denn das Märchen entwickelt sich in immer verwirrteren Kreisen: Brücken werden geschlagen zwischen den Zeiten, zwischen vermeintlicher Realität und Fantasie, zwischen Menschen, Pflanzen und Tieren, ja selbst Dingen.
Ein alter Archivarius mit Namen Lindhorst entpuppt sich als jahrhundertealter Salamander, seine Töchter sind drei verführerische kleine grüne Schlangen, deren Großmutter die erwähnte Lilie in dem Märchenland Atlantis gewesen ist: Erlauben Sie, das ist orientalischer Schwulst, werter Herr Archivarius! So jedenfalls empfand es der Registrator und spätere Hofrat Heerbrand und hatte er nicht recht? Wir aber folgen dem Dichter und wissen darum auch: Die böse Hexe verdankte ihre Existenz der Vereinigung von schwarzer Drachenfeder und Runkelrübe und der gute Fürst aus einem fernen Märchenreich, der den Namen Phosphorus trägt, nimmt indirekt teil am gegenwärtigen Schicksal eines tolpatschigen Studenten, der Anselmus heißt und von einem Missgeschick ins nächste stolpert.
Dieser Student beschreibt gleich eingangs ausführlich, dass ihm alles misslungen sei, was er bisher begonnen habe; und dabei ist es wenig gewesen, wonach er anfangs strebte: eine Anstellung als geheimer Sekretär. Auch seine sonstigen Wünsche blieben bescheiden: eine halbe Portion Kaffee und eine Flasche Doppelbier! Dazu sehr allgemein die Nähe herrlich geputzter schöner Mädchen; und auch das nur am Himmelfahrtstag. Später versteigt er sich allerdings zu der Vorstellung, er könne es vielleicht sogar zum Hofrat bringen.
Eine solche bürgerliche Existenz, zuerst erstrebt, erweist sich jedoch mehr und mehr als wenig geeignet für ihn. Ein darauf gebautes Familienglück mit einer Frau, die bei aller Liebe in ihrer gesellschaftlichen Stellung aufgehen würde, ohne weitergehende geistige Interessen, konnte keine Erfüllung seiner Hoffnungen sein. Hat E.T.A. Hoffmann also mit Der goldne Topf nicht nur ein Märchen geschrieben, sondern einen kleinen Entwicklungsroman, bei dem sich die Charaktere erst langsam formen und dadurch anders antreten, als sie am Ende sind?
Allerdings erfahren wir vom Leben des Studenten Anselmus wenig: Was war das für eine Familie, aus der er kam; was hat er studiert und wo? Auch von seinen intellektuellen Begabungen hören wir nichts, dafür wird betont, dass er die Schönschrift beherrschte; und wir lesen, dass er Förderer hatte, die ihn vermitteln wollten: den Konrektor Paulmann und den Registrator Heerbrand. Anselmus musste sich und sein Studium also selbst finanzieren. Dabei passiert alles in unserer Welt: Die Orts- und Zeitangaben sind präzise, aber nur der Versager, der Mensch mit dem kindlich-naiven, poetischen Gemüt, der Student mit dem besten Willen, aber ohne sichtbare äußere Erfolge im Leben, gleitet in ein Paralleluniversum, in dem Zeit und Raum völlig aufgehoben sind.
Geradezu fremd wirkt in dieser beginnenden Geschichte, die nur Unglück ahnen lässt, eine verklärte und betörende Ortsbeschreibung: Dicht vor ihm plätscherten und rauschten die goldgelben Wellen des schönen Elbstroms, hinter demselben streckte das herrliche Dresden kühn und stolz seine lichten Türme empor in den duftigen Himmelsgrund, der sich hinab senkte auf die blumigen Wiesen und frisch grünenden Wälder, und aus tiefer Dämmerung gaben die zackichten Gebirge Kunde vom fernen Böhmerlande. Selbst ein damals bekanntes Ausflugslokal, das Linkesche Bad, wird als paradiesisch beschrieben und zum unerreichbaren Sehnsuchtsort.
Es ist diese Beschreibung Dresdens, die sich immer wiederholt und nur leicht variiert in beinahe allen Reisebeschreibungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts findet. Hoffmann zitiert solche Schilderungen geradezu aber durch den Fortgang der Geschichte zerstört er das in der Ferne geschaute Traumbild einer Stadt: Dresden hatte, von Nahem gesehen, nur Banales oder Bedrohliches für ihn.
Doch nichts nimmt der Dichter wirklich ernst: nicht die verklärten Schilderungen von Orten und Situationen und nicht die gruseligsten Gespensterszenen, die der Leser selbst hätte stören können, so wird es suggeriert, wenn er denn gerade vorbeigekommen wäre und der Vorwurf schwingt mit, der Leser wäre am bedrohlichen Fortgang des Märchens selbst schuld, eben weil er im dramatischsten Augenblick nicht zur Stelle war. Die Gegenwart tritt, in Gestalt des Dichters, immer wieder in unser Blickfeld.
Andererseits scheint jede noch so kleine Begebenheit einem geheimen Ritus zu folgen: Schritt für Schritt kommen wir voran auf dem Weg einer geistigen und charakterlichen Läuterung. Vernehmlich klingt es: Serpentina! der Glaube an dich, die Liebe hat mir das Innerste der Natur erschlossen! Aber Serpentina ist eine der erwähnten drei Schlangen, grün mit blauen Augen, die zu Anselmus sagt, er allein könne sie verstehen; und sie verrät ihm den Grund: weil die Liebe in deiner Brust wohnt.
Die Liebe des Studenten Anselmus fällt also auf eine kleine grüne Schlange und man bleibt als Leser beinahe bis zum Schluss im Ungewissen, ob das als Ergebnis einer teuflischen Verführung oder als glückliche Wendung in seinem Leben gesehen werden muss; und sitzt er nun wirklich in einer kristallenen Flasche oder steht er auf der Elbbrücke (es gab damals in Dresden nur eine) und schaut ins Wasser? Eines scheint jedoch sicher: Der Alltag bleibt erbärmlich für alle, die nicht über den Kreis ihrer tagtäglichen Pflichten hinausblicken. Solche Beschränktheit wird manchmal bestraft. Wir lesen von stumpfsinnigen Kreuzschülern, die stolz darauf waren, dass sie keine italienischen Chöre mehr auswendig lernen mussten, sondern ihre Tage im Wirtshaus verbringen konnten, um dort wie wirkliche Studenten: gaudeamus igitur zu singen. Sie konnten nicht erkennen, wie eng ihr gläsernes Gefängnis gewesen ist. Oder standen auch sie auf der Brücke?
Wie im Märchen immer wird der gute Held zum Schluss belohnt und bekommt seine Prinzessin: eine verwunschene kleine grüne Schlange mit blauen Augen, die den Arm um ihn schlingt. Aber was dazu? Eine anscheinend mietfreie Wohnung auf einem Rittergut, das seinem Schwiegervater gehört hat! Und wo? In dem versunkenen Traumland Atlantis. Am Himmelfahrtstag nachmittags um drei Uhr ist der Student Anselmus durchs Schwarze Tor in Dresden gerannt und wo kommt er schließlich an: außerhalb jeder Zeit, auf einem Rittergut, aber in einem Land, dessen Existenz nur noch unbestimmte Erinnerung ist. Oder sagen wir: Poesie.
Jede Realität hebt sich auf in Atlantis, einem Land, das jeder an anderer Stelle sucht. Für den Arzt, Naturwissenschaftler und romantischen Künstler Carl Gustav Carus hat sich selbst die Stadt Dresden in besonderen Situationen zu diesem Traumland verklärt. Er schrieb rückschauend in seinen Lebenserinnerungen: Hatte ich nicht da wieder eine wunderbare Atlantis erschaut, wo so viele nur die alte kurfürstliche Residenz gewahr werden. Carus hatte seine bürgerliche Existenz und das Hofamt als Leibarzt des Königs mit dem Künstler-Sein verbunden. Hoffmann war Ähnliches nie gelungen. Er fand den Weg zurück nach Dresden nicht. Die Verklärung der Stadt dauerte bei ihm nur einen Augenblick.
Der Kunsthistoriker Prof. Dr. Harald Marx war von 1991 bis 2009 Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
Es ist diese Beschreibung Dresdens, die sich immer wiederholt und nur leicht variiert in beinahe allen Reisebeschreibungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts findet. Hoffmann zitiert solche Schilderungen geradezu aber durch den Fortgang der Geschichte zerstört er das in der Ferne geschaute Traumbild einer Stadt: Dresden hatte, von Nahem gesehen, nur Banales oder Bedrohliches für ihn.
Doch nichts nimmt der Dichter wirklich ernst: nicht die verklärten Schilderungen von Orten und Situationen und nicht die gruseligsten Gespensterszenen, die der Leser selbst hätte stören können, so wird es suggeriert, wenn er denn gerade vorbeigekommen wäre und der Vorwurf schwingt mit, der Leser wäre am bedrohlichen Fortgang des Märchens selbst schuld, eben weil er im dramatischsten Augenblick nicht zur Stelle war. Die Gegenwart tritt, in Gestalt des Dichters, immer wieder in unser Blickfeld.
Andererseits scheint jede noch so kleine Begebenheit einem geheimen Ritus zu folgen: Schritt für Schritt kommen wir voran auf dem Weg einer geistigen und charakterlichen Läuterung. Vernehmlich klingt es: Serpentina! der Glaube an dich, die Liebe hat mir das Innerste der Natur erschlossen! Aber Serpentina ist eine der erwähnten drei Schlangen, grün mit blauen Augen, die zu Anselmus sagt, er allein könne sie verstehen; und sie verrät ihm den Grund: weil die Liebe in deiner Brust wohnt.
Die Liebe des Studenten Anselmus fällt also auf eine kleine grüne Schlange und man bleibt als Leser beinahe bis zum Schluss im Ungewissen, ob das als Ergebnis einer teuflischen Verführung oder als glückliche Wendung in seinem Leben gesehen werden muss; und sitzt er nun wirklich in einer kristallenen Flasche oder steht er auf der Elbbrücke (es gab damals in Dresden nur eine) und schaut ins Wasser? Eines scheint jedoch sicher: Der Alltag bleibt erbärmlich für alle, die nicht über den Kreis ihrer tagtäglichen Pflichten hinausblicken. Solche Beschränktheit wird manchmal bestraft. Wir lesen von stumpfsinnigen Kreuzschülern, die stolz darauf waren, dass sie keine italienischen Chöre mehr auswendig lernen mussten, sondern ihre Tage im Wirtshaus verbringen konnten, um dort wie wirkliche Studenten: gaudeamus igitur zu singen. Sie konnten nicht erkennen, wie eng ihr gläsernes Gefängnis gewesen ist. Oder standen auch sie auf der Brücke?
Wie im Märchen immer wird der gute Held zum Schluss belohnt und bekommt seine Prinzessin: eine verwunschene kleine grüne Schlange mit blauen Augen, die den Arm um ihn schlingt. Aber was dazu? Eine anscheinend mietfreie Wohnung auf einem Rittergut, das seinem Schwiegervater gehört hat! Und wo? In dem versunkenen Traumland Atlantis. Am Himmelfahrtstag nachmittags um drei Uhr ist der Student Anselmus durchs Schwarze Tor in Dresden gerannt und wo kommt er schließlich an: außerhalb jeder Zeit, auf einem Rittergut, aber in einem Land, dessen Existenz nur noch unbestimmte Erinnerung ist. Oder sagen wir: Poesie.
Jede Realität hebt sich auf in Atlantis, einem Land, das jeder an anderer Stelle sucht. Für den Arzt, Naturwissenschaftler und romantischen Künstler Carl Gustav Carus hat sich selbst die Stadt Dresden in besonderen Situationen zu diesem Traumland verklärt. Er schrieb rückschauend in seinen Lebenserinnerungen: Hatte ich nicht da wieder eine wunderbare Atlantis erschaut, wo so viele nur die alte kurfürstliche Residenz gewahr werden. Carus hatte seine bürgerliche Existenz und das Hofamt als Leibarzt des Königs mit dem Künstler-Sein verbunden. Hoffmann war Ähnliches nie gelungen. Er fand den Weg zurück nach Dresden nicht. Die Verklärung der Stadt dauerte bei ihm nur einen Augenblick.
Der Kunsthistoriker Prof. Dr. Harald Marx war von 1991 bis 2009 Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
Im Gespräch
Gespräch zwischen dem Regisseur Sebastian Baumgarten und dem Dramaturgen Jens Groß
Jens Groß Was interessiert einen jungen, modernen Regisseur an einem so alten Stoff wie „Der goldne Topf“?
Sebastian Baumgarten Das Eine ist, dass es ein Material ist, was mich ganz konkret an den Ort, an dem ich arbeite, anbindet. „Der goldne Topf“ ist eine Dresdner Geschichte - das ist für mich sehr wichtig. Nachdem ich hier schon einige Male gearbeitet habe, ordnen sich ihre Historie, ihre Mentalität und all die Dinge in einen anderen Zusammenhang ein, und die Stadt wird damit ein Stück weit klarer für mich.
Das Zweite ist die außergewöhnliche Sprache, eine Sprache, die man als eine Art Widerstand verstehen kann. Die interessiert mich sehr. Ich bin jemand, der Texte gerne aus einer Aktualität heraus begreift und einen heutigen Gestus sucht, und trotzdem denke ich, dass auf der Bühne in der Spielweise, die ich bevorzuge, eine bestimmte Form von hoher Sprache hilft, mit meinen Spielmitteln umzugehen.
Ein dritter Punkt, der mich interessiert, ist die Zeit: 1795 mit dem Ende der Französischen Revolution und 1848 mit Anfang der bürgerlichen Revolution in Deutschland und der Phase der so genannten deutschen Frühromantik, die sich immer wieder mit den Themen Drogen, Rausch und den Spionen beschäftigt. Das finde ich ein modernes, aktuelles Thema. Da Hoffmann auch noch die virtuelle Ebene mit einbezieht, über das Märchen und die Erfindung einer Geisterwelt, ist man eigentlich in einer gewissen Art und Weise wieder komplett in der Gegenwart angekommen.
Groß Es ist ja kein Stück, sondern ein Prosatext - sogar ein Märchen. Ist es nicht besonders schwer, so etwas auf die Bühne zu bringen?
Baumgarten Für mich ist das einfach ein Material, wo ich mir das raussuche, was mich daran interessiert, und ich nehme mir auch heraus, den Stoff als eine Art Formel zu begreifen, in die ich jetzt die Gegenwart als Variable einsetze - als die Zeit mit unseren Umständen. Dann ist das gar nicht mehr so kompliziert. Im Gegenteil: Der Stoff eignet sich hervorragend, modernes Theater zu machen mit den Mitteln, die uns heute am Theater zur Verfügung stehen: Über verschiedene Medien zu gehen oder auch über eine nicht kontinuierliche Erzählweise nachzudenken.
Groß Das erklärt aber noch nicht den möglicherweise in der Prosa fehlenden dramatischen Grundkonflikt. Was ist der für Sie?
Baumgarten Interessant ist, dass es in der erfundenen Welt, die E. T. A. Hoffmann aufbaut, deutliche Anklänge an eine Welt gibt, mit der wir uns heute auseinander zu setzen haben. Es geht um die Übersetzung von arabischen Schriftzeichen, um Tunis, um feindliche Mächte einer anderen Kultur, es geht um eine Welt von exotischen Pflanzen und Tieren, die durchaus auch unbekannte Gefahren in sich bergen. Man lebt also im sicheren und schönen Dresden, und auf einmal bricht eine andere fundamentalistische Welt im Sinne von Natur, aber auch im Sinne von Politik, in diesen doch relativ geschützten Bereich ein und überfährt ihn.
Groß ... und mündet in dem Bild von Atlantis, einer versunkenen Welt.
Baumgarten Ja, und hier muss man sich bewusst machen, dass man doch auch ein Märchen erzählt und dem Stoff am besten sein Geheimnis lassen sollte. Über Atlantis haben wir sehr viel geredet, und es gibt die unterschiedlichsten Haltungen, Ansichten und Interpretationsvorschläge dazu - von den Schauspielern, von mir, von Bildwelten. Doch genau diesen Punkt versuche ich nicht auszudeuten, weil ich glaube, dass in Atlantis zwischen untergegangenem Reich und Utopie- oder Illusionspunkt alles reindenkbar ist, aber letztendlich bei einem Märchen in den Köpfen des Zuschauers etwas passieren muss. Bei einer normalen Erzählung würde ich sagen: Konkretheit ist das oberste Gebot. Bei einem Märchen aber sind es eher die Mittel, die man benutzt, die nach Konkretheit drängen und nicht so sehr die Grundaussage. Sonst geht das Formelhafte, das Metaphorische, das Modellhafte des Märchens verloren.
Groß Aber Sie verwenden diese Atlantiswelt doch als Gegenbild, ja sogar als Gegenkraft zu einer anderen, eher bürgerlichen Welt?
Baumgarten Für einen altmodischen Dialektiker, als den ich mich ansehe, ist es klar, dass eine Welt nur durch ihre Gegenwelt beschreibbar wird, bzw. die Gegenwelt auch nur dadurch existiert, dass sie in der Welt, in der wir uns befinden, erfunden und behauptet wird. Das bedingt sich gegenseitig, und vielleicht braucht der Mensch auch einfach erfundene Zusatzwelten, die es ermöglichen, seine eigenen Kriterien oder die gesellschaftlichen Kriterien in Frage zu stellen und zu messen an dem, was da als Außen formulierbar ist oder als Fernpunkt oder als Utopiepunkt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dahingehend auch ambivalent bewege zwischen einem katastrophalischen und einem poetischen Ansatz, Atlantis zu lesen und zu interpretieren. Zum einen kommt man bei der Geschichte, die hier erzählt wird, schnell auf die reale Geschichte von Dresden, also auf apokalyptische Bildwelten, wie die Filmdokumente über den Angriff der amerikanischen und britischen Bomber auf Dresden oder die faschistoiden Bilder von germanischen Gewaltvisionen, und andererseits gibt es bei Atlantis immer auch so einen seltsamen Punkt, wo die Poesie (und damit auch das Schreiben) und nicht die Realität alle Möglichkeiten der Kunst eröffnen, das Ganze also etwas positiv Utopistisches hat.
Groß Es handelt sich hier auch um ein Künstlerdrama, wo die Isoliertheit von kunstbegabten Menschen in dieser biedermeierlichen Welt beschrieben wird. Spielt das für Sie eine Rolle? Das Künstlerische, der künstlerische Mensch?
Baumgarten Ich hatte vor kurzem mit einem unserer Schauspieler eine Diskussion über den Film „Avatar“. Es ist immer wieder beeindruckend, dass Erfindungen der Kunst urplötzlich in der Realität Wirklichkeit werden können. Bestimmte Szenarien, die in Hollywood durchgespielt werden, können plötzlich Vorlagen zu realen Terroranschlägen werden usw. Ich kann mich noch gut an meinen ersten James-Bond-Film erinnern. Der hatte - simpel gesagt - ein Gerät, mit dem man verfolgen konnte, wo man lang fahren muss und wo der Andere ist. So ein Gerät habe ich seit gut acht Jahren in meinem Auto. Das ist also Realität gewordene Fiktion. Und dabei ist gar nicht klar, ob die reale Welt die Fiktion nur erfindet, oder ob die Fiktion auch wieder reale Welten abwirft. Das ist ein dialektisches Verhältnis.
Groß Das klingt fast so, als würden Sie den Kunstbegriff als versöhnende Komponente zwischen einer fantastischen und einer realen Welt sehen?
Baumgarten Ich würde es umgekehrt sagen: Ich würde die Künstlerfigur Anselm aus dem „Goldnen Topf“ gern aus dem künstlerisch naiven und dem lieben Jungenbild, der auch gut schreiben kann und viel Fantasie hat, rausholen und sagen: Man hat auch die Möglichkeit, zum Chefideologen aufzusteigen als Künstler. Wenn es stimmt, dass Fiktionen nicht nur Erfindungen der Realität sind, sondern die Fiktionen wiederum auch Realität erfinden, hätte die Hauptfigur Anselm im Stück, zumindest aus Atlantis heraus, durchaus das Potential zum Chefideologen.
Groß Wenn Sie den Begriff des Chefideologen ins Gespräch werfen, dann kommen wir zu einer anderen Schnittstelle, zu den Idealen und den Ideologien. Gibt es Lösungen für die Kunst? Oder ist Kunst wirklich erst dann nützlich, wenn sie zur Ideologie wird, oder geht es um etwas Anderes?
Baumgarten Gut, das sind ja immer Modelle. Ich sehe das als einen gesunden Wettstreit von Ideologien an. Ich glaube, das liberalisierte, das vermittelnde, von allem ein wenig beeinflusste Denken, ist das langweiligste, was keine Entwicklungen voranbringt. Das ist der Ist-Zustand, den wir hier in unserer politischen Demokratie vorfinden, also immer ein kleines Schräubchen drehen und kein Mut zu einer richtigen These. Ich bin jemand, der in einem strukturellen Zusammenhang arbeitet unter bestimmten ökonomischen Bedingungen, unter bestimmten Machtverhältnissen, die ich habe, denen ich ausgesetzt bin. Das sind Verhältnisse, die über Geld beschrieben werden können. Dadurch ist auch die Fiktion beeinflusst und sicher nicht mehr autonom. Kunst und Realität und Künstler und Normalsterblicher, das ist nicht mehr von einander zu trennen. Da sich die Verhältnisse gegenseitig bedingen, bin ich dafür, starke Ideologien zu setzen, sich damit auseinanderzusetzen, den Mut dazu zu haben, gerade im Theater, wo es noch niemanden weh tut, da es immer noch eine behauptete Lebensform ist. Und so halte ich es auch mit dem uns vorliegenden Stoff von E. T. A. Hoffmann in Bezug darauf, was die Haltung zu dieser Stadt betrifft, oder auch zu dem Deutschtum, das darin aufgezeigt wird. Man könnte das schnell als bieder abtun, was aber sehr dumm wäre, denn es hat durchaus eine Kraft zur Dämonie, eine Kraft zur mythisch angebundenen Veränderung für manche, die sich gerne mal die „Bewegung“ nennen. Damit sollte man sich auseinandersetzen, und das sind alles Dinge, die für mich eine große Rolle in der Arbeit spielen und warum ich Lust habe, mit so einem Stoff umzugehen.
Groß Worin sehen Sie das Widerstandspotential oder den politischen Kern der Erzählung?
Baumgarten Die dort beschriebene Dresdner Alltagswelt ist klar und überschaubar. Die andere Welt ist eine metaphorische Welt: irgendeine wilde ursprünglichere Natur, eine Urzeitwelt, die wieder zurückkommt und sich in die scheinbar geordnete Zivilisation hineingräbt. Sie hat deutliche Erkennungsmerkmale einer heutigen nordafrikanischen Welt. Es geht da um unverständliche Sprachen und um Aufzeichnung und um Archivierungen ... Vielleicht ein Aufruf zu eigenen Codes, zu einer Geheimsprache, die gegen das globalisierte Denken gerichtet ist und gefährlich wird, weil sie von der Normsprache nicht dechiffriert und aufgesogen werden kann und auf Angriff geschaltet ist. Sowas steckt in dem Material drin, aber eine Kernformel ist immer schwer zu benennen.
Sebastian Baumgarten Das Eine ist, dass es ein Material ist, was mich ganz konkret an den Ort, an dem ich arbeite, anbindet. „Der goldne Topf“ ist eine Dresdner Geschichte - das ist für mich sehr wichtig. Nachdem ich hier schon einige Male gearbeitet habe, ordnen sich ihre Historie, ihre Mentalität und all die Dinge in einen anderen Zusammenhang ein, und die Stadt wird damit ein Stück weit klarer für mich.
Das Zweite ist die außergewöhnliche Sprache, eine Sprache, die man als eine Art Widerstand verstehen kann. Die interessiert mich sehr. Ich bin jemand, der Texte gerne aus einer Aktualität heraus begreift und einen heutigen Gestus sucht, und trotzdem denke ich, dass auf der Bühne in der Spielweise, die ich bevorzuge, eine bestimmte Form von hoher Sprache hilft, mit meinen Spielmitteln umzugehen.
Ein dritter Punkt, der mich interessiert, ist die Zeit: 1795 mit dem Ende der Französischen Revolution und 1848 mit Anfang der bürgerlichen Revolution in Deutschland und der Phase der so genannten deutschen Frühromantik, die sich immer wieder mit den Themen Drogen, Rausch und den Spionen beschäftigt. Das finde ich ein modernes, aktuelles Thema. Da Hoffmann auch noch die virtuelle Ebene mit einbezieht, über das Märchen und die Erfindung einer Geisterwelt, ist man eigentlich in einer gewissen Art und Weise wieder komplett in der Gegenwart angekommen.
Groß Es ist ja kein Stück, sondern ein Prosatext - sogar ein Märchen. Ist es nicht besonders schwer, so etwas auf die Bühne zu bringen?
Baumgarten Für mich ist das einfach ein Material, wo ich mir das raussuche, was mich daran interessiert, und ich nehme mir auch heraus, den Stoff als eine Art Formel zu begreifen, in die ich jetzt die Gegenwart als Variable einsetze - als die Zeit mit unseren Umständen. Dann ist das gar nicht mehr so kompliziert. Im Gegenteil: Der Stoff eignet sich hervorragend, modernes Theater zu machen mit den Mitteln, die uns heute am Theater zur Verfügung stehen: Über verschiedene Medien zu gehen oder auch über eine nicht kontinuierliche Erzählweise nachzudenken.
Groß Das erklärt aber noch nicht den möglicherweise in der Prosa fehlenden dramatischen Grundkonflikt. Was ist der für Sie?
Baumgarten Interessant ist, dass es in der erfundenen Welt, die E. T. A. Hoffmann aufbaut, deutliche Anklänge an eine Welt gibt, mit der wir uns heute auseinander zu setzen haben. Es geht um die Übersetzung von arabischen Schriftzeichen, um Tunis, um feindliche Mächte einer anderen Kultur, es geht um eine Welt von exotischen Pflanzen und Tieren, die durchaus auch unbekannte Gefahren in sich bergen. Man lebt also im sicheren und schönen Dresden, und auf einmal bricht eine andere fundamentalistische Welt im Sinne von Natur, aber auch im Sinne von Politik, in diesen doch relativ geschützten Bereich ein und überfährt ihn.
Groß ... und mündet in dem Bild von Atlantis, einer versunkenen Welt.
Baumgarten Ja, und hier muss man sich bewusst machen, dass man doch auch ein Märchen erzählt und dem Stoff am besten sein Geheimnis lassen sollte. Über Atlantis haben wir sehr viel geredet, und es gibt die unterschiedlichsten Haltungen, Ansichten und Interpretationsvorschläge dazu - von den Schauspielern, von mir, von Bildwelten. Doch genau diesen Punkt versuche ich nicht auszudeuten, weil ich glaube, dass in Atlantis zwischen untergegangenem Reich und Utopie- oder Illusionspunkt alles reindenkbar ist, aber letztendlich bei einem Märchen in den Köpfen des Zuschauers etwas passieren muss. Bei einer normalen Erzählung würde ich sagen: Konkretheit ist das oberste Gebot. Bei einem Märchen aber sind es eher die Mittel, die man benutzt, die nach Konkretheit drängen und nicht so sehr die Grundaussage. Sonst geht das Formelhafte, das Metaphorische, das Modellhafte des Märchens verloren.
Groß Aber Sie verwenden diese Atlantiswelt doch als Gegenbild, ja sogar als Gegenkraft zu einer anderen, eher bürgerlichen Welt?
Baumgarten Für einen altmodischen Dialektiker, als den ich mich ansehe, ist es klar, dass eine Welt nur durch ihre Gegenwelt beschreibbar wird, bzw. die Gegenwelt auch nur dadurch existiert, dass sie in der Welt, in der wir uns befinden, erfunden und behauptet wird. Das bedingt sich gegenseitig, und vielleicht braucht der Mensch auch einfach erfundene Zusatzwelten, die es ermöglichen, seine eigenen Kriterien oder die gesellschaftlichen Kriterien in Frage zu stellen und zu messen an dem, was da als Außen formulierbar ist oder als Fernpunkt oder als Utopiepunkt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dahingehend auch ambivalent bewege zwischen einem katastrophalischen und einem poetischen Ansatz, Atlantis zu lesen und zu interpretieren. Zum einen kommt man bei der Geschichte, die hier erzählt wird, schnell auf die reale Geschichte von Dresden, also auf apokalyptische Bildwelten, wie die Filmdokumente über den Angriff der amerikanischen und britischen Bomber auf Dresden oder die faschistoiden Bilder von germanischen Gewaltvisionen, und andererseits gibt es bei Atlantis immer auch so einen seltsamen Punkt, wo die Poesie (und damit auch das Schreiben) und nicht die Realität alle Möglichkeiten der Kunst eröffnen, das Ganze also etwas positiv Utopistisches hat.
Groß Es handelt sich hier auch um ein Künstlerdrama, wo die Isoliertheit von kunstbegabten Menschen in dieser biedermeierlichen Welt beschrieben wird. Spielt das für Sie eine Rolle? Das Künstlerische, der künstlerische Mensch?
Baumgarten Ich hatte vor kurzem mit einem unserer Schauspieler eine Diskussion über den Film „Avatar“. Es ist immer wieder beeindruckend, dass Erfindungen der Kunst urplötzlich in der Realität Wirklichkeit werden können. Bestimmte Szenarien, die in Hollywood durchgespielt werden, können plötzlich Vorlagen zu realen Terroranschlägen werden usw. Ich kann mich noch gut an meinen ersten James-Bond-Film erinnern. Der hatte - simpel gesagt - ein Gerät, mit dem man verfolgen konnte, wo man lang fahren muss und wo der Andere ist. So ein Gerät habe ich seit gut acht Jahren in meinem Auto. Das ist also Realität gewordene Fiktion. Und dabei ist gar nicht klar, ob die reale Welt die Fiktion nur erfindet, oder ob die Fiktion auch wieder reale Welten abwirft. Das ist ein dialektisches Verhältnis.
Groß Das klingt fast so, als würden Sie den Kunstbegriff als versöhnende Komponente zwischen einer fantastischen und einer realen Welt sehen?
Baumgarten Ich würde es umgekehrt sagen: Ich würde die Künstlerfigur Anselm aus dem „Goldnen Topf“ gern aus dem künstlerisch naiven und dem lieben Jungenbild, der auch gut schreiben kann und viel Fantasie hat, rausholen und sagen: Man hat auch die Möglichkeit, zum Chefideologen aufzusteigen als Künstler. Wenn es stimmt, dass Fiktionen nicht nur Erfindungen der Realität sind, sondern die Fiktionen wiederum auch Realität erfinden, hätte die Hauptfigur Anselm im Stück, zumindest aus Atlantis heraus, durchaus das Potential zum Chefideologen.
Groß Wenn Sie den Begriff des Chefideologen ins Gespräch werfen, dann kommen wir zu einer anderen Schnittstelle, zu den Idealen und den Ideologien. Gibt es Lösungen für die Kunst? Oder ist Kunst wirklich erst dann nützlich, wenn sie zur Ideologie wird, oder geht es um etwas Anderes?
Baumgarten Gut, das sind ja immer Modelle. Ich sehe das als einen gesunden Wettstreit von Ideologien an. Ich glaube, das liberalisierte, das vermittelnde, von allem ein wenig beeinflusste Denken, ist das langweiligste, was keine Entwicklungen voranbringt. Das ist der Ist-Zustand, den wir hier in unserer politischen Demokratie vorfinden, also immer ein kleines Schräubchen drehen und kein Mut zu einer richtigen These. Ich bin jemand, der in einem strukturellen Zusammenhang arbeitet unter bestimmten ökonomischen Bedingungen, unter bestimmten Machtverhältnissen, die ich habe, denen ich ausgesetzt bin. Das sind Verhältnisse, die über Geld beschrieben werden können. Dadurch ist auch die Fiktion beeinflusst und sicher nicht mehr autonom. Kunst und Realität und Künstler und Normalsterblicher, das ist nicht mehr von einander zu trennen. Da sich die Verhältnisse gegenseitig bedingen, bin ich dafür, starke Ideologien zu setzen, sich damit auseinanderzusetzen, den Mut dazu zu haben, gerade im Theater, wo es noch niemanden weh tut, da es immer noch eine behauptete Lebensform ist. Und so halte ich es auch mit dem uns vorliegenden Stoff von E. T. A. Hoffmann in Bezug darauf, was die Haltung zu dieser Stadt betrifft, oder auch zu dem Deutschtum, das darin aufgezeigt wird. Man könnte das schnell als bieder abtun, was aber sehr dumm wäre, denn es hat durchaus eine Kraft zur Dämonie, eine Kraft zur mythisch angebundenen Veränderung für manche, die sich gerne mal die „Bewegung“ nennen. Damit sollte man sich auseinandersetzen, und das sind alles Dinge, die für mich eine große Rolle in der Arbeit spielen und warum ich Lust habe, mit so einem Stoff umzugehen.
Groß Worin sehen Sie das Widerstandspotential oder den politischen Kern der Erzählung?
Baumgarten Die dort beschriebene Dresdner Alltagswelt ist klar und überschaubar. Die andere Welt ist eine metaphorische Welt: irgendeine wilde ursprünglichere Natur, eine Urzeitwelt, die wieder zurückkommt und sich in die scheinbar geordnete Zivilisation hineingräbt. Sie hat deutliche Erkennungsmerkmale einer heutigen nordafrikanischen Welt. Es geht da um unverständliche Sprachen und um Aufzeichnung und um Archivierungen ... Vielleicht ein Aufruf zu eigenen Codes, zu einer Geheimsprache, die gegen das globalisierte Denken gerichtet ist und gefährlich wird, weil sie von der Normsprache nicht dechiffriert und aufgesogen werden kann und auf Angriff geschaltet ist. Sowas steckt in dem Material drin, aber eine Kernformel ist immer schwer zu benennen.
Groß Das Subversive, das Unterlaufende, das Entgrenzende scheint Sie besonders zu interessieren. Auch in Ihrer Bühnensprache bauen Sie konkrete Wirklichkeiten auf, um diese gleich wieder als Simulationen offenkundig zu machen. Also eine Arbeitstechnik, die auf eine ständige Verunsicherung setzt.
Baumgarten Ja, aber das mache ich nicht bewusst. Das sind theatrale Vorgänge. Das bestimmt das Objekt selbst, also die Materie schlägt auf die Vorschläge zurück. Und da ist sowas entstanden. Im Zentrum steht: Wenn ich an einen Stoff herangehe, interessieren mich immer bestimmte philosophische Hintergründe, die mit unserer Realität in Verbindung stehen. Die sind da, ich muss sie nur finden. Da komme ich dann z. B. auf einen Text wie „Agonie des Realen“ von Baudrillard oder auf einen Text von Boris Groys, wo es um Gespenster und Geister geht und die Frage der Neudefinition solcher Begriffe, da ist man dann in einem Sprach- und Zeitbecken unterwegs, das alles zwischen Hoffmann und moderner Philosophie, zwischen dem heutigen Alltag auf der Bühne und dem Alltag eines biedermeierlichen Dresdens möglich macht und gleichzeitig jeweils auch wieder in Frage stellt.
Groß Ist denn der Text von E. T. A. Hoffmann, den man meistens als einfaches, schönes Kunstmärchen abtut, ein Vorläufer von modernem, kritischem Denken?
Baumgarten Manchmal sind die Stoffe klüger als ihre Autoren. Es ist ja seltsam, dass dieser Text, so wie er ist, 1813 in dieser durch Napoleon schwer heimgesuchten Stadt entstanden war. Der Stadt ging es grässlich. Sie war überbevölkert, überlaufen von aus Russland heimkehrenden und geschlagenen Soldaten, sie war epidemisch überzogen. All das hat Hoffmann erlebt, und er schreibt dann aber über ein Tal, in dem ein Geisterfürst Phosphorus sein geheimnisvolles Tun vollzieht, und von der realen Not ist nichts zu hören. Vielleicht hat eben das alles sehr viel mit Dresden zu tun. Denken wir doch an die Zerstörung 1945 und die ewige Diskussion um die Opferrolle Dresdens, bis hin zum Wiederaufbau und der Rekonstruktion der atlantischen Frauenkirche als McDonald’s-Variante ... Es kann sein, dass das ein Zufall ist, dass das Sprache ist, aber wir wissen es eben nicht. Und da ist eben interessant, was Groys über die Gespenster sagt: Das sind Kopien, die sich selbst kopieren, und das Einzige, was man von denen nicht weiß, ist, wann und wo sie wieder auftreten. Und das ist das Gespenstische. Der Geist ist die Operation, die diese Gespenster in Bewegung setzen. Das ist der Motor, ob der jetzt geistig ist oder elektrisch oder solarbetrieben. Das ist das Organische. Man kann es nicht berechnen, nicht beherrschen und dennoch ist es das, was auf das Material einen Rieseneinfluss hat. Dieses Widerauftreten von Begrifflichkeiten.
Ich erinnere mich noch, es gab in den 80er- oder 90er-Jahren mal die Theorie von morphogenetischen Feldern. Das war ein ähnlicher Erklärungsversuch ...
Groß Diese verschiedenen Ebenen und Schichten zeigen Sie auf der Bühne ganz deutlich, vor allem auch mit Elementen wie Video oder Musik. Können Sie zu diesen Elementen was sagen?
Baumgarten Grundsätzlich glaube ich, dass Musik und filmische Elemente sehr grundlegend sind für meine Arbeit, vor allem die Musik. Sie übersetzen ein Gefühl für Rhythmus und schaffen Stimmungen, aber vor allem die Musik hat eben auch die Fähigkeit, Dinge miteinander zu verbinden, die nicht unbedingt zusammengehören. Und da ist sie für mich besonders wichtig. Wobei ich mit einem sehr weiten Begriff von Musik umgehe. Ich arbeite, gemessen an der Realität oder an dem Rhythmus, den die Realität abwirft, gerne auch mit Arbeitsgeräuschen, Alltagsgeräuschen, die einen umgeben.
Groß Sie arbeiten in dieser Inszenierung mit zwei Musikern, einem Live-Musiker am Piano und einem E-Musiker zusammen. Ist das auch wieder Dialektik, jetzt in der Musik?
Baumgarten Das ist wirklich eine luxuriöse Situation. Man hat eben beides. Man hat das Moment des Live-Reagierens, und man hat das Konservenartige. Man hat das Verhältnis eines Instruments, was mit einer gewissen Bürgerlichkeit zusammenhängt, und auf der anderen Seite die Elektronik, die zumindest, was die Technik betrifft, für die Gegenwartsmusik ein bedeutsames Mittel ist. Das widerspricht sich schon mal vom Gestus. Dann können die natürlich auch miteinander interagieren. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit bekommen, dass wir es über die technischen Mittel schaffen, das Klavier in die Elektronik hinein zu binden, wie auch die Elektronik auf das reagiert, was der Pianist an dem Abend macht. Das ist ein interaktives Verfahren.
Groß Aber es ist nicht Musik im eigentlich filmischen Sinne als Background, als emotional färbender Faktor?
Baumgarten Ich mache das bewusst nicht. Mir ist extrem wichtig, dass sich meine Themen übertragen, und dazu versuche ich, Elemente wie Musik oder Film eher aus der jeweiligen situativen Notwendigkeit heraus zu entwickeln und sie möglichst konkret an reale Bezugssysteme anzubinden, z. B. wenn da im Radio Musik läuft, dann soll sie auch als Radiomusik von heute zu erkennen sein.
Groß Aber dennoch gibt es fast kein Videotake, keine Musikstelle, die Sie nicht sofort wieder abbrechen, kontern ...
Baumgarten Das ist richtig. Es ist keine Atmosphäre, sondern ein Gewebe, an dem sich der Abend strukturiert. Ist die Struktur zu eng, dann wird sie zum Dogma, und die Szene fängt an, sich danach zu richten. Also versuche ich vorher schon, die Struktur wieder aufzubrechen.
Groß Nachdem wir die Technik so in den Vordergrund gerückt haben, jetzt die Frage: Was für einen Schauspieler braucht der Regisseur Sebastian Baumgarten?
Baumgarten Es gibt viele Schauspieler, mit denen ich gut arbeiten kann. Ich brauche einen Schauspieler, der Lust hat auf Theatralik und gleichzeitig eine so starke Persönlichkeit besitzt, dass er in den notwendigen Brüchen, also wenn er z. B. gerade nicht mehr Theater spielen soll, noch immer da ist. Und mein Schauspieler muss am Prozesshaften interessiert sein. Ich brauche keine Arbeitsmaschinen, Sprechmaschinen. Ich bin kein Regisseur, der rein auf den Schauspieler setzt. Ich brauche einen Kontext, aber ein Schauspieler hat die Gabe, Dinge erst richtig konkret werden zu lassen. Die Wahrheit ist - da bin ich ganz traditionell - immer konkret. Ich brauche die Reibung, die sich für mich ergibt, wenn ich Dinge sehr konkret ernst nehme, einen Satz, einen Text, einen Zeithinweis, eine Drogeneinnahme, die als lustige Punschtrinkerei abgetan wird. Wenn man das ernst nimmt, dann muss ich mich auch dazu ins Verhältnis setzen, in welcher Welt ist das, in der man permanent Punsch trinkt. Im Stück heißt es dann auch noch, dass das Dresden ist, also nehme ich auch das wieder ernst und versuche, mich mit verschiedensten Realitätsfragmenten durchzuschlagen. Dazu brauche ich einen dialektischen Schauspieler, einen an Brecht geschulten, der aber auch ebenso in der Lage ist, eine psychologische Dimension in eine Figur rein zu bekommen.
Groß Vielleicht nur zur Ergänzung: Sie brauchen Ihre Mitarbeiter ja auch, um Ihre Gedanken ausformulieren zu können, also als Diskussionspartner, als Reibefläche. Es scheint ja so, dass Auseinandersetzung sehr wichtig ist.
Baumgarten Klar, das ist wie ein lautes Denken. Ich glaube, der kommunikative Akt dabei ist extrem wichtig, aber auch das Gefühl für jeden, an dem Ganzen, was man tut, beteiligt zu sein. Davon bin ich natürlich extrem abhängig.
Groß Es wirkt alles wie ein großes Spiel.
Baumgarten Dazu kann ich schwer was sagen, weil ich eigentlich alles so ernst nehme. Für mich ist es meist ziemlich existentiell. Es ist ein irres Ringen, bis man auch nur ansatzweise auf irgendetwas kommt, was eine Selbstentwicklung verspricht, wo man nicht von Ideechen zu Ideechen fort mutiert, sondern wo man sagen kann, das ist ein Kontext, aus dem sich erzählbare Konsequenzen ergeben. Wo man sagen kann, man treibt das an dieser Stelle sogar ein Stückchen weiter und schafft noch eine Ebene mehr.
Groß Ich meinte, trotz dieser intellektuellen Qualen vermittelt sich auf der Bühne eine ganz große und überraschend naive Spielfreude.
Baumgarten Es ist ein interessanter Punkt, dass Theater eben auch Zustände herstellen, dass das Rauschhafte Wärme und Nähe produzieren kann. Das finde ich einen guten Zustand gegenüber der Welt, einen lebbaren Zustand. Es ist nicht der Zustand der dauerhaften Selbstkontrolle, oder auch der wilden Dauerentgrenztheit. Es ist immer die Suche nach der eigenen Grenze in individueller und kollektiver Drogeneinnahme, die Suche nach einem gemeinsamen Level. Das kann man aber nur spielerisch herausfinden.
Baumgarten Ja, aber das mache ich nicht bewusst. Das sind theatrale Vorgänge. Das bestimmt das Objekt selbst, also die Materie schlägt auf die Vorschläge zurück. Und da ist sowas entstanden. Im Zentrum steht: Wenn ich an einen Stoff herangehe, interessieren mich immer bestimmte philosophische Hintergründe, die mit unserer Realität in Verbindung stehen. Die sind da, ich muss sie nur finden. Da komme ich dann z. B. auf einen Text wie „Agonie des Realen“ von Baudrillard oder auf einen Text von Boris Groys, wo es um Gespenster und Geister geht und die Frage der Neudefinition solcher Begriffe, da ist man dann in einem Sprach- und Zeitbecken unterwegs, das alles zwischen Hoffmann und moderner Philosophie, zwischen dem heutigen Alltag auf der Bühne und dem Alltag eines biedermeierlichen Dresdens möglich macht und gleichzeitig jeweils auch wieder in Frage stellt.
Groß Ist denn der Text von E. T. A. Hoffmann, den man meistens als einfaches, schönes Kunstmärchen abtut, ein Vorläufer von modernem, kritischem Denken?
Baumgarten Manchmal sind die Stoffe klüger als ihre Autoren. Es ist ja seltsam, dass dieser Text, so wie er ist, 1813 in dieser durch Napoleon schwer heimgesuchten Stadt entstanden war. Der Stadt ging es grässlich. Sie war überbevölkert, überlaufen von aus Russland heimkehrenden und geschlagenen Soldaten, sie war epidemisch überzogen. All das hat Hoffmann erlebt, und er schreibt dann aber über ein Tal, in dem ein Geisterfürst Phosphorus sein geheimnisvolles Tun vollzieht, und von der realen Not ist nichts zu hören. Vielleicht hat eben das alles sehr viel mit Dresden zu tun. Denken wir doch an die Zerstörung 1945 und die ewige Diskussion um die Opferrolle Dresdens, bis hin zum Wiederaufbau und der Rekonstruktion der atlantischen Frauenkirche als McDonald’s-Variante ... Es kann sein, dass das ein Zufall ist, dass das Sprache ist, aber wir wissen es eben nicht. Und da ist eben interessant, was Groys über die Gespenster sagt: Das sind Kopien, die sich selbst kopieren, und das Einzige, was man von denen nicht weiß, ist, wann und wo sie wieder auftreten. Und das ist das Gespenstische. Der Geist ist die Operation, die diese Gespenster in Bewegung setzen. Das ist der Motor, ob der jetzt geistig ist oder elektrisch oder solarbetrieben. Das ist das Organische. Man kann es nicht berechnen, nicht beherrschen und dennoch ist es das, was auf das Material einen Rieseneinfluss hat. Dieses Widerauftreten von Begrifflichkeiten.
Ich erinnere mich noch, es gab in den 80er- oder 90er-Jahren mal die Theorie von morphogenetischen Feldern. Das war ein ähnlicher Erklärungsversuch ...
Groß Diese verschiedenen Ebenen und Schichten zeigen Sie auf der Bühne ganz deutlich, vor allem auch mit Elementen wie Video oder Musik. Können Sie zu diesen Elementen was sagen?
Baumgarten Grundsätzlich glaube ich, dass Musik und filmische Elemente sehr grundlegend sind für meine Arbeit, vor allem die Musik. Sie übersetzen ein Gefühl für Rhythmus und schaffen Stimmungen, aber vor allem die Musik hat eben auch die Fähigkeit, Dinge miteinander zu verbinden, die nicht unbedingt zusammengehören. Und da ist sie für mich besonders wichtig. Wobei ich mit einem sehr weiten Begriff von Musik umgehe. Ich arbeite, gemessen an der Realität oder an dem Rhythmus, den die Realität abwirft, gerne auch mit Arbeitsgeräuschen, Alltagsgeräuschen, die einen umgeben.
Groß Sie arbeiten in dieser Inszenierung mit zwei Musikern, einem Live-Musiker am Piano und einem E-Musiker zusammen. Ist das auch wieder Dialektik, jetzt in der Musik?
Baumgarten Das ist wirklich eine luxuriöse Situation. Man hat eben beides. Man hat das Moment des Live-Reagierens, und man hat das Konservenartige. Man hat das Verhältnis eines Instruments, was mit einer gewissen Bürgerlichkeit zusammenhängt, und auf der anderen Seite die Elektronik, die zumindest, was die Technik betrifft, für die Gegenwartsmusik ein bedeutsames Mittel ist. Das widerspricht sich schon mal vom Gestus. Dann können die natürlich auch miteinander interagieren. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit bekommen, dass wir es über die technischen Mittel schaffen, das Klavier in die Elektronik hinein zu binden, wie auch die Elektronik auf das reagiert, was der Pianist an dem Abend macht. Das ist ein interaktives Verfahren.
Groß Aber es ist nicht Musik im eigentlich filmischen Sinne als Background, als emotional färbender Faktor?
Baumgarten Ich mache das bewusst nicht. Mir ist extrem wichtig, dass sich meine Themen übertragen, und dazu versuche ich, Elemente wie Musik oder Film eher aus der jeweiligen situativen Notwendigkeit heraus zu entwickeln und sie möglichst konkret an reale Bezugssysteme anzubinden, z. B. wenn da im Radio Musik läuft, dann soll sie auch als Radiomusik von heute zu erkennen sein.
Groß Aber dennoch gibt es fast kein Videotake, keine Musikstelle, die Sie nicht sofort wieder abbrechen, kontern ...
Baumgarten Das ist richtig. Es ist keine Atmosphäre, sondern ein Gewebe, an dem sich der Abend strukturiert. Ist die Struktur zu eng, dann wird sie zum Dogma, und die Szene fängt an, sich danach zu richten. Also versuche ich vorher schon, die Struktur wieder aufzubrechen.
Groß Nachdem wir die Technik so in den Vordergrund gerückt haben, jetzt die Frage: Was für einen Schauspieler braucht der Regisseur Sebastian Baumgarten?
Baumgarten Es gibt viele Schauspieler, mit denen ich gut arbeiten kann. Ich brauche einen Schauspieler, der Lust hat auf Theatralik und gleichzeitig eine so starke Persönlichkeit besitzt, dass er in den notwendigen Brüchen, also wenn er z. B. gerade nicht mehr Theater spielen soll, noch immer da ist. Und mein Schauspieler muss am Prozesshaften interessiert sein. Ich brauche keine Arbeitsmaschinen, Sprechmaschinen. Ich bin kein Regisseur, der rein auf den Schauspieler setzt. Ich brauche einen Kontext, aber ein Schauspieler hat die Gabe, Dinge erst richtig konkret werden zu lassen. Die Wahrheit ist - da bin ich ganz traditionell - immer konkret. Ich brauche die Reibung, die sich für mich ergibt, wenn ich Dinge sehr konkret ernst nehme, einen Satz, einen Text, einen Zeithinweis, eine Drogeneinnahme, die als lustige Punschtrinkerei abgetan wird. Wenn man das ernst nimmt, dann muss ich mich auch dazu ins Verhältnis setzen, in welcher Welt ist das, in der man permanent Punsch trinkt. Im Stück heißt es dann auch noch, dass das Dresden ist, also nehme ich auch das wieder ernst und versuche, mich mit verschiedensten Realitätsfragmenten durchzuschlagen. Dazu brauche ich einen dialektischen Schauspieler, einen an Brecht geschulten, der aber auch ebenso in der Lage ist, eine psychologische Dimension in eine Figur rein zu bekommen.
Groß Vielleicht nur zur Ergänzung: Sie brauchen Ihre Mitarbeiter ja auch, um Ihre Gedanken ausformulieren zu können, also als Diskussionspartner, als Reibefläche. Es scheint ja so, dass Auseinandersetzung sehr wichtig ist.
Baumgarten Klar, das ist wie ein lautes Denken. Ich glaube, der kommunikative Akt dabei ist extrem wichtig, aber auch das Gefühl für jeden, an dem Ganzen, was man tut, beteiligt zu sein. Davon bin ich natürlich extrem abhängig.
Groß Es wirkt alles wie ein großes Spiel.
Baumgarten Dazu kann ich schwer was sagen, weil ich eigentlich alles so ernst nehme. Für mich ist es meist ziemlich existentiell. Es ist ein irres Ringen, bis man auch nur ansatzweise auf irgendetwas kommt, was eine Selbstentwicklung verspricht, wo man nicht von Ideechen zu Ideechen fort mutiert, sondern wo man sagen kann, das ist ein Kontext, aus dem sich erzählbare Konsequenzen ergeben. Wo man sagen kann, man treibt das an dieser Stelle sogar ein Stückchen weiter und schafft noch eine Ebene mehr.
Groß Ich meinte, trotz dieser intellektuellen Qualen vermittelt sich auf der Bühne eine ganz große und überraschend naive Spielfreude.
Baumgarten Es ist ein interessanter Punkt, dass Theater eben auch Zustände herstellen, dass das Rauschhafte Wärme und Nähe produzieren kann. Das finde ich einen guten Zustand gegenüber der Welt, einen lebbaren Zustand. Es ist nicht der Zustand der dauerhaften Selbstkontrolle, oder auch der wilden Dauerentgrenztheit. Es ist immer die Suche nach der eigenen Grenze in individueller und kollektiver Drogeneinnahme, die Suche nach einem gemeinsamen Level. Das kann man aber nur spielerisch herausfinden.



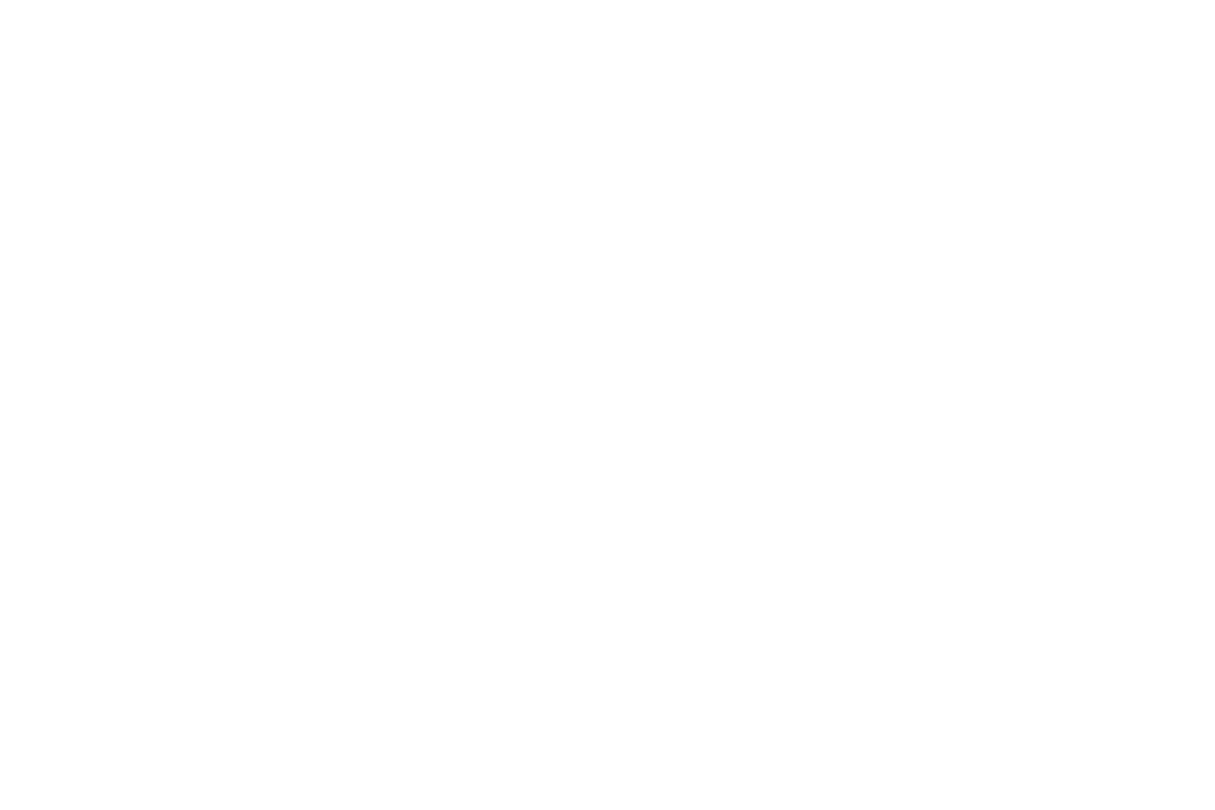



Das Bühnenbild von Kathrin Frosch, die die biedere Beamtenwohnung im Erdgeschoss mit dem Dschungel des Archivars kombiniert, die hervorrangend agierende Technik und vor allem die durchweg überzeugenden Schauspieler unterstützen diesen intellektuellen Parforce-Ritt nach Kräften. Sebastian Wendelin spielt sich als Anselm die Seele aus dem Leib, Wolfgang Michalek als Konrektor und Cathleen Baumann in drei Rollen zeigen ein überzeugendes Spiel am Rande des Wahnsinns und im permanenten Drogenrausch. Torsten Ranft entsteigt als Archivar dem Publikum und wirkt wie aus einer fremden Welt, Picco von Groote und Fabian Gerhardt als Veronika und Registrator Heerbrand bieten bieder das perfekte Paar. Aber das ist sicherlich eine Theaterillusion.“