Uraufführung 19.01.2013
› Schauspielhaus
Der geteilte Himmel
nach der Erzählung von Christa Wolf
Für die Bühne eingerichtet von Felicitas Zürcher und Tilmann Köhler unter Mitarbeit des Ensembles
Für die Bühne eingerichtet von Felicitas Zürcher und Tilmann Köhler unter Mitarbeit des Ensembles
Handlung
Herbst 1961. Rita Seidel erwacht in einem Sanatorium, und langsam fällt ihr alles wieder ein: Der Unfall, das Waggonbau-Werk, in dem sie während der Sommerferien gearbeitet hat, die Brigade, das Lehrerseminar und vor allem Manfred. Manfred ist weggegangen – „abgehauen, Sie verstehen“. Der promovierte Chemiker konnte die Zurücksetzungen durch Parteifunktionäre, Vetternwirtschaft im System und Behinderung seiner Forschung nicht länger akzeptieren und kehrt von einem Kongress in West-Berlin nicht in die DDR zurück. „Ich gebe dir Nachricht, wenn du kommen sollst. Ich lebe nur für den Tag, da du wieder bei mir bist“, schreibt er Rita. Doch für Rita stellt sich die Frage anders. „Den Himmel wenigstens können sie nicht zerteilen“, sagt Manfred beim endgültigen Abschied. Und Rita entgegnet: „Doch. Der Himmel teilt sich zuallererst.“
„Der geteilte Himmel“ erschien 1963, kurz nach dem Bau der Mauer. Christa Wolf spiegelt darin den Prozess, der zu diesem Schritt geführt hat, im Scheitern einer Liebe: an den Bedingungen der Zeit, an den Versuchen der Politik. Sie erzählt von Hoffnungen und Enttäuschungen in einer heute längst vergangenen Zeit und stellt zwei Positionen gegeneinander: „Das ist keine Zeit für Märchen.“ – „Aber wie soll man sich sonst seine Selbstachtung bewahren?“
„Der geteilte Himmel“ erschien 1963, kurz nach dem Bau der Mauer. Christa Wolf spiegelt darin den Prozess, der zu diesem Schritt geführt hat, im Scheitern einer Liebe: an den Bedingungen der Zeit, an den Versuchen der Politik. Sie erzählt von Hoffnungen und Enttäuschungen in einer heute längst vergangenen Zeit und stellt zwei Positionen gegeneinander: „Das ist keine Zeit für Märchen.“ – „Aber wie soll man sich sonst seine Selbstachtung bewahren?“
Besetzung
Regie
Tilmann Köhler
Bühne
Karoly Risz
Kostüme
Susanne Uhl
Musik
Jörg-Martin Wagner
Licht und Video
Michael Gööck
Dramaturgie
Felicitas Zürcher
Das Mädchen Rita Seidel
Lea Ruckpaul
Rita im Krankenhaus
Ina Piontek
Rita Seidel, heute / Frau Herrfurth
Hannelore Koch
Manfred Herrfurth
Ernst Wendland
Rolf Meternagel / Schwarzenbach
Herr Herrfurth / Kuhl
Violine
Maria Stosiek
Video
Ein Gespräch mit Maria Sommer und Gerhard Wolf
Im Januar 2013 wird das Staatsschauspiel Dresden eine Bühnenadaption von Christa Wolfs Erzählung „Der geteilte Himmel“ zur Uraufführung bringen. Maria Sommer, die langjährige Verlegerin Christa Wolfs, lud die Dramaturgie des Staatsschauspiels Dresden zu einem Mittagessen (Pellkartoffeln mit Quark) ein und zum Gespräch mit Gerhard Wolf, selbst viele Jahre Dramaturg, Autor, Verleger – und Ehemann von Christa Wolf.
Frau Dr. Sommer, wie ist es zur Verbindung zwischen Ihrem Verlag – dem Kiepenheuer Bühnenvertrieb – und Christa Wolf gekommen?
Maria Sommer: Wir haben damals den Luchterhand-Verlag in Nonprint-Angelegenheiten vertreten, und Christa Wolf hatte in der BRD ihre Bücher in diesem Verlag.
Gerhard Wolf: Während einer Sitzung der Akademie der Künste, Christa war ja auch Mitglied der West-Akademie, haben wir uns kennengelernt und sind danach in ein Lokal gegangen.
Maria Sommer: Ja, stimmt, Uwe Johnson war dabei. – Das Erste, was ich von Christa Wolf gelesen habe, war „Kindheitsmuster“. Das hat mich schon umgehauen, hat mich absolut betroffen gemacht. Dann „Kassandra“. Das war in Budapest. Ich erinnere mich genau an das kalte Hotelzimmer, in dem ich bei einer Funzelbirne gesessen und gelesen habe, „Kassandra“ gelesen habe …
Herr Wolf, wie war der Weg zur Veröffentlichung des „Geteilten Himmels“?
Gerhard Wolf: Der Lektorin des Luchterhand-Verlags erschien diese Erzählung literarisch nicht gut genug. Im Westen kam das Buch zunächst in einem ganz kleinen Westberliner Verlag heraus und landete dann über Rowohlt schließlich bei dtv. In der DDR erschien „Der geteilte Himmel“ als Vorabdruck in der Zeitschrift „Forum“. Alles lief gut, bis Horst Sindermann, damals Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Halle, eine Kritik schrieb, in der er von Trauer über die deutsche Teilung und von Dekadenz sprach. Zu betont sei die deutsche Teilung – eine Liebe, die daran zerbricht! Es war ein überraschender und heftiger Angriff, der aber keine Rolle mehr spielte, als Konrad Wolf die Erzählung verfilmen wollte. Sindermann lud uns in seine Villa ein, der Film wurde gedreht und alles war gut. Das konnte nur Konrad Wolf erreichen, mit dem wir eng befreundet waren. Bei seinen Filmen „Ich war 19“ und „Der nackte Mann auf dem Sportplatz“ habe ich als Dramaturg gearbeitet. Dramaturgen waren in der DDR ja auch ein wenig ideologische Aufpasser. Sehr absurd, ich als Aufpasser für Konrad Wolf. Das Interesse am „Geteilten Himmel“ entstand über unsere Bekanntschaft.
Für einen Film ist die Struktur der Erzählung – alles geschieht in Rückblenden – recht schwierig. Wie sind Sie damit umgegangen?
Gerhard Wolf: Ja, schwierig. Rückblenden, innere Monologe, Begegnungen, die in der Erinnerung stattfinden, statt des strikten Durcherzählens. Das war ungewöhnlich und bislang im DEFA-Film nicht gemacht worden.
Die Schauspielerin Renate Blume, die die Rolle der Rita spielt, sieht Ihrer Frau ähnlich.
Gerhard Wolf: Finden Sie? Vom Typ vielleicht irgendwie. Für mich ist Manfred, den Eberhard Esche spielt, die bleibendere Figur. Er ist ein skeptischer Mensch. Man hat damals gesagt, er ähnelt mir. Mit dem Typ sympathisiere ich schon sehr.
Rita und Manfred. Ein eigenartiges Paar. Rita ist vom Land, ist naiv. Dann kommt dieser Mann. Wie sehen Sie diese Beziehung?
Gerhard Wolf: Er liebt gerade das Naive an ihr, und sie bewundert seinen Intellekt. Er als Wissenschaftler will eigene Versuche machen und wird daran gehindert. So kommt es zum Grundkonflikt. Für Rita, die vor dem Studium in eine Brigade im Waggonbau geht – eine Brigade in Halle, in der auch wir waren –, gab es eine Vorbildfigur. Dieses Mädchen findet eine Beziehung zu den Arbeitern, zu dem, was sie machen. Zu Meternagel zum Beispiel. Arbeiter wie er wollten – trotz großer Materialschwierigkeiten – gute Arbeit leisten. Es gab unter dem, was man so Diktatur nennt, eine Art sozialistisches Bewusstsein.
Wir waren nur ein Jahr in dieser Brigade. Anfang 1962 sind wir, auch ausgelöst durch die Konflikte mit dem „Geteilten Himmel“, aus Halle weggegangen. Erst später ist mir klar geworden, dass in der Brigade die Ereignisse um den 17. Juni 1953 nicht zur Sprache kamen. Wir hatten Arbeiter kennengelernt, die eine Art individuellen Sozialismus lebten. Trotz aller Schwierigkeiten. In der Figur des Manfred kulminieren alle diese Konflikte. Er ist nicht mehr bereit, sich den Kopf einzurennen, und hofft auf Selbstverwirklichung im anderen Teil Deutschlands.
Frau Dr. Sommer, wie ist es zur Verbindung zwischen Ihrem Verlag – dem Kiepenheuer Bühnenvertrieb – und Christa Wolf gekommen?
Maria Sommer: Wir haben damals den Luchterhand-Verlag in Nonprint-Angelegenheiten vertreten, und Christa Wolf hatte in der BRD ihre Bücher in diesem Verlag.
Gerhard Wolf: Während einer Sitzung der Akademie der Künste, Christa war ja auch Mitglied der West-Akademie, haben wir uns kennengelernt und sind danach in ein Lokal gegangen.
Maria Sommer: Ja, stimmt, Uwe Johnson war dabei. – Das Erste, was ich von Christa Wolf gelesen habe, war „Kindheitsmuster“. Das hat mich schon umgehauen, hat mich absolut betroffen gemacht. Dann „Kassandra“. Das war in Budapest. Ich erinnere mich genau an das kalte Hotelzimmer, in dem ich bei einer Funzelbirne gesessen und gelesen habe, „Kassandra“ gelesen habe …
Herr Wolf, wie war der Weg zur Veröffentlichung des „Geteilten Himmels“?
Gerhard Wolf: Der Lektorin des Luchterhand-Verlags erschien diese Erzählung literarisch nicht gut genug. Im Westen kam das Buch zunächst in einem ganz kleinen Westberliner Verlag heraus und landete dann über Rowohlt schließlich bei dtv. In der DDR erschien „Der geteilte Himmel“ als Vorabdruck in der Zeitschrift „Forum“. Alles lief gut, bis Horst Sindermann, damals Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Halle, eine Kritik schrieb, in der er von Trauer über die deutsche Teilung und von Dekadenz sprach. Zu betont sei die deutsche Teilung – eine Liebe, die daran zerbricht! Es war ein überraschender und heftiger Angriff, der aber keine Rolle mehr spielte, als Konrad Wolf die Erzählung verfilmen wollte. Sindermann lud uns in seine Villa ein, der Film wurde gedreht und alles war gut. Das konnte nur Konrad Wolf erreichen, mit dem wir eng befreundet waren. Bei seinen Filmen „Ich war 19“ und „Der nackte Mann auf dem Sportplatz“ habe ich als Dramaturg gearbeitet. Dramaturgen waren in der DDR ja auch ein wenig ideologische Aufpasser. Sehr absurd, ich als Aufpasser für Konrad Wolf. Das Interesse am „Geteilten Himmel“ entstand über unsere Bekanntschaft.
Für einen Film ist die Struktur der Erzählung – alles geschieht in Rückblenden – recht schwierig. Wie sind Sie damit umgegangen?
Gerhard Wolf: Ja, schwierig. Rückblenden, innere Monologe, Begegnungen, die in der Erinnerung stattfinden, statt des strikten Durcherzählens. Das war ungewöhnlich und bislang im DEFA-Film nicht gemacht worden.
Die Schauspielerin Renate Blume, die die Rolle der Rita spielt, sieht Ihrer Frau ähnlich.
Gerhard Wolf: Finden Sie? Vom Typ vielleicht irgendwie. Für mich ist Manfred, den Eberhard Esche spielt, die bleibendere Figur. Er ist ein skeptischer Mensch. Man hat damals gesagt, er ähnelt mir. Mit dem Typ sympathisiere ich schon sehr.
Rita und Manfred. Ein eigenartiges Paar. Rita ist vom Land, ist naiv. Dann kommt dieser Mann. Wie sehen Sie diese Beziehung?
Gerhard Wolf: Er liebt gerade das Naive an ihr, und sie bewundert seinen Intellekt. Er als Wissenschaftler will eigene Versuche machen und wird daran gehindert. So kommt es zum Grundkonflikt. Für Rita, die vor dem Studium in eine Brigade im Waggonbau geht – eine Brigade in Halle, in der auch wir waren –, gab es eine Vorbildfigur. Dieses Mädchen findet eine Beziehung zu den Arbeitern, zu dem, was sie machen. Zu Meternagel zum Beispiel. Arbeiter wie er wollten – trotz großer Materialschwierigkeiten – gute Arbeit leisten. Es gab unter dem, was man so Diktatur nennt, eine Art sozialistisches Bewusstsein.
Wir waren nur ein Jahr in dieser Brigade. Anfang 1962 sind wir, auch ausgelöst durch die Konflikte mit dem „Geteilten Himmel“, aus Halle weggegangen. Erst später ist mir klar geworden, dass in der Brigade die Ereignisse um den 17. Juni 1953 nicht zur Sprache kamen. Wir hatten Arbeiter kennengelernt, die eine Art individuellen Sozialismus lebten. Trotz aller Schwierigkeiten. In der Figur des Manfred kulminieren alle diese Konflikte. Er ist nicht mehr bereit, sich den Kopf einzurennen, und hofft auf Selbstverwirklichung im anderen Teil Deutschlands.
Also trotz allem noch die Möglichkeit der Hoffnung im Osten. Frau Dr. Sommer, wie sah für Sie diese Zeit aus der Westperspektive aus?
Maria Sommer: Wir hatten das Gefühl, dass uns die furchtbare Zeit des Faschismus nicht mehr so angelastet wurde – dass wir wieder eine Zukunft hatten. Ich weiß, dass wir damals glücklich waren, wenn wir ins Ausland fahren durften und konnten. 1951 oder 1952 stand ich in London vor der Downing Street 10. Und mir sind die Tränen heruntergelaufen.
Dann kamen mit dem Mauerbau die innerdeutschen Grenzkontrollen. Autos wurden durchsucht. Der Kofferraum. Die Sitze. Unter dem Auto. Das konnte doch alles nicht sein innerhalb eines Landes. Eines Volkes. Häufig bin ich deshalb nicht in Ostberlin ins Theater gegangen, ich habe es nicht ertragen. Die Uraufführung der „Mutter Courage“ aber habe ich gesehen. Das muss man sich mal vorstellen.
Herr Wolf, haben Ihre Frau und Sie je daran gedacht, die DDR zu verlassen?
Gerhard Wolf: Ja, in der Zeit der Biermann-Ausbürgerung und bei den Problemen um Christas Poetik-Vorlesungen. Diese Texte waren sehr direkt, Sprengstoff, sodass die Kritik inhaltlich gar nicht auf die zugleich veröffentlichten Erzählungen einging. Anfang der 1960er Jahre war es ja so, dass Menschen die DDR verließen, weil sie bessere Arbeitsbedingungen, bessere Angebote erhielten. Für eine kurze Zeit dachten wir, dass mit dem Mauerbau endlich die Zeit für freiere Auseinandersetzung gekommen wäre. Für eine sehr kurze Zeit. Der Sekretär von Walter Ulbricht aber beendete diese Illusion sehr schnell mit der Aussage: „Wer jetzt nicht für die Diktatur des Proletariats ist, den können wir an der Mauer zerquetschen.“
Vielleicht ist es bei literarischen Figuren überhaupt nicht zulässig, dennoch möchten wir Sie bitten, zu fantasieren, wie die Geschichte von Rita und Manfred bis in die Gegenwart weitergegangen wäre.
Gerhard Wolf: Manfred macht sicher Karriere, vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte. Rita wird studieren. Was danach aus ihr wird, ist völlig offen. Vielleicht wird sie eine Maxie Wander.
Billigen Sie Manfred wirklich eine große Karriere zu?
Maria Sommer: Eine, mit der er zufrieden ist.
Gerhard Wolf: Bei Rita ist eine Phase zu Ende. Aus dem Vollen leben, wie es in „Der geteilte Himmel“ heißt, das würde Manfred, selbst wenn er Karriere macht, nie als Wunsch akzeptieren können. Dazu ist er viel zu skeptisch.
Was ist von heute aus gesehen für Sie der zentrale Aspekt der Erzählung „Der geteilte Himmel“?
Gerhard Wolf: Dass die deutsche Teilung zum ersten Mal relativ gültig – da muss man vorsichtig sein – thematisiert wurde. Ohne den ganzen Humbug, der heute immer in den Vordergrund gestellt wird. „Der geteilte Himmel“ erzählt über die DDR, wie sie wirklich war – mit allen Hoffnungen und Enttäuschungen.
Wie man aber das Gültige der Geschichte, die natürlich historisch sehr bedingt ist, herauskristallisieren und auf dem Theater umsetzen kann, das weiß ich auch nicht.
Hoffnung und Enttäuschung werden ein Ansatz für unsere Annäherung an den „Geteilten Himmel“ sein, die Frage nach der richtigen Gesellschaft. Ist es die Trennung wert, dass Rita erst nach Monaten in der Klinik weiß, dass und warum sie bleiben will? In welchem System aber kann man leben, aus dem Vollen leben?
Maria Sommer: Für meine Generation war dies schon nach dem Krieg eine Frage. Wir dachten damals, dass nun alles anders werden muss. Und dennoch bewegte mich immer das Thema des nicht vorhandenen dritten Weges zwischen den Systemen.
Die Trennung von Familien oder Paaren durch Systeme ist auch heute noch, in einer Zeit der Globalisierung, ein sehr bewegendes Thema. Wo kann, wo will man leben?
Gerhard Wolf: Ja, heute steht das Ökonomische im Vordergrund. Der eine bekommt irgendwo anders Arbeit. Ein neues Beziehungsfeld entsteht. Vielleicht ist der andere gebunden an Heimat, an ein Milieu. Wenn solch eine Ebene in die theatralische Erzählung hineinzubekommen wäre, fände ich das sehr gut. Aus dem Vollen leben wollen, aber aus dem Vollen nicht leben können – wenn man davon etwas in die Atmosphäre des Abends bringen könnte: Rita empfindet am Schluss des Buches ihr Dasein als neue Freiheit. Sie ist selbstständig geworden – ohne Manfred.
Maria Sommer: Wir hatten das Gefühl, dass uns die furchtbare Zeit des Faschismus nicht mehr so angelastet wurde – dass wir wieder eine Zukunft hatten. Ich weiß, dass wir damals glücklich waren, wenn wir ins Ausland fahren durften und konnten. 1951 oder 1952 stand ich in London vor der Downing Street 10. Und mir sind die Tränen heruntergelaufen.
Dann kamen mit dem Mauerbau die innerdeutschen Grenzkontrollen. Autos wurden durchsucht. Der Kofferraum. Die Sitze. Unter dem Auto. Das konnte doch alles nicht sein innerhalb eines Landes. Eines Volkes. Häufig bin ich deshalb nicht in Ostberlin ins Theater gegangen, ich habe es nicht ertragen. Die Uraufführung der „Mutter Courage“ aber habe ich gesehen. Das muss man sich mal vorstellen.
Herr Wolf, haben Ihre Frau und Sie je daran gedacht, die DDR zu verlassen?
Gerhard Wolf: Ja, in der Zeit der Biermann-Ausbürgerung und bei den Problemen um Christas Poetik-Vorlesungen. Diese Texte waren sehr direkt, Sprengstoff, sodass die Kritik inhaltlich gar nicht auf die zugleich veröffentlichten Erzählungen einging. Anfang der 1960er Jahre war es ja so, dass Menschen die DDR verließen, weil sie bessere Arbeitsbedingungen, bessere Angebote erhielten. Für eine kurze Zeit dachten wir, dass mit dem Mauerbau endlich die Zeit für freiere Auseinandersetzung gekommen wäre. Für eine sehr kurze Zeit. Der Sekretär von Walter Ulbricht aber beendete diese Illusion sehr schnell mit der Aussage: „Wer jetzt nicht für die Diktatur des Proletariats ist, den können wir an der Mauer zerquetschen.“
Vielleicht ist es bei literarischen Figuren überhaupt nicht zulässig, dennoch möchten wir Sie bitten, zu fantasieren, wie die Geschichte von Rita und Manfred bis in die Gegenwart weitergegangen wäre.
Gerhard Wolf: Manfred macht sicher Karriere, vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte. Rita wird studieren. Was danach aus ihr wird, ist völlig offen. Vielleicht wird sie eine Maxie Wander.
Billigen Sie Manfred wirklich eine große Karriere zu?
Maria Sommer: Eine, mit der er zufrieden ist.
Gerhard Wolf: Bei Rita ist eine Phase zu Ende. Aus dem Vollen leben, wie es in „Der geteilte Himmel“ heißt, das würde Manfred, selbst wenn er Karriere macht, nie als Wunsch akzeptieren können. Dazu ist er viel zu skeptisch.
Was ist von heute aus gesehen für Sie der zentrale Aspekt der Erzählung „Der geteilte Himmel“?
Gerhard Wolf: Dass die deutsche Teilung zum ersten Mal relativ gültig – da muss man vorsichtig sein – thematisiert wurde. Ohne den ganzen Humbug, der heute immer in den Vordergrund gestellt wird. „Der geteilte Himmel“ erzählt über die DDR, wie sie wirklich war – mit allen Hoffnungen und Enttäuschungen.
Wie man aber das Gültige der Geschichte, die natürlich historisch sehr bedingt ist, herauskristallisieren und auf dem Theater umsetzen kann, das weiß ich auch nicht.
Hoffnung und Enttäuschung werden ein Ansatz für unsere Annäherung an den „Geteilten Himmel“ sein, die Frage nach der richtigen Gesellschaft. Ist es die Trennung wert, dass Rita erst nach Monaten in der Klinik weiß, dass und warum sie bleiben will? In welchem System aber kann man leben, aus dem Vollen leben?
Maria Sommer: Für meine Generation war dies schon nach dem Krieg eine Frage. Wir dachten damals, dass nun alles anders werden muss. Und dennoch bewegte mich immer das Thema des nicht vorhandenen dritten Weges zwischen den Systemen.
Die Trennung von Familien oder Paaren durch Systeme ist auch heute noch, in einer Zeit der Globalisierung, ein sehr bewegendes Thema. Wo kann, wo will man leben?
Gerhard Wolf: Ja, heute steht das Ökonomische im Vordergrund. Der eine bekommt irgendwo anders Arbeit. Ein neues Beziehungsfeld entsteht. Vielleicht ist der andere gebunden an Heimat, an ein Milieu. Wenn solch eine Ebene in die theatralische Erzählung hineinzubekommen wäre, fände ich das sehr gut. Aus dem Vollen leben wollen, aber aus dem Vollen nicht leben können – wenn man davon etwas in die Atmosphäre des Abends bringen könnte: Rita empfindet am Schluss des Buches ihr Dasein als neue Freiheit. Sie ist selbstständig geworden – ohne Manfred.
Der unsichere Boden der Erinnerung
Erinnerung ist ein Thema, das Christa Wolf begleitet hat. Immer wieder finden sich in ihren Erzählungen Figuren, die sich erinnern, die aus der Distanz auf ihr eigenes oder auf ein anderes Leben blicken. Schon im „Geteilten Himmel“, diesem relativ frühen Werk, führt Christa Wolf mit dem Moment der Erinnerung eine Ebene der Distanzierung in ihre Erzählung ein. Man folgt dem Mädchen Rita Seidel in ihrem Aufbruch in ein neues Leben, in ihrem Erwachsenwerden und in ihrer Politisierung, aber man blickt aus der Erinnerung der verunfallten, der kranken Rita darauf, die sich ihre Erlebnisse vergegenwärtigt und nicht umhin kommt, sich Fragen zu stellen: War das richtig, was ich getan habe? Sind die Kriterien richtig, anhand derer ich meine Entscheidung getroffen habe?
Christa Wolf schrieb diese Erzählung 32jährig, angefüllt mit Erlebnissen von ihrem Einsatz in der Produktion und ganz und gar überzeugt von der jungen DDR und den Zielen dieses Staates. An der Oberfläche ist der Text denn auch ein deutliches Bekenntnis zum Sozialismus und der DDR. Aber obwohl Christa Wolf ganz klar Position bezieht, obwohl Rita zahlreiche gute Sozialisten begegnen, denen es ernst ist mit den Werten, die sie verkörpern, liegen der Erzählung doch deutlich systemkritische Momente zugrunde. Das ist nicht nur die große Sympathie, die dem Republikflüchtling Manfred Herrfurth entgegengebracht wird, es sind nicht nur die Missstände wie Materialmangel oder Parteiwillkür, die offen angesprochen werden, es ist auch die Zukunft, der die positiven Identifikations-Figuren entgegenschauen: Rolf Meternagel, ehemaliger Meister im Waggonwerk, der sich aufreibt für seine Arbeit, für den volkseigenen Betrieb, der seine Kollegen zu selbstverantwortlichem, effizientem Arbeiten und Überbietung der Norm antreibt, er wird am Ende zusammenbrechen und halbtot darniederliegen. Dass er sich erholen wird, glaubt nicht mal er selber. Und Ernst Wendland, der junge Betriebsleiter im Werk, der die Planerfüllung erreicht, allerdings mit ungewöhnlichen Methoden, er schaut einer Zukunft zwischen Schikane und Bespitzelung entgegen. Nicht zuletzt aber ist es die Deutlichkeit, mit der Christa Wolf die Unmöglichkeit der Entscheidung darstellt, die von Rita verlangt wird, und die sie auch trifft. Allen Beteuerungen, dass sie gesund sei, zum Trotz: Diese junge Frau wird nie mehr ganz werden. Sie muss einen Teil von sich verleugnen – ebenso wie Manfred, der wahrscheinlich ebenso wenig glücklich werden wird im Westen. Beide sind zwar in der Lage, ein Ziel zu verfolgen – der eine in der Wissenschaft, die andere für die Gesellschaft – einen ganzen Menschen wird es aber aus den beiden nicht mehr machen.
Die Fragen, die sich Rita im Krankenhaus stellt, sind im Jahr 1963, mitten im Kalten Krieg, nicht nur persönliche, sondern ungemein politische Fragen: „Ist denn die Welt überhaupt mit unserem Maß zu messen? Mit Gut und Böse? Ist sie nicht einfach da – weiter nichts? Und dann wäre es ganz sinnlos, dass ich nicht bei ihm geblieben bin. Dann wäre jedes Opfer sinnlos.“
Christa Wolf schrieb diese Erzählung 32jährig, angefüllt mit Erlebnissen von ihrem Einsatz in der Produktion und ganz und gar überzeugt von der jungen DDR und den Zielen dieses Staates. An der Oberfläche ist der Text denn auch ein deutliches Bekenntnis zum Sozialismus und der DDR. Aber obwohl Christa Wolf ganz klar Position bezieht, obwohl Rita zahlreiche gute Sozialisten begegnen, denen es ernst ist mit den Werten, die sie verkörpern, liegen der Erzählung doch deutlich systemkritische Momente zugrunde. Das ist nicht nur die große Sympathie, die dem Republikflüchtling Manfred Herrfurth entgegengebracht wird, es sind nicht nur die Missstände wie Materialmangel oder Parteiwillkür, die offen angesprochen werden, es ist auch die Zukunft, der die positiven Identifikations-Figuren entgegenschauen: Rolf Meternagel, ehemaliger Meister im Waggonwerk, der sich aufreibt für seine Arbeit, für den volkseigenen Betrieb, der seine Kollegen zu selbstverantwortlichem, effizientem Arbeiten und Überbietung der Norm antreibt, er wird am Ende zusammenbrechen und halbtot darniederliegen. Dass er sich erholen wird, glaubt nicht mal er selber. Und Ernst Wendland, der junge Betriebsleiter im Werk, der die Planerfüllung erreicht, allerdings mit ungewöhnlichen Methoden, er schaut einer Zukunft zwischen Schikane und Bespitzelung entgegen. Nicht zuletzt aber ist es die Deutlichkeit, mit der Christa Wolf die Unmöglichkeit der Entscheidung darstellt, die von Rita verlangt wird, und die sie auch trifft. Allen Beteuerungen, dass sie gesund sei, zum Trotz: Diese junge Frau wird nie mehr ganz werden. Sie muss einen Teil von sich verleugnen – ebenso wie Manfred, der wahrscheinlich ebenso wenig glücklich werden wird im Westen. Beide sind zwar in der Lage, ein Ziel zu verfolgen – der eine in der Wissenschaft, die andere für die Gesellschaft – einen ganzen Menschen wird es aber aus den beiden nicht mehr machen.
Die Fragen, die sich Rita im Krankenhaus stellt, sind im Jahr 1963, mitten im Kalten Krieg, nicht nur persönliche, sondern ungemein politische Fragen: „Ist denn die Welt überhaupt mit unserem Maß zu messen? Mit Gut und Böse? Ist sie nicht einfach da – weiter nichts? Und dann wäre es ganz sinnlos, dass ich nicht bei ihm geblieben bin. Dann wäre jedes Opfer sinnlos.“
Rita entscheidet sich für die Richtigkeit ihrer Kriterien und geht den Weg weiter, den sie verfolgt. Wenn sie sich am Anfang des Romans entschließt: „Ich werde Lehrerin!“, so wird sie am Ende nach ihrem „Genesungsprozess“ sagen: „Ich werde die Kinder vor solchen Vätern schützen.“ Heute, nach dem Ende der ddr und dem Zusammenbruch des sozialistischen, des kommunistischen Systems, stellt sich die Frage nach gut und böse, die Frage nach den Kriterien für Ritas Entscheidung noch einmal anders.
Erinnerung ist auch das Thema, dem sich Christa Wolf in ihrem letzten großen Text „Stadt der Engel“ stellt. Sie reflektiert darin – 40, 50 Jahre später und in den USA – ihr Verhältnis zu ihrem Staat, den sie mit aufgebaut und in aller Kritik immer unterstützt hat, sie untersucht schonungslos, akribisch und wie gehäutet. Darin kann sie als Verwandte, als Verlängerung der Rita Seidel gesehen werden, die sich dieselben Fragen stellt. Diese aus der relativ geringen Distanz des Krankenhausbettes und dem kurzem Abstand von zwei Jahren, jene aus der großen Distanz eines halben Jahrhundert und in den USA. Der Boden, auf dem sich diese Erinnerung vollzieht, wird dabei immer schwankender: „Ich weiß ja, was ich von meinem Gedächtnis zu halten habe“, heißt es in „Stadt der Engel“, und: „Nicht immer sind die Tatsachen gegenüber den Gefühlen im Recht.“
Die Frage der Erinnerung und des Blickwinkels stellt sich notwendigerweise, wenn man sich heute, mehr als 20 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR, einem Stoff wie dem „Geteilten Himmel“ annimmt. Vor der Folie des Scheiterns dieses Systems liest sich der Traum einer lebenswerteren Gesellschaft anders.
Der Zweite Weltkrieg entlässt im „Geteilten Himmel“ Mitläufer, Opfer und Täter, die gemeinsam mit den Nachgeborenen einen neuen Gesellschaftsentwurf zu verwirklichen suchen, so wie es hier und heute, 2013 in Dresden, die Mitläufer, die Täter, die Opfer des vergangenen Systems gibt, die sich in einem neuen System zurecht finden mussten und müssen. Und ebenso gibt die Nachgeborenen, die mit diesem Erbe umzugehen haben. Dass die Suche heutzutage nach einer besseren, gerechteren, menschenwürdigeren Gesellschaft als der aktuellen so schwierig ist, hängt auch zusammen mit dem Scheitern des letzten Versuches.
Felicitas Zürcher
Erinnerung ist auch das Thema, dem sich Christa Wolf in ihrem letzten großen Text „Stadt der Engel“ stellt. Sie reflektiert darin – 40, 50 Jahre später und in den USA – ihr Verhältnis zu ihrem Staat, den sie mit aufgebaut und in aller Kritik immer unterstützt hat, sie untersucht schonungslos, akribisch und wie gehäutet. Darin kann sie als Verwandte, als Verlängerung der Rita Seidel gesehen werden, die sich dieselben Fragen stellt. Diese aus der relativ geringen Distanz des Krankenhausbettes und dem kurzem Abstand von zwei Jahren, jene aus der großen Distanz eines halben Jahrhundert und in den USA. Der Boden, auf dem sich diese Erinnerung vollzieht, wird dabei immer schwankender: „Ich weiß ja, was ich von meinem Gedächtnis zu halten habe“, heißt es in „Stadt der Engel“, und: „Nicht immer sind die Tatsachen gegenüber den Gefühlen im Recht.“
Die Frage der Erinnerung und des Blickwinkels stellt sich notwendigerweise, wenn man sich heute, mehr als 20 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR, einem Stoff wie dem „Geteilten Himmel“ annimmt. Vor der Folie des Scheiterns dieses Systems liest sich der Traum einer lebenswerteren Gesellschaft anders.
Der Zweite Weltkrieg entlässt im „Geteilten Himmel“ Mitläufer, Opfer und Täter, die gemeinsam mit den Nachgeborenen einen neuen Gesellschaftsentwurf zu verwirklichen suchen, so wie es hier und heute, 2013 in Dresden, die Mitläufer, die Täter, die Opfer des vergangenen Systems gibt, die sich in einem neuen System zurecht finden mussten und müssen. Und ebenso gibt die Nachgeborenen, die mit diesem Erbe umzugehen haben. Dass die Suche heutzutage nach einer besseren, gerechteren, menschenwürdigeren Gesellschaft als der aktuellen so schwierig ist, hängt auch zusammen mit dem Scheitern des letzten Versuches.
Felicitas Zürcher

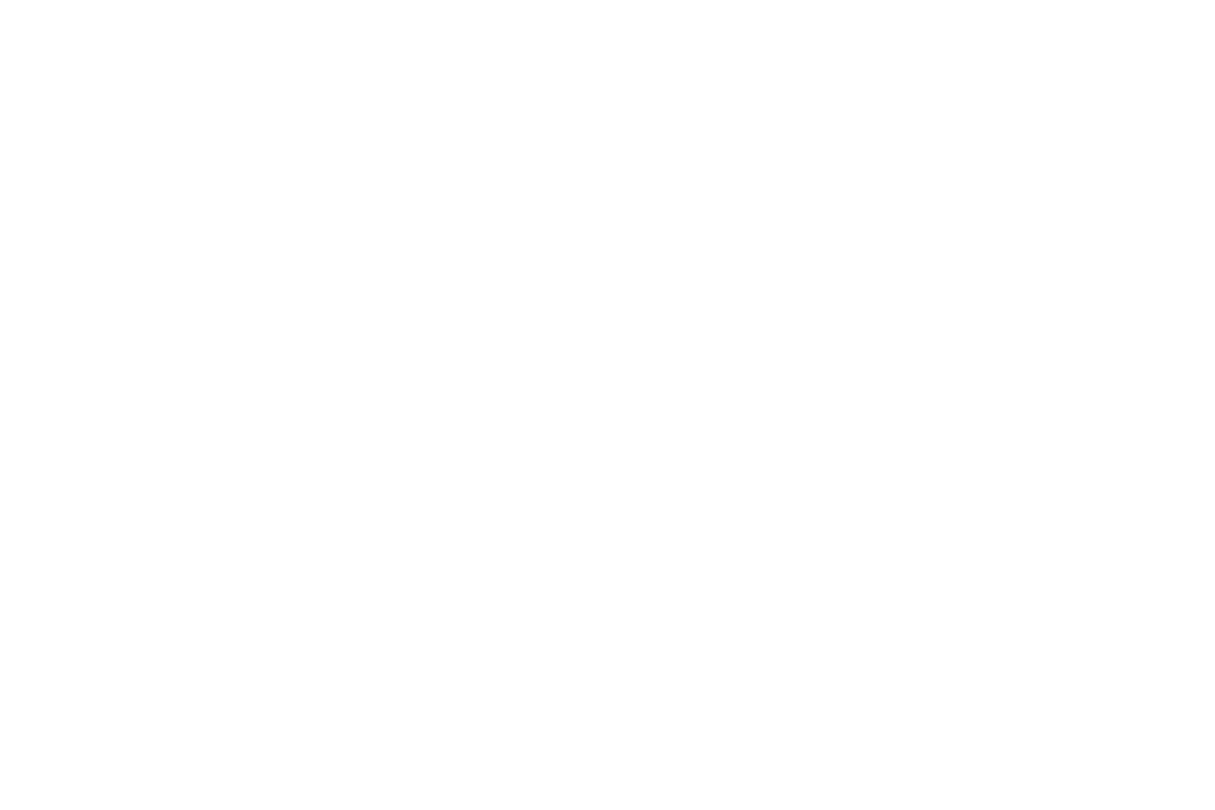

Das liegt auch an den Schauspielern. Hier beweist Köhler Mut in der Wahl seiner Hauptdarstellerin. Lea Ruckpaul als Rita Seidel ist Schauspielstudentin in Leipzig und wirkt so energisch wie eine Feder, die das Uhrwerk der Inszenierung antreibt. Da mischen sich Naivität und Klugheit, Charme und Frechheit zu jenem Ausdruck, der das Mädchen Rita durch den ‚Geteilten Himmel‘ trägt. Und auch Matthias Reichwald gibt Manfred Herrfurth jene nachdenklich-skeptische Aura, die sein Handeln erzwingt. Der Regisseur, um die Schwierigkeit der Dramatisierung einer Romanvorlage wissend, hat Rita Seidel gleich noch weiter multipliziert. Annika Schilling ist das Mädchen Rita im Krankenhaus und Hannelore Koch Rita als ältere Dame, die zurückschaut und von jener Stadt erzählt, über der sich der Himmel teilt. Er teilt sich immer, wenn eine Liebe zu Ende geht.“
Köhler hat eine Suche nach verlorenen Illusionen inszeniert. Sicher, die Liebe von Manfred und Rita scheitert, weil er sich entschließt, ein Jobangebot im Westen anzunehmen, wo dem Chemiker die Schwierigkeiten wegorganisiert werden, die ihm im Osten den letzten Nerv rauben. Und weil sich die junge Rita entschließt, ihm nicht zu folgen, sondern sich für ihre Arbeit im Waggonbau Halle und ihre Zukunft als Lehrerin entscheidet. Das hat auch mit dem Mauerbau zu tun, der diese Entscheidungen zementiert. Aber nicht nur. Köhler gelingt es, weder die Utopie zu denunzieren noch aus Manfreds Pessimismus und Lebensanspruch eine alternative Klarsicht zu machen. Seine Stärke besteht darin, der zeitlosen Suche der Jüngeren nach dem inneren Antrieb, dem eigenen Selbstverständnis und dem Anspruch an das Leben nachzuspüren. Damit wird dieses Stück aus der Zeit des Mauerbaus auch zu einem von heute.
Sein bester Einfall ist die Verdreifachung der Rita. Die älteste (Hannelore Koch) führt wie ein Alter Ego der Autorin (und mit Passagen aus ihrem späten Lebensresümee ‚Stadt der Engel‘) in die Geschichte ein. Sie liefert fortan eine rückblickende Abgeklärtheit. Als junge Verliebte erweist sich die blutjunge Lea Ruckpaul als Idealbesetzung. Die Rita im Krankenhaus, nach dem Selbstmordversuch (aus deren Perspektive Christa Wolf erzählt) ist auch bei Annika Schilling noch sehr jung, aber durch eine zentrale Verlust-Erfahrung eingedunkelt. Als Manfred macht Matthias Reichwald den Glücks- und Lebensanspruch des Chemikers vital deutlich, aber auch seine innere Zerrissenheit und seine Liebe zu Rita glaubhaft. Albrecht Goette und Hannelore Koch bieten als seine Eltern klar konturierte Reibungsflächen. Ahmad Mesgarha, Philipp Lux und Albrecht Goette statten Ritas väterlichen Brigade-Freund Meternagel, den redlichen Aufsteiger Wendland und den Dauernörgler Kuhl als personifizierten sozialistischen Betriebsalltag im Waggonbau Halle-Ammendorf auch mit einer Portion von komödiantischen Witz aus.“
Freilich, das comichafte, plakative Skizzieren der realsozialistisch üblen Zustände, die überhaupt antipsychologische Spielweise offenbaren kühl das tragödienhafte Konstrukt des Romans und gehen zulasten der Einfühlung ins Liebesleben seiner Protagonisten. Dies wirft aber unaufdringlich ein etwas anderes Licht auf Christa Wolf: ‚Der geteilte Himmel‘ nicht als sentimentales Rührstück mit korrekter Durchhalteparole (der sich die Autorin selbst lebenslang qualvoll aussetzte). Und nicht nur als Warnbild vor dem zerstörerischen Stalinismus. Sondern als unerhörte frühe, tieftraurige Grablegung einer schönen Idee. Ein verständnisvoll kopfschüttelnder Blick der ums Verstehen ringenden Enkel auf die bis heute wehenden Schmerzen der Altvorderen.
Tilmann Köhlers Zurücktasten ins Dunkel passt sich auf sehr besondere, poetisch sezierende, dabei pointiert komödiantische Art ein in die Programmatik des Dresdner Intendanten Wilfried Schulz.“
Tilman Köhler macht Theater, zugleich kräftiges wie zartes Menschentheater voller poetischer und sinnlicher Bilder.“
Tilman Köhler macht Theater, zugleich kräftiges wie zartes Menschentheater voller poetischer und sinnlicher Bilder. Dabei rückt er den Figuren mit den Fragen von einst und heute richtig auf den Leib. Er nutzt die Erzählkonstruktion des Romans, in der die junge Rita nach einem Selbstmordversuch oder Unfall in der Klinik ihr bisheriges Leben durchdenkt und durchleidet. So liegen anfangs unterm Stoffbahnen-Himmel zwei Ritas. Eine, die aufsteht und in die Vergangenheit schaut, und eine jüngere, die diese Vergangenheit nun vorspielt.
Zuvor aber konfrontiert uns eine dritte, ältere und eher heutige Rita mit Sätzen der Autorin, die diese nach der Wende in ‚Stadt der Engel‘ formulierte. ‚Wie man es erzählen kann, so ist es nicht gewesen‘, heißt es da. Und: ‚Nicht immer sind die Tatsachen gegenüber den Gefühlen im Recht.‘ Die Inszenierung tut genau dies: Sie nimmt die Gefühle der Menschen ernst, ohne sie, wie Christa Wolf, allzu schematisch (und politisch austariert) vor allem von der gesellschaftlichen Situation bestimmen zu lassen.
Die Schauspieler des bewundernswert starken Ensembles fügen sich zu Gruppenarrangements auf leerer Bühne, und die Szenen fließen unaufgeregt ineinander.
Rita und Manfred finden sich in stiller, intensiver Szene auf leerer Bühne. Wunderbar, wie die erst 25-jährige Lea Ruckpaul ihre Rita als einen jungen Menschen in der Entwicklung spielt: staunend, lernend, zupackend, sich reibend an Widersprüchen. Und Matthias Reichwald zeichnet Manfred als einen verhärteten, an seinen reaktionären Eltern wie den gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten resignierenden, nihilistischen Mann.
Wie alle Figuren (Mitläufer, Altnazi, Überzeugte) in ihren Widersprüchen und Brüchen charakterisiert werden, ohne als erklärende Klischees zu versimpeln, macht die Inszenierung zum Ereignis. Die Gesellschaft, sie ist kompliziert und auch ungerecht. Aber die Menschen sind es, die etwas wollen und sich entscheiden müssen. Rita will etwas, und ihre unbedingte Liebe scheitert daran. Weil sie Manfred nicht in den Westen folgt - und der Mauerbau ihre Entscheidung endgültig macht.
In Dresden ist ein starker, poetisch-politischer Theaterabend zu bewundern.“
Dresdens ‚Geteilter Himmel‘ ist ein sehr phantasievoller Abend. Denn: Das Inszenierungsteam, in dem auch die sieben Schauspieler zur Textfassung beitrugen, erfand eine Bühnenausstattung, Spielbilder und -Situationen, die die oft nüchterne Bühnenform des Erzähltheaters nach literarischen Vorlagen – immens vitalisiert.
Tilmann Köhler und sein Bühnenteam haben für das Scheitern einer Liebe in der Zeit des Mauerbaus einen ideenreichen Inszenierungsstil gefunden, der allem gerecht wird: Den stillen Momenten, den glücklichen, den traurigen, den lauten wie den nachdenklichen. Köhler vertraut dem vor 50 Jahren veröffentlichten Text Christa Wolfs und ergänzt ihn nur durch lebensbilanzierende Sätze der Autorin selbst, entliehen ihrem letzten zu Lebzeiten erschienenen Buch ‚Stadt der Engel‘, in dem sie kritisch fragt, ob das Erzählte dem Geschehenen gerecht wird und ob Tatsachen gegenüber dem Gefühl im Recht sein können.
Das Beeindruckende an Köhlers Regie ist für mich, dass er tatsächlich beide Lebensentwürfe – den Ritas und Manfreds gleichberechtigt erzählt und es dem Zuschauer überlässt, für wen er Sympathie oder Ablehnung empfindet. Um die Entscheidung geht es – und damit kommt die Inszenierung im Heute an, denn entscheiden müssen wir uns immer – zwischen Realität und Ideal.“
Das ist mit großer Kraft auch gegen Christa Wolf erzählt, als Geschichte einer an ihren (totalitären) Unbedingtheitsansprüchen scheiternden Liebe, die Köhler und seine Schauspieler Lea Ruckpaul und Matthias Reichwald auch immer wieder in kraftvolle Körperbilder übersetzen:
Manfred und Rita, die sich ineinander verkeilen, wie Yin und Yang, sich gegeneinander werfen oder ineinander kriechen. Rita, die das klastrophobische Liebes-Bild einer einzige Haut für zwei Menschen formuliert; Manfred, der den Pullover, den er trägt einmal auch über Rita streift, um seinen Besitzanspruch geltend zu machen. Und sie am Ende trotzdem verliert.“
Sie waren verschieden. Deshalb die drei Bühnen-Ritas. Die sehr junge Lea Ruckpaul spielt eine sehr junge Rita, die sich zwischen Manfred und Heimat entscheiden muss. Und wie Ruckpaul ihre Figur von aller pummeligen Naivität frei hält und dennoch unbedingt lieben lässt – das gibt dieser Figur Größe. Annika Schilling dagegen als ältere Rita, die ihre Entscheidung noch vor sich selbst rechtfertigen muss: eine Figur mit Zweifelattacken. Und Hannelore Koch als Rita von heute: eine Frau die ihre Geschichte zwar versteht, aber befragt. Sehr von Vorteil ist, dass Köhler das Ringen seiner Figuren ernst nimmt, ohne sie moralische Urteile fällen zu lassen. Dass er mit Matthias Reichwald einen Manfred hat, der nicht nur an der DDR, sondern am Lauf des Lebens generell verzweifelt, dass die Spieler sich in ihre Figuren hineindenken, ohne sie zu verteidigen. Köhler schält aus der Vorlage eine Lebenskrisengeschichte heraus, die auf das Großexistenzielle geeicht ist.
Dieses Buch wollte an Illusionen glauben machen, wollte verkünden, dass der DDR-Sozialismus trotz Mauerbau zu retten sei. Es glaubten viele offenbar. Aber warum?
Das sind heute die entscheidenden Fragen, und Tilmann Köhler stellt sie. Er lässt in seinen zwei Stunden lauter Luftballons platzen, er treibt die Illusionen auf den Verpuffungspunkt, die Figuren über die Grenzen ihrer Gefühle hinaus – in jene zugige Gegend, in der das Erinnern seine wollige Harmonie, seine Selbstschutzwärme verliert. Wir werden uns künftig eben dort aufzuhalten haben, wenn wir wissen wollen, was war und was bleibt – auch das legt die Inszenierung nahe. Und wie weiter jetzt? Es hieße vielleicht, genauer, skeptischer zu erinnern, nicht nach den (geplatzten) Illusionen zu fragen, sondern nach der Sehnsucht, ihnen glauben zu wollen.“
Auf der mit einem Tuch weiß verhangenen Spielfläche (Bühne: Karoly Risz) mit mal eng, mal weit gespanntem Leinwandhimmel agiert ein durchweg großartiges Ensemble von sieben Schauspielern.
Die Heldin des Stückes, Rita Seidel, wird in unterschiedlichen Lebensabschnitten von verschiedenen Schauspielerinnen dargestellt. Im rosaroten Pulli und Minirock, voller Träume und Ideale von einer besseren und gerechteren Welt für alle, spielt Lea Ruckpaul (noch Studentin im Schauspielstudio) diese Rita ebenso naiv wie hartnäckig und selbstbewusst. Die inneren Zwiespälte und Zweifel der nach einem Unfall im Krankenhaus liegenden Rita, ob sie ihren Ideen oder ihrer Liebe in den Westen folgen soll, verkörpert berührend Annika Schilling. Als reife , nachdenkliche Rita, Erzählerin und selbstsüchtige Mutter von Ritas Freund, brilliert Hannelore Koch. Die Figurenzeichnung bleibt erfreulich frei von gängigen DDR-Klischees. Gezeigt werden individuelle Charaktere, die um ihren Platz im Leben ringen. Und die Fragen nach Prioritäten im Leben, die sich ihnen stellen, stellen sich auch heute noch: Liebe oder Job, Karriere oder Freundschaft.
Als schmerzlich desillusionierter und in den Westen fliehender Freund Ritas überzeugt Matthias Reichwald. Philipp Lux erheitert das Publikum als linkisch agitatorischer Werkleiter, als übereifriger und zunehmend frustrierter Meister tritt Ahmad Mesgarha auf, während Albrecht Goette als alter Prolet absurde Sprüche klopft. Langanhaltender Beifall zur Premiere.“
Die Aufführung wird geprägt von einer tiefen Auseinandersetzung mit dem Stoff in allen seinen – uns ja bekannten – Auswirkungen und dem Mut, grenzenlose Fantasie walten zu lassen.
Auf der Bühne wird von Leben erzählt, gleichberechtigt stehen individuelle Entwürfe nebeneinander. Es gelingt eine Auseinandersetzung mit totalitären Ansprüchen und mit einer Zeit, die nachwirkt. Doch darüber hinaus vollbringt diese Roman-Inszenierung das kleine Wunder, die Geschichte weiterzuführen auf eine Basis, die jeden angeht: Die Entscheidung zwischen Anspruch, Ideal und Wirklichkeit wird niemals vertagt. Der Himmel teilt sich täglich.“