Uraufführung 01.10.2011
› Schauspielhaus
Das steinerne Brautbett
nach dem Roman von Harry Mulisch
Deutsch von Gregor Seferens
Für die Bühne eingerichtet von Stefan Bachmann und Felicitas Zürcher
Deutsch von Gregor Seferens
Für die Bühne eingerichtet von Stefan Bachmann und Felicitas Zürcher
Handlung
Dresden 1956. In der jungen, aufstrebenden DDR findet ein internationaler Zahnarztkongress statt, zu dem Teilnehmer aus Ost und West eingeladen sind. Auch Norman Corinth aus den usa ist Gast in Dresden. Doch obwohl der Amerikaner das erste Mal auf deutschem Boden steht, ist er nicht das erste Mal in Deutschland: Als Bomberpilot war er am 13. Februar 1945 an der Zerstörung Dresdens beteiligt und wurde dabei abgeschossen. Am Rande des Kongresses macht er sich an die Erkundung der Vergangenheit und trifft dabei auf lauter andere Versehrte. Mit der Eroberung Hellas, Dolmetscherin des Kongresses, wiederholt er dabei Angriff und Zerstörung Dresdens auf privater Ebene.
Mit unbestechlichem Blick zeigt Harry Mulisch die Verwundung der Menschen durch den Krieg, und zwar auf beiden Seiten, und stellt so die Frage nach Opfern und Tätern neu – etwas, was Dresden bis heute beschäftigt.
Mit unbestechlichem Blick zeigt Harry Mulisch die Verwundung der Menschen durch den Krieg, und zwar auf beiden Seiten, und stellt so die Frage nach Opfern und Tätern neu – etwas, was Dresden bis heute beschäftigt.
Besetzung
Regie
Stefan Bachmann
Bühne
Simeon Meier
Kostüme
Barbara Drosihn
Musik
Jan Maihorn
Video
Christoph Menzi
Licht
Dramaturgie
Felicitas Zürcher
Norman Corinth
Wolfgang Michalek
Hella Viebahn, Dolmetscherin des Zahnarztkongresses
Ludwig, Pensionsinhaber / Frank / Ein Senegalese
Günther, Chauffeur / Harry
Stefko Hanushevsky
Eugène / Patrick / Karin, Assistentin
Annika Schilling
Erzählerin / Doktor Tsch’wè Unsang, ein Koreaner / Dresdnerin
Alexander Schneiderhahn, Kongressteilnehmer / Archie / Xingu, ein Hund
Professor Doktor Karlheinz Ruprecht / Dresdner / Portier
Lars Jung
Video
Marcel Beyer über „Das steinerne Brautbett“
von Marcel Beyer
Der Autor Marcel Beyer bezeichnete „Das steinerne Brautbett“ 2008 im Spiegel als „das Buch meines Lebens“ – es war eine Liebeserklärung an den Roman und ein Bekenntnis zur Stadt, wo „die Nerven offen liegen“, zu Dresden. Wir baten Marcel Beyer um einen Beitrag zu Mulischs Roman, den er nicht nur vor dem Hintergrund des 13. Februar 1945, sondern ebenso vor dem des aktuellen Weltgeschehens im März 2011 noch einmal und wieder in einem neuen Licht las.
Es gibt Bücher, die einen bei der ersten Lektüre erschüttern, und bei der zweiten, und bei der dritten, und noch nach der siebten Lektüre ist einem nicht im Leisesten klar, woher diese Erschütterung rührt, welcher Nerv da von Mal zu Mal gereizt wird, ohne je unempfindlich zu werden. Harry Mulischs früher Roman „Das steinerne Brautbett“ ist seit Mitte der 1990er-Jahre solch ein Buch für mich, und erst in den vergangenen Tagen – ich schreibe diese Sätze am 14. März 2011 – gewinne ich nach und nach eine Ahnung davon, was es mit den nicht einmal 200 angst- und zynismusgefüllten, in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre geschriebenen Seiten auf sich hat – warum ich sie immer wieder lesen muss, warum sie nicht aufhören, in meiner Erinnerung herumzugeistern.
Nach einer endlosen Irrfahrt durch ein Nichts namens Dresden im Jahr 1956 steigt die Hauptfigur Norman Corinth aus dem Auto und blickt in die nach allen Seiten sich ausbreitende Trümmerwelt, „die Überreste der Stadt: eine unüberschaubare Brandung von Schutthaufen“ – und ich gebe zu, es fällt mir nicht eben leicht, mir dieses durch und durch nihilistische Schlussbild des durch und durch nihilistischen Romans von Mulisch vor Augen zu rufen, hier in New York, wo ich mich derzeit aufhalte, wenige Tage nach meinem ersten Besuch an jener Stätte, die wir „Ground Zero“ zu nennen gewohnt sind, die unter den Rettungskräften jedoch immer nur „the pile“, „der Haufen“, genannt wurde, und während im Hintergrund der Fernseher läuft, weil ich auf neueste Nachrichten aus dem erdbebenerschütterten Japan warte.
Alle Bilder schießen zusammen: Eine Kolonne von Feuerwehrwagen windet sich durch die Trümmerlandschaft, die noch vor wenigen Tagen eine Stadt an der japanischen Ostküste war, und begegnet auf der Suche nach Leben Mulischs Antihelden, dem abgebrühten US-Mediziner und Exbomberpiloten mit dem entstellten Gesicht ebenso wie seinem Gegenspieler, dem westdeutschen Arzt mit dubioser Vergangenheit und noch dubioseren Sprüchen auf den Lippen.
Die Freunde in Tokio haben sich per Mail zurückgemeldet, sie sind zum Glück unversehrt, doch in diesen Stunden verfolge ich den Weg der – unsichtbaren – radioaktiven Wolke, die, wie es heißt, vom sich drehenden Wind vom Kernkraftwerk in Fukushima in Richtung Süden auf die japanische Hauptstadt zugeweht wird, und mit einem Mal ist mir die Atmosphäre gegenwärtig, in der der junge Mulisch seinen Roman schrieb, die alles beherrschende Furcht vor dem Dritten Weltkrieg, der, wie man sicher war, ein Atomkrieg sein würde, und im Hintergrund höre ich einen Nachrichtensprecher schwadronieren, in Japan zeichne sich schon jetzt ein nationales Trauma ab, „because they had to deal with the nuclear thing in ’45“, in dieser unerträglichen Mischung aus Abgebrühtheit und theatralischem Mitgefühl, und ich sehe wieder Norman Corinth vor mir, den Bomberpiloten in seiner Kanzel.
Abgebrühtheit höre ich auch aus der Versicherung einer anderen Nachrichtenstimme heraus, die radioaktive Wolke über Japans Küste stelle keine Bedrohung für die USA dar, doch im nächsten Moment überlege ich, wenige Kilometer von der Baustelle entfernt, die einmal das World Trade Center war, ob nicht eine solche Beruhigung hier weit größere Bedeutung hat, als sie es zum Beispiel im mir heute so fernen Deutschland hätte, wo schon wieder die notorischen schwäbischen Menschenketten gebildet und Jodtabletten gehortet werden, als sei man schlichtweg nicht in der Lage, an das Leid anderer Menschen zu denken, ohne dabei in erster Linie an sich selbst zu denken. So wie Mulischs zusammengewürfelte Gruppe von Teilnehmern am internationalen Medizinerkongress, die eines Nachts in einer Dresdner Spelunke auf Überlebende des 13. Februar 1945 trifft, sich deren Geschichte halb betroffen, halb angewidert anhört, um das Grauen der anderen sogleich im Bierrausch zu ertränken, und dann gibt es einen Streit, eine Schlägerei – und vom Grauen der anderen bleibt nicht viel mehr als eine diffuse Erinnerung an Gewalt und die selbstgerechte Gewissheit, dass sich jeder Mensch irgendwie als bedroht und beschädigt betrachten kann.
Es gibt Bücher, die einen bei der ersten Lektüre erschüttern, und bei der zweiten, und bei der dritten, und noch nach der siebten Lektüre ist einem nicht im Leisesten klar, woher diese Erschütterung rührt, welcher Nerv da von Mal zu Mal gereizt wird, ohne je unempfindlich zu werden. Harry Mulischs früher Roman „Das steinerne Brautbett“ ist seit Mitte der 1990er-Jahre solch ein Buch für mich, und erst in den vergangenen Tagen – ich schreibe diese Sätze am 14. März 2011 – gewinne ich nach und nach eine Ahnung davon, was es mit den nicht einmal 200 angst- und zynismusgefüllten, in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre geschriebenen Seiten auf sich hat – warum ich sie immer wieder lesen muss, warum sie nicht aufhören, in meiner Erinnerung herumzugeistern.
Nach einer endlosen Irrfahrt durch ein Nichts namens Dresden im Jahr 1956 steigt die Hauptfigur Norman Corinth aus dem Auto und blickt in die nach allen Seiten sich ausbreitende Trümmerwelt, „die Überreste der Stadt: eine unüberschaubare Brandung von Schutthaufen“ – und ich gebe zu, es fällt mir nicht eben leicht, mir dieses durch und durch nihilistische Schlussbild des durch und durch nihilistischen Romans von Mulisch vor Augen zu rufen, hier in New York, wo ich mich derzeit aufhalte, wenige Tage nach meinem ersten Besuch an jener Stätte, die wir „Ground Zero“ zu nennen gewohnt sind, die unter den Rettungskräften jedoch immer nur „the pile“, „der Haufen“, genannt wurde, und während im Hintergrund der Fernseher läuft, weil ich auf neueste Nachrichten aus dem erdbebenerschütterten Japan warte.
Alle Bilder schießen zusammen: Eine Kolonne von Feuerwehrwagen windet sich durch die Trümmerlandschaft, die noch vor wenigen Tagen eine Stadt an der japanischen Ostküste war, und begegnet auf der Suche nach Leben Mulischs Antihelden, dem abgebrühten US-Mediziner und Exbomberpiloten mit dem entstellten Gesicht ebenso wie seinem Gegenspieler, dem westdeutschen Arzt mit dubioser Vergangenheit und noch dubioseren Sprüchen auf den Lippen.
Die Freunde in Tokio haben sich per Mail zurückgemeldet, sie sind zum Glück unversehrt, doch in diesen Stunden verfolge ich den Weg der – unsichtbaren – radioaktiven Wolke, die, wie es heißt, vom sich drehenden Wind vom Kernkraftwerk in Fukushima in Richtung Süden auf die japanische Hauptstadt zugeweht wird, und mit einem Mal ist mir die Atmosphäre gegenwärtig, in der der junge Mulisch seinen Roman schrieb, die alles beherrschende Furcht vor dem Dritten Weltkrieg, der, wie man sicher war, ein Atomkrieg sein würde, und im Hintergrund höre ich einen Nachrichtensprecher schwadronieren, in Japan zeichne sich schon jetzt ein nationales Trauma ab, „because they had to deal with the nuclear thing in ’45“, in dieser unerträglichen Mischung aus Abgebrühtheit und theatralischem Mitgefühl, und ich sehe wieder Norman Corinth vor mir, den Bomberpiloten in seiner Kanzel.
Abgebrühtheit höre ich auch aus der Versicherung einer anderen Nachrichtenstimme heraus, die radioaktive Wolke über Japans Küste stelle keine Bedrohung für die USA dar, doch im nächsten Moment überlege ich, wenige Kilometer von der Baustelle entfernt, die einmal das World Trade Center war, ob nicht eine solche Beruhigung hier weit größere Bedeutung hat, als sie es zum Beispiel im mir heute so fernen Deutschland hätte, wo schon wieder die notorischen schwäbischen Menschenketten gebildet und Jodtabletten gehortet werden, als sei man schlichtweg nicht in der Lage, an das Leid anderer Menschen zu denken, ohne dabei in erster Linie an sich selbst zu denken. So wie Mulischs zusammengewürfelte Gruppe von Teilnehmern am internationalen Medizinerkongress, die eines Nachts in einer Dresdner Spelunke auf Überlebende des 13. Februar 1945 trifft, sich deren Geschichte halb betroffen, halb angewidert anhört, um das Grauen der anderen sogleich im Bierrausch zu ertränken, und dann gibt es einen Streit, eine Schlägerei – und vom Grauen der anderen bleibt nicht viel mehr als eine diffuse Erinnerung an Gewalt und die selbstgerechte Gewissheit, dass sich jeder Mensch irgendwie als bedroht und beschädigt betrachten kann.
Die Abgebrühtheit, der Aktionismus oder das Triumphgrinsen, zu dem sich Norman Corinths entstelltes Gesicht zu verziehen scheint, wenn er tatsächlich einmal versucht zu lächeln: alles Versuche, die eigene Hilflosigkeit in den Griff zu bekommen, wenn das Leben um einen herum aus der Bahn gerät, sei es aufgrund einer Naturkatastrophe, sei es aufgrund menschengemachten Unheils. Im „Steinernen Brautbett“ wüsste keiner der Romanprotagonisten zu sagen, ob er Bewohner einer postapokalyptischen Welt ist oder ob die Welt auf eine Apokalypse zusteuert, so wie auch niemand zu sagen wüsste, ob man für die im Roman stets untergründig gegenwärtige, die bevorstehende Nuklearkatastrophe am Ende den Menschen oder die Natur verantwortlich machen wird. Dass Mulisch für seine Erzählung aus drei Dresdner Herbsttagen im Jahr 1957 ausgerechnet einen internationalen Medizinerkongress inszeniert, gehört zu seinem bitter ironischen Spiel. Das frühere Heilstättenparadies, an dem noch das „Heil“ einer erst vor wenigen Jahren zu Ende gegangenen Epoche widerhallt, beherbergt – als Trümmerstätte – Koryphäen aus aller Welt, die sich der Heilung verschrieben haben. Doch vom ersten Blick an, den uns Mulisch auf seinen Antihelden gewährt, ist klar: Dieser Mann kennt weder Heilungs- noch Heilsversprechen.
Alles ist Heillosigkeit in diesem Roman. Da nützt es auch nichts, dass sich die Dolmetscherin Hella, vom Protagonisten zugleich merkwürdig angezogen und abgestoßen, mit zeitgemäß munter-verbissener Aufbaurhetorik über Wasser zu halten versucht: Sie ist die Ariadne, die den Kongressbesucher durchs Elbtal, das steinerne Brautbett, geleitet, sie ist, für die Dauer einiger Tage, die „Braut von Corinth“, jener junge weibliche Geist aus Goethes Zombieballade, der sich gegen die Gesetze der Welt zu stemmen versucht, gegen die weder die Lebenden noch die Toten etwas ausrichten können. Allerdings könnte ihr Erscheinen inmitten der Heillosigkeit auch darauf hindeuten, dass es sich bei ihr um eine bloße Halluzination handelt, um die Halluzination eines Mannes namens Corinth, der sich nicht eingestehen kann, dass er ohne Hoffnung nicht überleben wird.
Marcel Beyer, geboren 1965, beschäftigt sich in seinen Gedichten, Essays und Romanen immer wieder mit der deutschen Geschichte, insbesondere mit dem Nationalsozialismus. Seit 1996 lebt der Autor in Dresden. Zuletzt erschienen sein Roman „Spione“ und der Dresden-Roman „Kaltenburg“. Sein Beitrag zu „Das steinerne Brautbett“ schrieb er als Originalbeitrag für diese Inszenierung.
Harry Mulisch wurde 1927 im niederländischen Haarlem als Sohn eines österreichischen Offiziers und einer deutschen Jüdin geboren und starb 2010 in Amsterdam. Seine persönliche Geschichte und die historischen und politischen Verwicklungen seiner Zeit prägten maßgeblich sein literarisches und journalistisches Werk. In unterschiedlichen Formen – von der Lyrik über Dramen und Libretti bis zum Roman – hat er sich intensiv mit dem Verhältnis von Geschichte und Individuum auseinandergesetzt. Weltweit bekannt wurde er vor allem mit seinem Roman „Die Entdeckung des Himmels“. Er gilt als der bedeutendste niederländische Nachkriegsautor.
Alles ist Heillosigkeit in diesem Roman. Da nützt es auch nichts, dass sich die Dolmetscherin Hella, vom Protagonisten zugleich merkwürdig angezogen und abgestoßen, mit zeitgemäß munter-verbissener Aufbaurhetorik über Wasser zu halten versucht: Sie ist die Ariadne, die den Kongressbesucher durchs Elbtal, das steinerne Brautbett, geleitet, sie ist, für die Dauer einiger Tage, die „Braut von Corinth“, jener junge weibliche Geist aus Goethes Zombieballade, der sich gegen die Gesetze der Welt zu stemmen versucht, gegen die weder die Lebenden noch die Toten etwas ausrichten können. Allerdings könnte ihr Erscheinen inmitten der Heillosigkeit auch darauf hindeuten, dass es sich bei ihr um eine bloße Halluzination handelt, um die Halluzination eines Mannes namens Corinth, der sich nicht eingestehen kann, dass er ohne Hoffnung nicht überleben wird.
Marcel Beyer, geboren 1965, beschäftigt sich in seinen Gedichten, Essays und Romanen immer wieder mit der deutschen Geschichte, insbesondere mit dem Nationalsozialismus. Seit 1996 lebt der Autor in Dresden. Zuletzt erschienen sein Roman „Spione“ und der Dresden-Roman „Kaltenburg“. Sein Beitrag zu „Das steinerne Brautbett“ schrieb er als Originalbeitrag für diese Inszenierung.
Harry Mulisch wurde 1927 im niederländischen Haarlem als Sohn eines österreichischen Offiziers und einer deutschen Jüdin geboren und starb 2010 in Amsterdam. Seine persönliche Geschichte und die historischen und politischen Verwicklungen seiner Zeit prägten maßgeblich sein literarisches und journalistisches Werk. In unterschiedlichen Formen – von der Lyrik über Dramen und Libretti bis zum Roman – hat er sich intensiv mit dem Verhältnis von Geschichte und Individuum auseinandergesetzt. Weltweit bekannt wurde er vor allem mit seinem Roman „Die Entdeckung des Himmels“. Er gilt als der bedeutendste niederländische Nachkriegsautor.
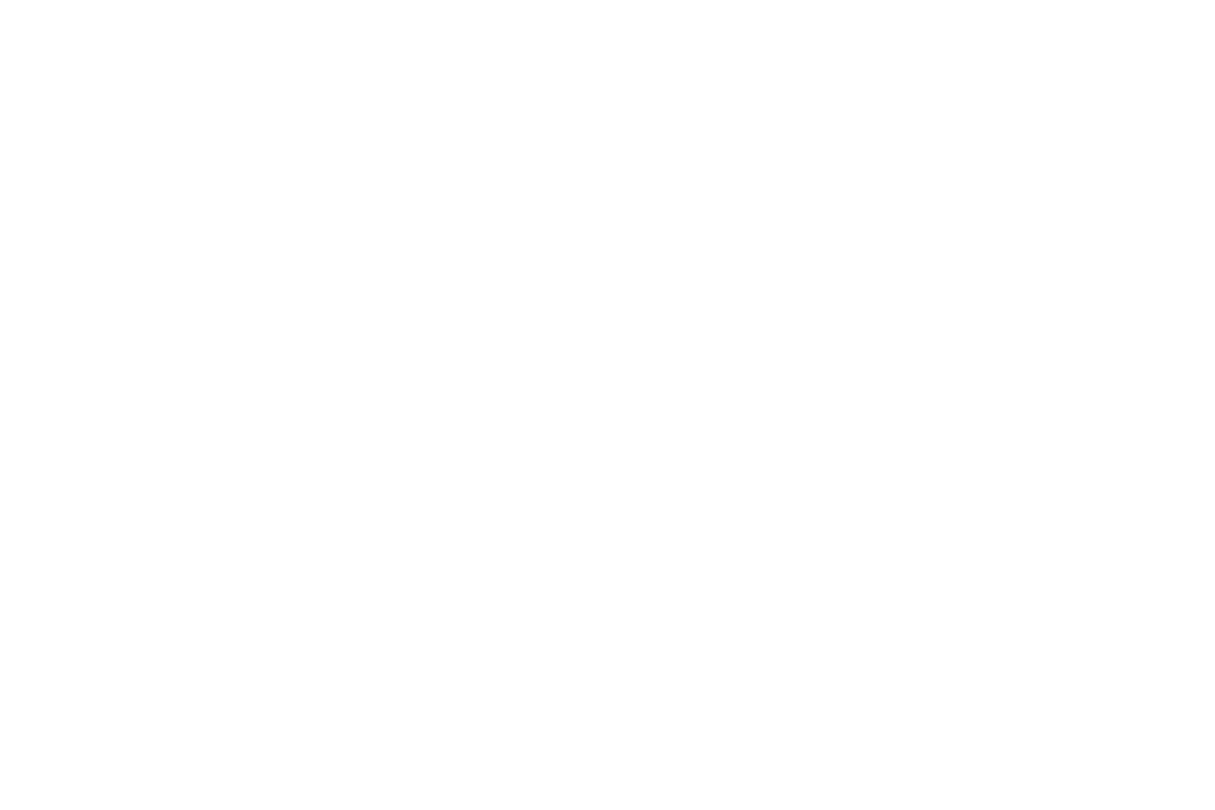


Stefan Bachmann, der mit der Dramaturgin Felicitas Zürcher auch die Textfassung des ‚Steinernen Brautbetts‘ einrichtete, nimmt die komplexe Materie auf spielerisch-leichthändige und phantasievoll-amüsante Weise ernst – ganz im Sinne von Harry Mulisch. Ohne Betulichkeit und Larmoyanz schickt er sein achtköpfiges Ensemble auf einen revuehaft beschwingten Horrortrip in die deutsche Vergangenheit. Übergangslos wechseln die zeitlichen und räumlichen Ebenen aus der subjektiven Perspektive Corinths, und Wolfgang Michalek in der Rolle dieses verwirrten amerikanischen Odysseus und arrogant verstörten Siegers stimmt gleich wieder mit ein, als wäre inzwischen nicht einiges Wasser die Elbe hinabgeflossen. Seine Eindrücke sind komisch, grotesk, erschütternd, und in Bachmanns Regie kommen sie allesamt unangestrengt beredt auf die Bühne.
Mit ganz einfachen Theatermitteln und dem bravourösen Ensemble trifft Stefan Bachmann Mulischs Roman ins heißkalte Herz und ins poetische Hirn: ein Glücksfall, fern jeglicher Gedenkroutine.“
Oder aber, es treibt einen die Lust auf pralles, zur Identifikation einladendes Sinnenspiel ins Theater. Auch hierfür hält dieser Dreistundenabend allerlei bereit, eine sirrend uneindeutig gehaltene Liebesgeschichte zwischen Corinth und der Übersetzerin Hella (sehr überzeugend: Karina Plachetka), einen Selbstbetrüger, der sich zum Kommunisten erklärt, aber von Nazi- Schuld nicht frei ist (Torsten Ranft).“