Premiere 19.03.2016
› Schauspielhaus
Das Schiff der Träume (E la nave va)
von Federico Fellini
Aus dem Italienischen von Trude Fein, Renate Heimbucher-Bengs, Beatrice Schlag
Aus dem Italienischen von Trude Fein, Renate Heimbucher-Bengs, Beatrice Schlag
Handlung
Eine mondäne Gesellschaft aus Künstlern, Direktoren und Exzellenzen begibt sich an Bord des Ozeandampfers „Gloria N.“, um der größten Operndiva aller Zeiten das letzte Geleit zu geben. Man singt und speist, streitet und feiert, während der Dampfer auf die Insel Erimo zusteuert, vor der die Zeremonie für die Verstorbene stattfinden soll. Als der Kapitän unterwegs eine Gruppe in Seenot geratener serbischer Flüchtlinge aufnimmt, plant die illustre Trauergesellschaft, ihre Luxusreise weiterhin unbehelligt fortzusetzen. Doch als sich plötzlich ein österreichisches Kriegsschiff nähert, spitzt sich die Lage zu. Die Passagiere der Luxusklasse können die Not der Schiffbrüchigen und den sich anbahnenden politischen Umsturz nicht länger ignorieren.
„In Wahrheit liegt das eigentliche Ziel dieser Reise in der Reise selbst“, so Fellini über seinen Film. „Ihr zentrales Thema ist die schwierige Beziehung zur Wirklichkeit oder zu dem, was wir dafür halten.“ DAS SCHIFF DER TRÄUME lädt ein zu einer Kreuzfahrt mit ungewissem Ziel, auf der es phantastische, mal tragische, mal komische, fröhliche wie gefahrvolle Abenteuer zu erleben gibt.
„In Wahrheit liegt das eigentliche Ziel dieser Reise in der Reise selbst“, so Fellini über seinen Film. „Ihr zentrales Thema ist die schwierige Beziehung zur Wirklichkeit oder zu dem, was wir dafür halten.“ DAS SCHIFF DER TRÄUME lädt ein zu einer Kreuzfahrt mit ungewissem Ziel, auf der es phantastische, mal tragische, mal komische, fröhliche wie gefahrvolle Abenteuer zu erleben gibt.
Besetzung
Regie
Jan Gehler
Bühne
Sabrina Rox
Kostüme
Irène Favre de Lucascaz
Musik
Licht
Dramaturgie
Beret Evensen
Sir Reginald Dongby, Generalintendant
Lady Violet, Sir Reginald Dongbys Frau
Yohanna Schwertfeger
Ricotin, Stummfilmkomiker / Koch
Kilian Land
Aureliano Fuciletto, Tenor
Jan Maak
Ines Ruffo Saltini, Mezzosopranistin
Ildebranda Cuffari, Sopranistin / Conte di Bassano
André Kaczmarczyk
Großherzog / Geistlicher
Meik van Severen
Prinzessin Lerinia, Schwester des Großherzogs / Köchin
Lou Strenger
Kapitän
Serbische Flüchtlinge
Hilde Alice Behrens, Darnell Donat, Gloria Gruß, Mathilda Kaufhold, Konrad Neidhardt, Carlotta Panico, Ella Rox, Finn Seidel, Paul Terpe, Arthur Leo Weinhold, Mira Fanny Weinhold
Video
Der Journalist Tobi Müller zieht Parallelen von Fellinis Film aus den 1980er-Jahren zur Gegenwart
Federico Fellini schuf 1983 mit „Das Schiff der Träume“ einen Film, der die Moderne zugleich fürchtet und feiert. Der italienische Filmemacher fürchtet sie, wenn er eine bourgeoise Schiffsgesellschaft am Beginn des Ersten Weltkriegs zeigt, die ihrem Ende entgegensieht. Um die Asche einer Opernsängerin vor der Küste ihrer Heimatinsel zu verstreuen, reisen Dirigenten, Tenöre, Sopranistinnen, Musiker, melancholische Adelige und ein erzählender Reporter auf einem Luxusdampfer, den ein österreichisch-ungarisches Kriegsschiff kurz vor Schluss versenkt. Das ist die Furcht vor jener Moderne, die den Massenmord industrialisiert hat. Keinen Trost zieht der Zuschauer aus dem Umstand, dass der feindliche Zerstörer aus Pappe ist und kein Kapitän ihn zu lenken scheint. Im Gegenteil, das beginnende 20. Jahrhundert wirkt dadurch wie ein führerloses Geisterschiff.
Zur Furcht kommt die Freude, denn Fellini feiert die künstlerischen Errungenschaften der Moderne und ihrer Avantgarden, die er für ein breites Publikum so sinnlich gestaltete. Manche seiner Mittel findet man bereits im 18. oder auch noch im 19. Jahrhundert auf den Theaterbühnen, in den Tableaux vivants oder Lebenden Bildern, wenn Schauspieler ein berühmtes Gemälde nachstellten. Auch Fellinis Bildsprache schimmert manchmal wie Öl auf Leinwand, obwohl er damit nichts imitieren will. Doch die Schauspieler sind bei ihm Abbilder oder Typen, nicht psychologische Seelendarsteller, wie es das bürgerliche Theater vorsah.
Im „Schiff der Träume“ sind die meisten Schauspieler keine italienischen Muttersprachler, sie wurden für die Originalversion synchronisiert. Nicht die Sprache als Fenster zur Innerlichkeit ist wichtig, sondern der Körper, das Gesicht, der Ausdruck. Fellinis Typen spielen in einem szenischen Reigen, der dem Tanz näher steht als der Dramaturgie des bürgerlichen Theaters. Es sind Episoden, Nummern, Arien, Wimmelbilder. Und Tänze eben. Ein Weltstar des Tanzes wirkt übrigens als Schauspielerin mit: die Choreografin Pina Bausch aus Wuppertal. Der Originaltitel des Films sowie die englische Übersetzung treffen die Form gut: „E la nave va“, „And the ship sails on“. „Und das Schiff fährt weiter“ verweist auch auf den Fluss der Filmerzählung, während „Das Schiff der Träume“ auf der Tiefenpsychologie beharrt (und unfreiwillig an die Fernsehserie „Das Traumschiff“ erinnert, mit der das ZDF ab 1981 Kreuzfahrtromantik produzierte).
Aber Fellini macht es uns nicht leicht. Er spielt nicht einfach die alte gegen die neue Welt aus. Er ist Modernist, klar interessiert ihn die Zeit seines Films auch aus kunsthistorischen Gründen. Strawinski hatte 1913 mit „Le sacre du printemps“ („Das Frühlingsopfer“) die Musik zu einem Ballett geschrieben, die mit dem 19. Jahrhundert brach. Dissonanzen und ungerade Metren treffen auf Volksmusik, Neue Musik trifft auf Pop, würde man heute sagen. Im „Schiff der Träume“ hat die Musik des 18. und 19. Jahrhunderts ihren endzeitlichen Auftritt, aber Fellini zeigt viele soziale Berührungspunkte. Alles Highlights. Weil sie starke Bilder finden und weil sie verdeutlichen, dass der Film mehr kann als Parodie.
Wenn die Sängerinnen und Sänger im Heizraum am Geländer stehen und für die rußverschmierten Arbeiter einen Wettstreit der Arien aufführen, ist das zum einen lächerlich, weil eitel. Zum anderen zeigt es die Kraft einer populären Musik, selbst jene zu begeistern, die von ihr ausgeschlossen scheinen. Und wenn der russische Sänger in der Küche ein Huhn verlangt, um es mit seinem Bass in den Schlaf zu singen, bleibt von der Kunst nur ein Kunststücklein übrig. Und doch erinnert diese Szene daran, dass Dünkel ein Zeichen von Zerfall ist, von Angst, das Territorium mit anderen teilen zu müssen. Dieser Sänger hat keine Berührungsängste mit dem Koch. Die Möglichkeit zum Quatsch, etwa ein Huhn zu hypnotisieren, ist zentral für die Freiheit der Kunst. Wer die potenzielle Zweckfreiheit der Kunst negiert, läuft Gefahr, sie ganz in den Dienst einer Idee zu stellen und erst damit zu banalisieren.
Zur Furcht kommt die Freude, denn Fellini feiert die künstlerischen Errungenschaften der Moderne und ihrer Avantgarden, die er für ein breites Publikum so sinnlich gestaltete. Manche seiner Mittel findet man bereits im 18. oder auch noch im 19. Jahrhundert auf den Theaterbühnen, in den Tableaux vivants oder Lebenden Bildern, wenn Schauspieler ein berühmtes Gemälde nachstellten. Auch Fellinis Bildsprache schimmert manchmal wie Öl auf Leinwand, obwohl er damit nichts imitieren will. Doch die Schauspieler sind bei ihm Abbilder oder Typen, nicht psychologische Seelendarsteller, wie es das bürgerliche Theater vorsah.
Im „Schiff der Träume“ sind die meisten Schauspieler keine italienischen Muttersprachler, sie wurden für die Originalversion synchronisiert. Nicht die Sprache als Fenster zur Innerlichkeit ist wichtig, sondern der Körper, das Gesicht, der Ausdruck. Fellinis Typen spielen in einem szenischen Reigen, der dem Tanz näher steht als der Dramaturgie des bürgerlichen Theaters. Es sind Episoden, Nummern, Arien, Wimmelbilder. Und Tänze eben. Ein Weltstar des Tanzes wirkt übrigens als Schauspielerin mit: die Choreografin Pina Bausch aus Wuppertal. Der Originaltitel des Films sowie die englische Übersetzung treffen die Form gut: „E la nave va“, „And the ship sails on“. „Und das Schiff fährt weiter“ verweist auch auf den Fluss der Filmerzählung, während „Das Schiff der Träume“ auf der Tiefenpsychologie beharrt (und unfreiwillig an die Fernsehserie „Das Traumschiff“ erinnert, mit der das ZDF ab 1981 Kreuzfahrtromantik produzierte).
Aber Fellini macht es uns nicht leicht. Er spielt nicht einfach die alte gegen die neue Welt aus. Er ist Modernist, klar interessiert ihn die Zeit seines Films auch aus kunsthistorischen Gründen. Strawinski hatte 1913 mit „Le sacre du printemps“ („Das Frühlingsopfer“) die Musik zu einem Ballett geschrieben, die mit dem 19. Jahrhundert brach. Dissonanzen und ungerade Metren treffen auf Volksmusik, Neue Musik trifft auf Pop, würde man heute sagen. Im „Schiff der Träume“ hat die Musik des 18. und 19. Jahrhunderts ihren endzeitlichen Auftritt, aber Fellini zeigt viele soziale Berührungspunkte. Alles Highlights. Weil sie starke Bilder finden und weil sie verdeutlichen, dass der Film mehr kann als Parodie.
Wenn die Sängerinnen und Sänger im Heizraum am Geländer stehen und für die rußverschmierten Arbeiter einen Wettstreit der Arien aufführen, ist das zum einen lächerlich, weil eitel. Zum anderen zeigt es die Kraft einer populären Musik, selbst jene zu begeistern, die von ihr ausgeschlossen scheinen. Und wenn der russische Sänger in der Küche ein Huhn verlangt, um es mit seinem Bass in den Schlaf zu singen, bleibt von der Kunst nur ein Kunststücklein übrig. Und doch erinnert diese Szene daran, dass Dünkel ein Zeichen von Zerfall ist, von Angst, das Territorium mit anderen teilen zu müssen. Dieser Sänger hat keine Berührungsängste mit dem Koch. Die Möglichkeit zum Quatsch, etwa ein Huhn zu hypnotisieren, ist zentral für die Freiheit der Kunst. Wer die potenzielle Zweckfreiheit der Kunst negiert, läuft Gefahr, sie ganz in den Dienst einer Idee zu stellen und erst damit zu banalisieren.
Spätestens da sind wir in der Gegenwart: Wie geht die Kunst mit sozialen Verwerfungen um? Ist es ihre erste Aufgabe, einer politischen Agenda zu folgen? Die Kippfigur in Fellinis Film ist der Flüchtling, die serbische Gruppe in Seenot, die der Kapitän des Luxusliners aufnimmt. Die Serben sind als „Zigeuner“ markiert. Die dunklen Haare, die Kleidung und die Tänze weisen darauf hin und das Klischee, dass sie selbst die erste Klasse besetzen. Fellini zeigt ein Zerrbild, um das Aufeinandertreffen der Kulturen und Klassen deutlich zu machen. Manche bringen den Flüchtlingen vom Buffet etwas zu essen, andere bewirken beim Kapitän, dass man sie ins Unterdeck verbannt. Zur Begegnung kommt es aber nur in der Kunst, bei nächtlicher Musik und Tanz. Es knistert erotisch, exotische Vorstellungen über die Fremden werden als Kitsch vorgeführt, oder: Sie wirken heute so.
Viele Parallelen sind möglich zwischen 1914 und 2014, als die Pegida-Demonstrationen in Dresden losgingen. Die Vorstellung, dass etwas zu Ende geht, der Umgang mit Flüchtlingen, der entscheidend sein wird für die Zukunft einer europäischen Idee, die Operettenhaftigkeit nationalistischer Ideen, die trotz ihrer Erbärmlichkeit geschichtsmächtig werden können. Aber „Das Schiff der Träume“ zeigt auch einen großen Unterschied: Die Menschen sind genussfähig. Das hat mehr mit 1983 zu tun als mit 1914, mit Fellini und den 1980er-Jahren. Mit dem letzten Jahrzehnt also bevor die Zeitenwende von 1989 / 90 nebst der Freiheit auch den Durchmarsch des Neoliberalismus ermöglicht hat. Wir sind zwar heute umgeben von Appellen des konsumistischen Genießens, aber das sind Befehle. Genuss als Arbeit, als Arbeit am Selbst. Philosophen wie Robert Pfaller oder Slavoj Žižek nennen das gleich Selbstbestrafung. Wir optimieren uns zu Tode, reduzieren dabei auch den anderen auf seinen Wert. Das führt dazu, dass wir uns immer stärker ähneln. Und dass wir die sogenannten Fremden ablehnen.
„Das Schiff der Träume“ zeigt trotz der historischen Tragik eine Utopie. Es ist eine Welt der Freaks, der Sonderlinge, der Empfindsamen, der Untauglichen, der Spezialisten. Es ist eine Welt, die Differenz hervorbringt, während wir ständig über Differenz sprechen, aber immer gleicher aussehen. Matchentscheidend in Fellinis Spiel der Farben, Gesichter, Lüste und Künste ist am Ende die Gattung: Es ist eine Komödie, und die handelt immer vom Gelingen. Sie führt das Verhalten der Leute vor, lacht darüber und sagt: Es geht, trotzdem, wir kommen da durch. Nur die Tragödie redet vom Schicksal und handelt einzig vom Scheitern. Nicht nur Dresden braucht mehr Komödien. Mehr Kunst. Vielleicht auch: mehr Quatsch.
Tobi Müller ist Kulturjournalist und Moderator. Er schreibt über Pop- und Theaterthemen und leitet Gesprächsrunden.
Viele Parallelen sind möglich zwischen 1914 und 2014, als die Pegida-Demonstrationen in Dresden losgingen. Die Vorstellung, dass etwas zu Ende geht, der Umgang mit Flüchtlingen, der entscheidend sein wird für die Zukunft einer europäischen Idee, die Operettenhaftigkeit nationalistischer Ideen, die trotz ihrer Erbärmlichkeit geschichtsmächtig werden können. Aber „Das Schiff der Träume“ zeigt auch einen großen Unterschied: Die Menschen sind genussfähig. Das hat mehr mit 1983 zu tun als mit 1914, mit Fellini und den 1980er-Jahren. Mit dem letzten Jahrzehnt also bevor die Zeitenwende von 1989 / 90 nebst der Freiheit auch den Durchmarsch des Neoliberalismus ermöglicht hat. Wir sind zwar heute umgeben von Appellen des konsumistischen Genießens, aber das sind Befehle. Genuss als Arbeit, als Arbeit am Selbst. Philosophen wie Robert Pfaller oder Slavoj Žižek nennen das gleich Selbstbestrafung. Wir optimieren uns zu Tode, reduzieren dabei auch den anderen auf seinen Wert. Das führt dazu, dass wir uns immer stärker ähneln. Und dass wir die sogenannten Fremden ablehnen.
„Das Schiff der Träume“ zeigt trotz der historischen Tragik eine Utopie. Es ist eine Welt der Freaks, der Sonderlinge, der Empfindsamen, der Untauglichen, der Spezialisten. Es ist eine Welt, die Differenz hervorbringt, während wir ständig über Differenz sprechen, aber immer gleicher aussehen. Matchentscheidend in Fellinis Spiel der Farben, Gesichter, Lüste und Künste ist am Ende die Gattung: Es ist eine Komödie, und die handelt immer vom Gelingen. Sie führt das Verhalten der Leute vor, lacht darüber und sagt: Es geht, trotzdem, wir kommen da durch. Nur die Tragödie redet vom Schicksal und handelt einzig vom Scheitern. Nicht nur Dresden braucht mehr Komödien. Mehr Kunst. Vielleicht auch: mehr Quatsch.
Tobi Müller ist Kulturjournalist und Moderator. Er schreibt über Pop- und Theaterthemen und leitet Gesprächsrunden.
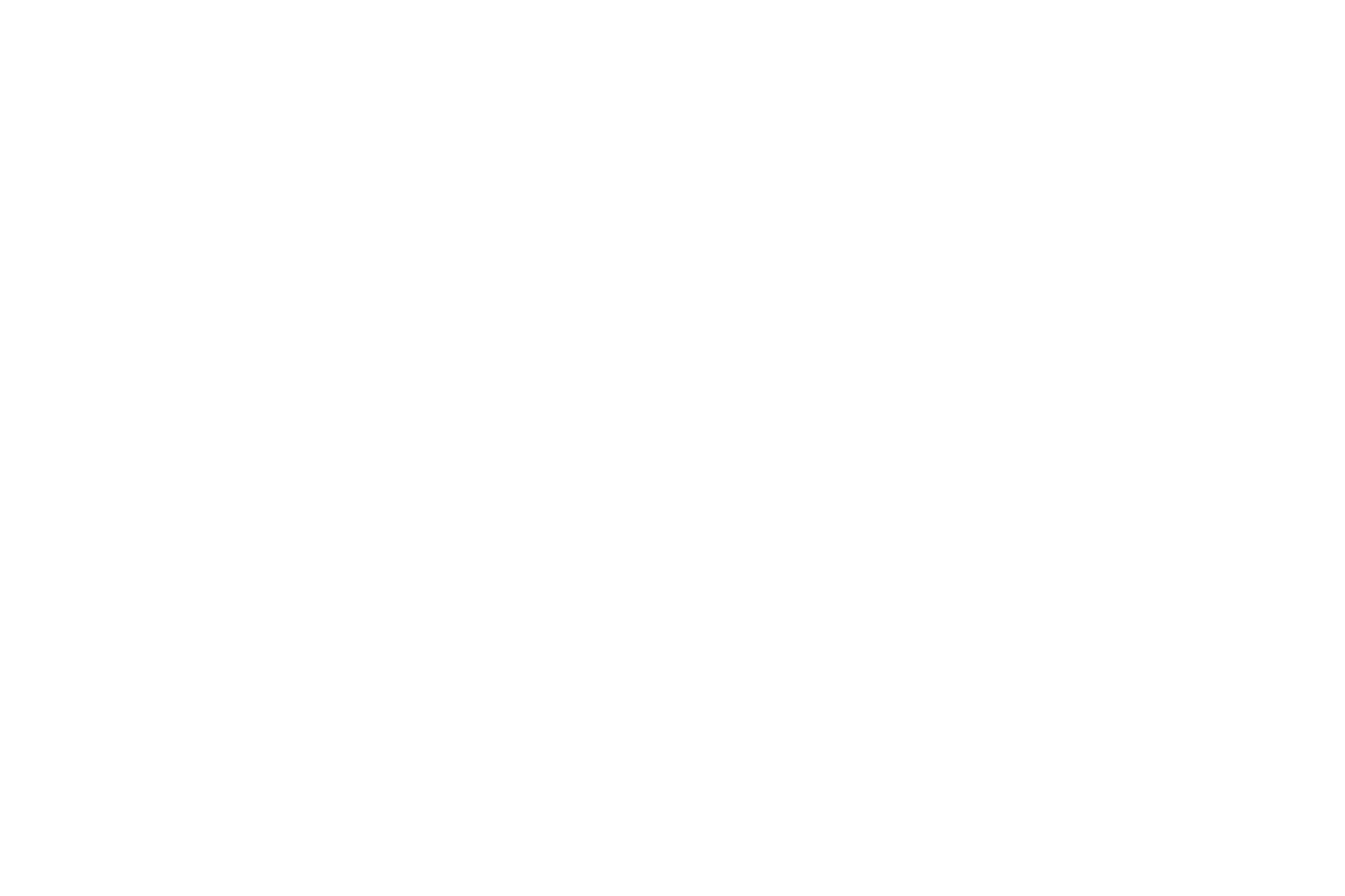






Das alles ist nicht als Klamauk, sondern mit subtiler Komik in einem fantasievoll historisierenden Rahmen inszeniert (Bühne: Sabrina Rox, Kostüme: Irène Favre de Lucascaz).
Gehler huldigt nicht nur einer hintergründigen Poesie, er hat dabei auch in Gelassenheit eine seltsam berührende Form, das heißt zu einem poesievoll gelassenen Sarkasmus gefunden, um gesellschaftlichen Realitätsverlust zu versinnbildlichen.“
André Kaczmarczyk lud in anderen Inszenierungen seine Figuren androgyn auf, hier nun ist er ganz Diva. Mit galant gelegtem Haar und Schleier, im rückenfreien Kleid oder Spitzenoberteil stolziert seine Sopranistin Ildebranda übers Deck, erpicht darauf, die nächste große Operndiva zu werden, und jederzeit bereit zum Schmollen. Wie viel Ehrgeiz, Gift, Witz sich hier mischen in einer einzigen Figur, das ist wunderbar.“
Kilian Land spürt als Stummfilmkomiker im Watschelgang zauberhaft den Gesten der großen Pantomimen nach. Gemeinsam mit den anderen gleichwertigen Mitgliedern des Ensembles bieten sie ein Panoptikum der Spielereien und Narrheiten. Wie Zügellose, die ihres Standes wegen keiner Norm folgen müssen und sich jeder Torheit hingeben können.
Dabei entstehen feine, skurrile Momente: Wenn der gerade einen Koch spielende Schauspieler Kilian Land dazu verdonnert wird, ein Huhn zu mimen und gerade noch dem Publikum versichert, ein ernsthafter Schauspieler zu sein, bevor er anfängt zu gackern. Oder wenn der Großherzog (Meik von Severen) als Kommentar zur internationalen Lage vom ‚Sitzen am Rand des Berges‘ fabuliert, um mit einem herzlichen ‚Bumm-Bumm‘ auf den Punkt zu kommen. Oder wenn jenes ‚Bumm-Bumm‘ auf der Probe für ein Requiem zum neuen Text der Europahymne wird. Szenen, in denen alle Beteiligten im Laufe des Abends ihr Können zeigen.
Überhaupt wird auf diesem Schiff der Träume sehr viel und sehr gut gesungen (so dass es selbst, wenn es nicht zu passen scheint, schon wieder passt) und Musik aus Klavier und Synthesizer ist auch immer da.
Schließlich kommt die Realität spät und ohne Knall wohltuend frei von Aktualisierungswut. Dann stehen elf Mädchen und Jungen im Grundschulalter in blauen Kleidchen und Hosen als serbische Flüchtlinge auf dem Unterdeck. Ganz still und leise. Und das ist schon gruselig-analogisch: Sie sind da, als hätte sie niemand kommen sehen, stellen keine Forderungen, klammern sich hilfesuchend an den Erstbesten und schaffen unter den Passagieren verunsicherte Überforderung.
Plötzlich sind sie zu hören, die Ressentiments der Bessergestellten. Aber nur kurz. Dann ist das gegnerische Kriegsschiff schussbereit. Die Kinder bekommen Schwimmwesten, die Trauernden dürfen noch die Asche verstreuen – zu Kyrie Eleison auf die Melodie der Ode an die Freude. Dann macht es Bumm-Bumm. So muss sich die feine Gesellschaft mit den Flüchtlingen nicht länger beschäftigen – ein Umstand, den sich zurzeit wohl viele wünschen. Die Passagiere der ‚Gloria N.‘ singen lieber im Untergehen: E la nave va – Und das Schiff fährt weiter. Wer braucht schon Realität, sagt dieser starke Abend, um von der Wirklichkeit zu erzählen.“