Premiere 02.05.2015
› Schauspielhaus
Dantons Tod
von Georg Büchner
Handlung
Im Frühling 1794 erreicht der Machtkampf der französischen Revolutionäre seinen Höhepunkt, als der Wohlfahrtsausschuss unter Robespierre den gemäßigten Revolutionär Danton und seine Anhänger in Haft setzen lässt. Robespierre und Danton sind Profiteure der Revolution und Brüder im Geiste, doch im Chaos sich überstürzender Ereignisse ist ihre Verbundenheit nicht von Bestand. Der politische und moralische Konflikt zwischen dem Hedonisten Danton, der seine Revolutionsmüdigkeit in den Armen der Huren von Paris zelebriert, und Robespierre, dem unbestechlichen Ideologen, ist fundamental. Dantons Hybris wird ihn das Leben kosten, Robespierres rhetorische Raffinesse besiegelt sein Schicksal: „Am heutigen Tage werden wir sehen, ob wir in der Lage sind, ein Idol, das schon längst verfault ist, zu zerschmettern. Wie kann ein Mann, dem jedes moralische Gefühl fremd ist, ein Verteidiger der Freiheit sein?“ Anhand dokumentierter Reden und Augenzeugenberichte der Pariser Schreckensherrschaft skizziert der 22-jährige Büchner im Jahr 1835 die letzten Tage Dantons, dessen Passivität gravierende politische Konsequenzen hat. Der Herausgeber der Flugschrift „Hessischer Landbote“ ist selbst ein politisch Verfolgter, verzweifelt über die Wirkungslosigkeit seines revolutionären Engagements und den „grässlichen Fatalismus der Geschichte“.
DANTONS TOD ist weder Historiendrama noch politisches Lehrstück. Denn Georg Büchner belehrt nicht, bietet keine Lösung an und ergreift nicht Partei für einen seiner Protagonisten. Und so ist DANTONS TOD das Zeugnis einer Positionsbestimmung, die die Frage stellt nach dem Preis von Macht, nach politischer Verantwortung und der Notwendigkeit der Revolte angesichts des Unrechts. Es ist das Bekenntnis zur Wahrheit gegen die Ideologie, für die Opfer und gegen die Gewalt.
DANTONS TOD ist weder Historiendrama noch politisches Lehrstück. Denn Georg Büchner belehrt nicht, bietet keine Lösung an und ergreift nicht Partei für einen seiner Protagonisten. Und so ist DANTONS TOD das Zeugnis einer Positionsbestimmung, die die Frage stellt nach dem Preis von Macht, nach politischer Verantwortung und der Notwendigkeit der Revolte angesichts des Unrechts. Es ist das Bekenntnis zur Wahrheit gegen die Ideologie, für die Opfer und gegen die Gewalt.
Besetzung
Regie
Friederike Heller
Bühne und Kostüme
Sabine Kohlstedt
Musik
Peter Thiessen, Sebastian Vogel
Dramaturgie
Beret Evensen
Licht
Michael Gööck
Die gemäßigten Revolutionäre
Georg Danton
André Kaczmarczyk
Camille Desmoulins
Thomas Braungardt
Legendre / Thomas Payne
Julie, Dantons Gattin / Lucile, Gattin des Camille Desmoulins
Yohanna Schwertfeger
Die Jakobiner
Robespierre
Saint-Just
Cathleen Baumann
Herman, Präsident des Revolutionstribunals
Thomas Schumacher
und
Bürger Simon
Thomas Schumacher
Simons Weib / Marion, Grisette
Cathleen Baumann
Musiker
Peter Thiessen, Sebastian Vogel
Video
Ein (etwas) ratloser Versuch über Revolution, Glück und Moral
von Justus H. Ulbricht
von Justus H. Ulbricht
Wer immer in den legendenhaft verklärten altbundesrepublikanischen 1970er-Jahren in einer studentischen Wohngemeinschaft das denkbar stillste Örtchen aufsuchte, fand sich umstellt von den Ikonen der (Welt-)Revolution und ermunternden Sentenzen einzelner ihrer Vordenker.
Da lächelte von oben herab Angela Davis auf den nachdenklich Hockenden. Ihr gegenüber Lenin oder der gut aussehende Zigarrenraucher aus dem bolivianischen Dschungel, der bei den Kommilitoninnen besonders gut ankam. Ernst schaute uns auch der Rauschebart aus Trier zu, dessen „Kapital“ war, dass wir es noch lasen in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften. Wenn wir uns nicht gar mit der „Dialektik der Aufklärung“ quälten. Wo allerdings Erich Frieds Satz „Es ist was es ist, sagt die Liebe“ zu lesen war, musste man davon ausgehen, dass die WehGenossen das markige Motto des jungen Alfred Kurella vergessen hatten: „Mädchen machen zufrieden, aber nicht revolutionär!“ – ein Satz, den Büchners Danton vermutlich unterschrieben hätte. Auch das Antlitz Bonhoeffers oder gar die sanfte Miene Sophie Scholls legten den Verdacht nahe, dass der kämpferische Elan politisch-revolutionären Eingreifens weicheren Haltungen gewichen war. Härte verbürgten hingegen die Konterfeis von „Meinhof und Baader“. Schließlich ließ uns der Satz Blochs „Auf 1000 Kriege kommt nur eine Revolution. So schwer ist der aufrechte Gang!“ stutzen – welchen wir dann im Aufstehen übten, um uns weiteren Tagesgeschäften zuzuwenden wie den unzähligen Blaumatrizen abgerungenen Flugblättern, der nächsten Diskussion um den am entferntesten liegenden Konflikt, der nächsten Aktion … und so fort.
Über die „notwendige“ Gewalt beim revolutionären Wandel der Welt sprachen wir viel, über die Opfer weniger; es sei denn, es handelte sich um die jeweiligen Revolutionäre selbst, die von der jeweiligen „Konterrevolution“ und „dem Faschismus“ bedroht oder gar ausgelöscht wurden. Jara, Theodorakis, Dylan und Baez sangen im Hintergrund, wenn wir tote Polizisten, bombenzerfetzte GIs, sterbende Banker und liquidierte Arbeitgeberpräsidenten allzu leichtfertig als „Kollateralschäden“ der Weltgeschichte abbuchten (das verzeihe ich uns nie).
Dann, in ein und demselben Semester: Büchner-Seminar, Solschenizyns „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, das erste Seminar zum Stalinismus. Da dämmerte Humanitäres herauf, das – einst christkatholisch begründet – nie ganz verschwunden war und stille Zweifel am Recht von Menschenopfern je schon genährt hatte.
Irgendwie wurde man dann allmählich zu Danton: des Kämpfens müde, ernüchtert von der blutigen Spur des „Kampfes“ für den „Fortschritt“ der Weltgeschichte, angeekelt von der Symbiose von Tugend und Terror, die ein asketischer Rechtsanwalt vor dem Jakobinerklub in intellektueller Brillanz mit amoralischer Härte entfaltete („Dantons Tod“, I. Akt, 3. Szene). Robespierre wurde für mich zum Antityp der von uns ersehnten revolutionären Aktion, an deren Notwendigkeit wir festhielten, ohne zu wissen, wie Umbrüche ohne Leichen zu bewerkstelligen wären. Dass die Revolution schließlich auch Robespierre so wie andere ihrer Kinder fraß, tröstet(e) wenig …
Da lächelte von oben herab Angela Davis auf den nachdenklich Hockenden. Ihr gegenüber Lenin oder der gut aussehende Zigarrenraucher aus dem bolivianischen Dschungel, der bei den Kommilitoninnen besonders gut ankam. Ernst schaute uns auch der Rauschebart aus Trier zu, dessen „Kapital“ war, dass wir es noch lasen in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften. Wenn wir uns nicht gar mit der „Dialektik der Aufklärung“ quälten. Wo allerdings Erich Frieds Satz „Es ist was es ist, sagt die Liebe“ zu lesen war, musste man davon ausgehen, dass die WehGenossen das markige Motto des jungen Alfred Kurella vergessen hatten: „Mädchen machen zufrieden, aber nicht revolutionär!“ – ein Satz, den Büchners Danton vermutlich unterschrieben hätte. Auch das Antlitz Bonhoeffers oder gar die sanfte Miene Sophie Scholls legten den Verdacht nahe, dass der kämpferische Elan politisch-revolutionären Eingreifens weicheren Haltungen gewichen war. Härte verbürgten hingegen die Konterfeis von „Meinhof und Baader“. Schließlich ließ uns der Satz Blochs „Auf 1000 Kriege kommt nur eine Revolution. So schwer ist der aufrechte Gang!“ stutzen – welchen wir dann im Aufstehen übten, um uns weiteren Tagesgeschäften zuzuwenden wie den unzähligen Blaumatrizen abgerungenen Flugblättern, der nächsten Diskussion um den am entferntesten liegenden Konflikt, der nächsten Aktion … und so fort.
Über die „notwendige“ Gewalt beim revolutionären Wandel der Welt sprachen wir viel, über die Opfer weniger; es sei denn, es handelte sich um die jeweiligen Revolutionäre selbst, die von der jeweiligen „Konterrevolution“ und „dem Faschismus“ bedroht oder gar ausgelöscht wurden. Jara, Theodorakis, Dylan und Baez sangen im Hintergrund, wenn wir tote Polizisten, bombenzerfetzte GIs, sterbende Banker und liquidierte Arbeitgeberpräsidenten allzu leichtfertig als „Kollateralschäden“ der Weltgeschichte abbuchten (das verzeihe ich uns nie).
Dann, in ein und demselben Semester: Büchner-Seminar, Solschenizyns „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, das erste Seminar zum Stalinismus. Da dämmerte Humanitäres herauf, das – einst christkatholisch begründet – nie ganz verschwunden war und stille Zweifel am Recht von Menschenopfern je schon genährt hatte.
Irgendwie wurde man dann allmählich zu Danton: des Kämpfens müde, ernüchtert von der blutigen Spur des „Kampfes“ für den „Fortschritt“ der Weltgeschichte, angeekelt von der Symbiose von Tugend und Terror, die ein asketischer Rechtsanwalt vor dem Jakobinerklub in intellektueller Brillanz mit amoralischer Härte entfaltete („Dantons Tod“, I. Akt, 3. Szene). Robespierre wurde für mich zum Antityp der von uns ersehnten revolutionären Aktion, an deren Notwendigkeit wir festhielten, ohne zu wissen, wie Umbrüche ohne Leichen zu bewerkstelligen wären. Dass die Revolution schließlich auch Robespierre so wie andere ihrer Kinder fraß, tröstet(e) wenig …
Heute sind wir älter, weiser (?), bequemer (!) geworden, distanzierte Augenzeugen revolutionärer Umtriebe jeglicher Art. Wir gewahren in sicherem Abstand auf europäischen Flachbildschirmen das Umschlagen von Freiheitswünschen in Tötungsfantasien und Mord. Schon die iranische Revolution kippte einst ins diktatorische Gegenteil, und der „Leuchtende Pfad“ führte ins „Herz der Finsternis“. Aus dem Arabischen Frühling ist der Winter mitmenschlicher Werte geworden. Die revolutionären Ideen auf dem Tian’anmen wurden einst von den Panzern der Macht zermalmt, die Demonstranten vom Tahrir löschten die Flamme der Freiheit selber aus und entzündeten den Brand des Bürgerkriegs. Ob die schleichend-diktatorische Erdoganisierung der Türkei die Blütenträume vom Gezi-Park verdorren oder neu erblühen lassen wird, ist offener denn je. Zehn Jahre nach 2004 schauen wir beunruhigt zum Majdan und fragen, ob die Orangene Revolution im Grau der Apparatschiks, der Oligarchen und der Gewöhnlichkeit politischer Korruption zu verblassen droht.
Auf der Bühne sehen wir nicht, wo es langgeht – aber wo es enden kann, wenn man bestimmte Pfade nach Utopia beschreitet, auf Abwege gerät und in Sackgassen endet, weil man vergessen hat, dass der Mensch ein Mensch ist … Und weil das so ist, gilt für das Leben und die Geschichte, für Revolten und Revolutionen das, was Beckett den Schauspielern, Regisseuren und Dramaturgen ins Stammbuch geschrieben hat: „Ever tried, ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better!“
Schauen wir also Danton und den Seinen beim Scheitern zu, geben wir uns selbst Gedankenfreiheit, lassen wir uns erschüttern durch die Abgründe, von denen jeder Mensch einer ist (wie Woyzeck meint).
„Und – Leute – nüch vajessen“ (Mario Barth): „Du lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit“ („Ermutigung“, Wolf Biermann) – auch wenn man weiß: „morgen sind wir durchgelaufene Schuhe, die man der Bettlerin Erde in den Schoß wirft“ (Danton zu Camille).
Justus H. Ulbricht ist als Germanist, Historiker und Pädagoge ein Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit (Erwachsenen- und Jugendbildung, Ausstellungen). Zahlreiche Vorträge, Bücher und Aufsätze zur Geschichte des deutschen Bildungsbürgertums, zur Kulturgeschichte Mitteldeutschlands und zur Religionsgeschichte im 20. Jahrhundert.
Auf der Bühne sehen wir nicht, wo es langgeht – aber wo es enden kann, wenn man bestimmte Pfade nach Utopia beschreitet, auf Abwege gerät und in Sackgassen endet, weil man vergessen hat, dass der Mensch ein Mensch ist … Und weil das so ist, gilt für das Leben und die Geschichte, für Revolten und Revolutionen das, was Beckett den Schauspielern, Regisseuren und Dramaturgen ins Stammbuch geschrieben hat: „Ever tried, ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better!“
Schauen wir also Danton und den Seinen beim Scheitern zu, geben wir uns selbst Gedankenfreiheit, lassen wir uns erschüttern durch die Abgründe, von denen jeder Mensch einer ist (wie Woyzeck meint).
„Und – Leute – nüch vajessen“ (Mario Barth): „Du lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit“ („Ermutigung“, Wolf Biermann) – auch wenn man weiß: „morgen sind wir durchgelaufene Schuhe, die man der Bettlerin Erde in den Schoß wirft“ (Danton zu Camille).
Justus H. Ulbricht ist als Germanist, Historiker und Pädagoge ein Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit (Erwachsenen- und Jugendbildung, Ausstellungen). Zahlreiche Vorträge, Bücher und Aufsätze zur Geschichte des deutschen Bildungsbürgertums, zur Kulturgeschichte Mitteldeutschlands und zur Religionsgeschichte im 20. Jahrhundert.



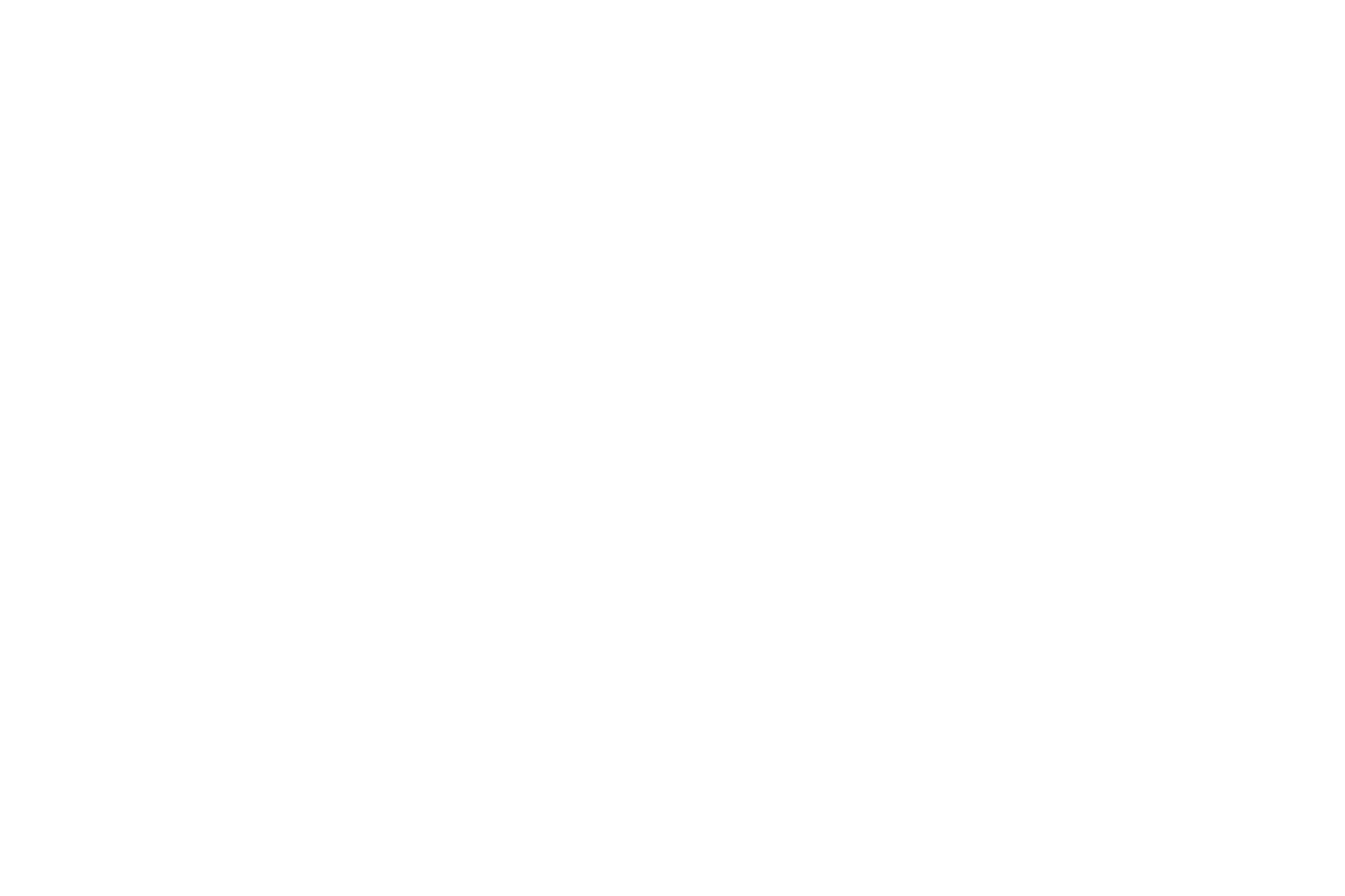




Die Frauen spielen bei Büchner eine untergeordnete Rolle, sind eher liebevolle Sehnsuchtsgestalten. Die Regisseurin wertet sie durch Zitate von Frauenrechtlerinnen auf. Yohanna Schwertfeger in der Doppelrolle als Julie und Lucile nimmt das Angebot an, verleiht ihren Figuren Anmut, Kraft und Kampfesmut. St. Just, der ‚Todesengel der Revolution‘, wird von Cathleen Baumann unerbittlich, entschlossen und zynisch gegeben. Sie höhnt vor dem Tribunal: ‚Es scheint einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut nicht wohl vertragen können.‘ Mit der Besetzung St. Just durch eine Schauspielerin setzt die Regie ein Zeichen: ‚Auch Frauen verantworten Krieg und Gewalt‘.
Der Radikaldemokrat Georg Büchner wusste, mit einer bloßen Idee ist die Gesellschaft nicht zu reformieren. Als eigentliche Triebfeder der Geschichte, als revolutionäres Element erkannte er ‚das Verhältnis zwischen Armen und Reichen‘. Das macht die dreistündige Dresdner Inszenierung deutlich und betont den von Büchner bedauerten ‚grässlichen Fatalismus der Geschichte‘. Der Abend lässt wenig Hoffnung, polemisiert gegen falsche Gewissheiten und bahnt dem Zweifel eine Gasse.“