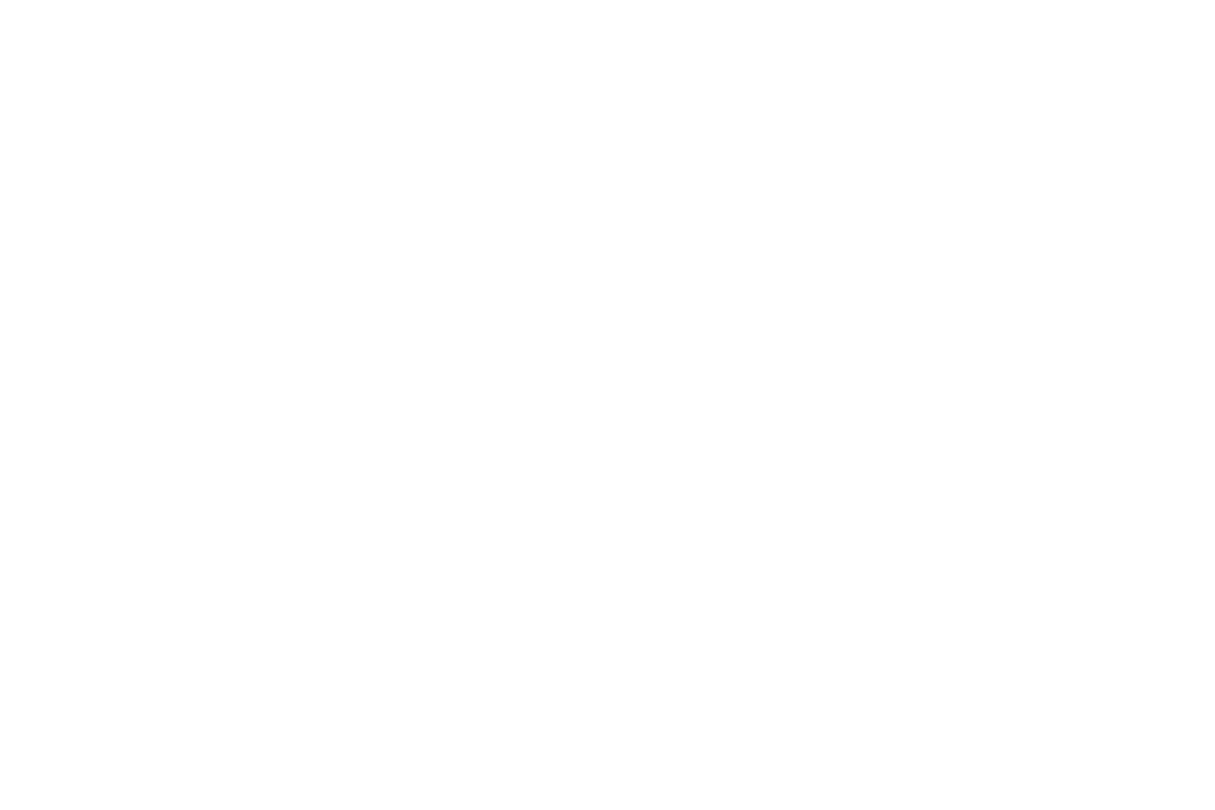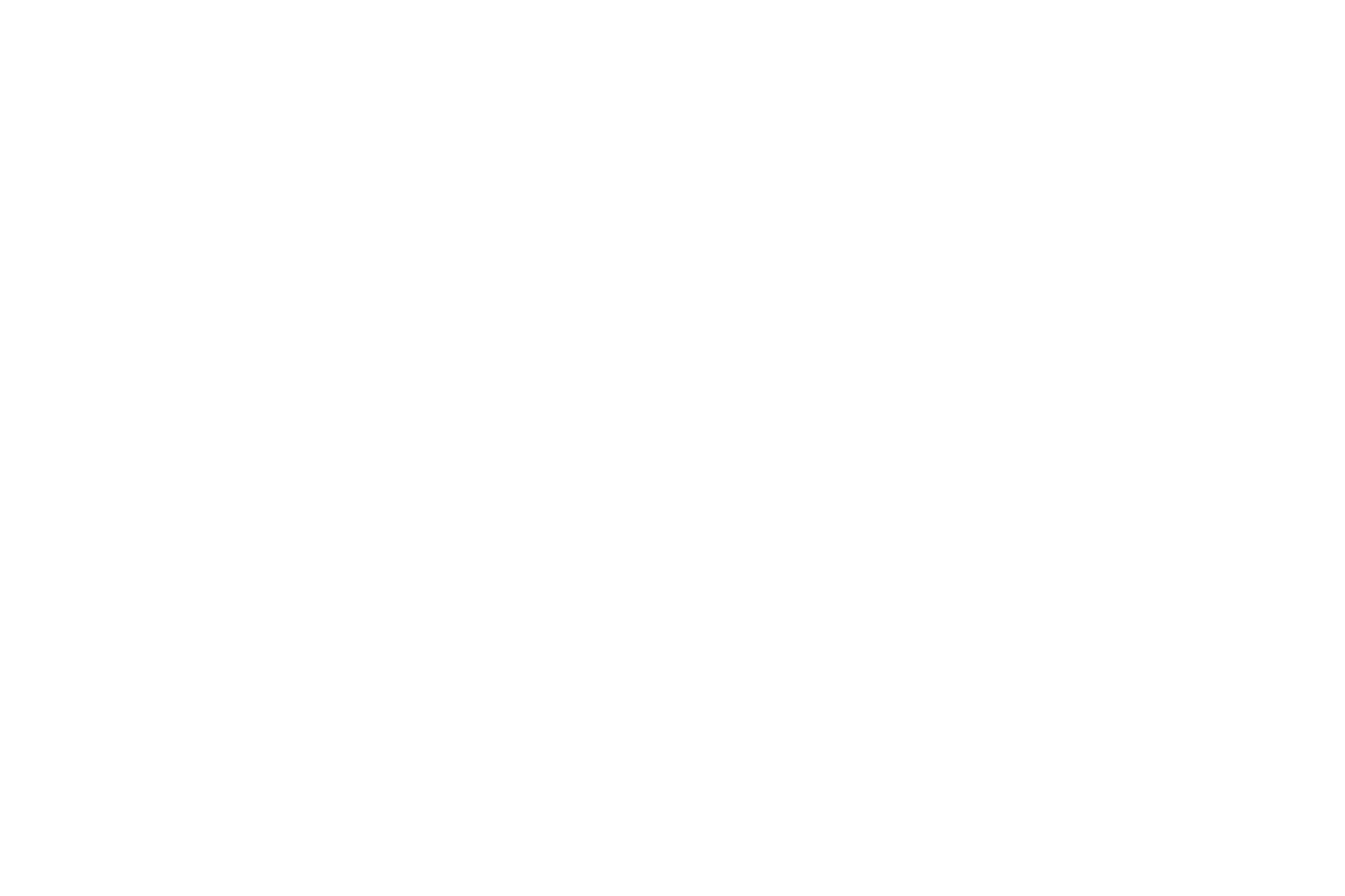Premiere 31.05.2014
› Schauspielhaus
Dämonen
nach dem Roman von Fjodor Dostojewskij
Deutsch von Swetlana Geier
Bühnenfassung von Friederike Heller und Felicitas Zürcher
Deutsch von Swetlana Geier
Bühnenfassung von Friederike Heller und Felicitas Zürcher
Handlung
Man hat sich gut eingerichtet in dem kleinen russischen Provinznest. Der liberale Intellektuelle Stepan Trofimowitsch führt seit 20 Jahren eine platonische Beziehung mit Warwara Petrowna, die ihn finanziell aushält, und trifft sich jede Woche mit seinen Freunden, um Karten zu spielen, zu trinken und über Atheismus oder Politik zu diskutieren. Doch dann kommen die Söhne nach Hause, Nikolaj und Pjotr, und entfesseln einen wahren nihilistischen Sturm. Stepans Sohn Pjotr versucht, in der Kleinstadt eine revolutionäre Gruppe zu bilden, um die Welt aus den Angeln zu heben. In Warwaras Sohn Nikolaj meint er, einen Führer für seine Bewegung zu erkennen, jemanden, der seinem Vorhaben zu einem Inhalt und einer Idee verhilft. Doch „Prinz Harry“, wie Nikolaj in Anlehnung an Shakespeares Prinzen genannt wird, ist zwar angezogen vom Verbrechen, aber gelangweilt vom Leben und will bloß die verschiedenen Modelle von Welterklärung verstärken. Gemeinsam lösen Pjotr und Nikolaj einen Rausch aus, an dessen Ende Machtbesessenheit und Terror steht und Mord und Totschlag die Stadt überzieht.
Dostojewskij begann 1870 in Dresden mit der Niederschrift seines fast 1000-seitigen Romans und erzählt darin von einem Generationenwechsel mit katastrophalen Folgen: Die liberalen Väter werden von den radikalisierten Söhnen abgelöst. „Keine Wegspur, nichts zu sehen, wissen wir noch, wo wir sind?“, stellt Dostojewskij dem Roman ein Gedicht Puschkins als Motto voran. Geschrieben im vorrevolutionären Russland und vor den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, scheint der Roman geradezu gespenstisch Nationalsozialismus, Demagogie und Terrorismus vorwegzunehmen.
Friederike Heller, Spezialistin für große Stoffe und ein neues episches Theater, nimmt sich mit „Dämonen“ einen Klassiker der Weltliteratur vor.
Dostojewskij begann 1870 in Dresden mit der Niederschrift seines fast 1000-seitigen Romans und erzählt darin von einem Generationenwechsel mit katastrophalen Folgen: Die liberalen Väter werden von den radikalisierten Söhnen abgelöst. „Keine Wegspur, nichts zu sehen, wissen wir noch, wo wir sind?“, stellt Dostojewskij dem Roman ein Gedicht Puschkins als Motto voran. Geschrieben im vorrevolutionären Russland und vor den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, scheint der Roman geradezu gespenstisch Nationalsozialismus, Demagogie und Terrorismus vorwegzunehmen.
Friederike Heller, Spezialistin für große Stoffe und ein neues episches Theater, nimmt sich mit „Dämonen“ einen Klassiker der Weltliteratur vor.
Besetzung
Regie
Friederike Heller
Bühne und Kostüme
Sabine Kohlstedt
Musik
Peter Thiessen
Licht
Michael Gööck
Dramaturgie
Felicitas Zürcher
Stepan Werchowenskij
Warwara Petrowna, Gutsbesitzerin
Nele Rosetz
Nikolaj Stawrogin, Warwaras Sohn
André Kaczmarczyk
Pjotr Werchowenskij, Stepans Sohn
Thomas Braungardt
Jelisaweta Nikolajewna (Lisa), Warwaras Nichte
Nadine Quittner
Mawrikij Wirginskij
Benjamin Pauquet
Marja Lebjadkina
Cathleen Baumann
Lebjadkin, Hauptmann a. D., Marjas Bruder
Ben Daniel Jöhnk
Schatow
Jonas Friedrich Leonhardi
Kirillow
Duran Özer
Elektronik, Gesang, Klavier
Peter Thiessen
Schlagzeug, Elektronik
Sebastian Vogel
Video
Pressestimmen
Ein Porträt der Regisseurin Friederike Heller
von Peter Michalzik
Die „Dreigroschenoper“ in Dresden und die „Antigone“ an der Berliner Schaubühne, sagt Friederike Heller, wenn man sie fragt, auf welche Aufführung sie stolz ist oder, bescheidener, welche sie immer noch mag. Die „Antigone“ in Berlin, das war 2011. Die Aufführung sollte sich, das war der Plan, sozusagen ins Urgestein der Dramatik zurückgraben. Es gibt immer nur einen Protagonisten und einen Antagonisten. Mit dabei Hamburgs Indie-Rocker „Kante“ als Chor, das Ganze im Stil eines Popkonzerts, und das war’s. Dazu aber kamen die gedankliche Strenge von Hölderlins Übersetzung und diverse Krankheiten der Schauspieler während der Proben. „Dadurch wurden die Proben persönlich intensiv und gedanklich befreiend“, sagt Heller.
So setzte sich fort, was sie ein Jahr zuvor in Berlin mit „Der gute Mensch von Sezuan“ ausprobiert hatte: Pop, Diskurs, Albernheit, episches Theater, zugleich zeitgemäß lockeres und textvernarrtes Brecht-Spiel. In Dresden konnte man dann sehen, wie befreiend und unterhaltsam das sein kann. In der „Dreigroschenoper“, Premiere war im September 2012, ergibt das eine varietéhafte, sehr lustige Inszenierung. Sie lebt von der enormen Lust der Darsteller, dauernd mit sich selbst, der Bühne und der Situation zu spielen. Man hat das Gefühl, Heller habe das Stück geschüttelt, bis wieder die Gegenwart durch die Ritzen dringt und die Schauspieler zum Stück und zum Stoff kommen. Und die guten, alten Songs klingen auch wieder wie neu.
Das ist keineswegs selbstverständlich. Die Theatergeschichte, muss man sagen, steckt fest, was Brecht angeht. Bis 2026 darf man ihn nicht verändern. Was nur macht man bis dahin mit diesem Brecht und seinem V-Effekt? Ihn am besten gar nicht spielen? Es hat sich in der Welt doch ohnehin so viel verfremdet, alles ist sich selbst fremd geworden. Wieso da also Brecht mit angestaubtem V-Effekt spielen? Alles bei Brecht wirkt irgendwie festgefahren. Und besonders festgefahren wirkt die totgenudelte „Dreigroschenoper“.
Heller findet auf das Dilemma eine zugleich intelligente und unterhaltsame Antwort. Sie wendet sozusagen Brecht auf Brecht an. Sie verfremdet Brecht selbst, öffnet ihn, bleibt aber, was man muss, dem Original treu.
Heller gibt der Szene Subtexte, die man nur spüren, nicht aber wissen kann. Es gibt eine weitere Ebene, die irritiert und befreit. Sozusagen einen neuen V-Effekt. Ganz nebenbei zeigt sich so, dass vielleicht fast alles Theater seit Brecht episches Theater ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Heller selbst sagt, so sei Theater doch überhaupt. Man habe eine Rahmung, das ist die Unterhaltung, und darin könne man mit tödlichem Ernst herumspielen. Sie schwärmt von den spielerisch aufgelegten Dresdner Schauspielern, die daneben aber doch Interesse hatten, durch die Konstruktion hindurchzusteigen – und nicht nur in den Songs von Mackie Messer zu baden.
Heller ist tatsächlich fasziniert von Brecht. „Er macht mit seinen Figuren, Plots und Situationen starke Setzungen, er hat einen beherzten Ton, gleichzeitig ist das ein permanentes Infragestellen. Dieses Pendeln macht großen Spaß.“
„In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen“, zitiert Heller den Meister. „Das ist doch eine superspannende Grundvoraussetzung für einen Regisseur.“ Und es passe auch zum verspielten Ernst des Theaters. Heller mag es nicht, wenn das Theater im Kulturbetrieb immer noch als Wahrsprech-Instanz wahrgenommen wird. „Die Pole-Position des Theaters ist lange verloren. Es ist eine eigenartige Lage entstanden: Man meint es immer noch ernst, wenn man Theater macht, gleichzeitig wird es nicht mehr so wahrgenommen. Wenn man es da schafft, eine gute Setzung hinzubekommen, das ist der Spaß. Wenn der Funke fliegt, dann gehen im Kopf die Türen auf. Auf der Bühne und im Saal.“
Für die Arbeit bedeutet das, dass man irgendwann die Schauspieler auffordert, zu zeigen, dass sie zeigen. Das ist der klassische V-Effekt. „Das sagt sich leicht, ist aber maximal kompliziert. Der Schauspieler muss akzeptieren, dass das, was er behauptet, nur einen gewissen Grad von Realität hat, dass alle anderen genau das wissen und dieses Rollenspiel als solches angreifen können. Das ist schmerzlich real. Schauspieler leiden dann oft.“
Wenn man ihr entgegenhält, dass das Sich-selbst-Kommentieren und Mit-sich-selbst-Spielen seit der Volksbühne der 1990er-Jahre doch zum guten Ton im Theater gehört, gibt Heller eine überraschende Antwort: „Ja, schon. Aber viele Leute sind im Theater auf der Suche nach Realität. Es geht darum, den Flurschaden, den Castorf angerichtet hat, zu begrenzen.“ Damit meint sie nicht, das zurückzunehmen, sondern: in der Ambivalenz, die sich daraus ergibt, den Punkt zu finden, an dem es real wird.
So setzte sich fort, was sie ein Jahr zuvor in Berlin mit „Der gute Mensch von Sezuan“ ausprobiert hatte: Pop, Diskurs, Albernheit, episches Theater, zugleich zeitgemäß lockeres und textvernarrtes Brecht-Spiel. In Dresden konnte man dann sehen, wie befreiend und unterhaltsam das sein kann. In der „Dreigroschenoper“, Premiere war im September 2012, ergibt das eine varietéhafte, sehr lustige Inszenierung. Sie lebt von der enormen Lust der Darsteller, dauernd mit sich selbst, der Bühne und der Situation zu spielen. Man hat das Gefühl, Heller habe das Stück geschüttelt, bis wieder die Gegenwart durch die Ritzen dringt und die Schauspieler zum Stück und zum Stoff kommen. Und die guten, alten Songs klingen auch wieder wie neu.
Das ist keineswegs selbstverständlich. Die Theatergeschichte, muss man sagen, steckt fest, was Brecht angeht. Bis 2026 darf man ihn nicht verändern. Was nur macht man bis dahin mit diesem Brecht und seinem V-Effekt? Ihn am besten gar nicht spielen? Es hat sich in der Welt doch ohnehin so viel verfremdet, alles ist sich selbst fremd geworden. Wieso da also Brecht mit angestaubtem V-Effekt spielen? Alles bei Brecht wirkt irgendwie festgefahren. Und besonders festgefahren wirkt die totgenudelte „Dreigroschenoper“.
Heller findet auf das Dilemma eine zugleich intelligente und unterhaltsame Antwort. Sie wendet sozusagen Brecht auf Brecht an. Sie verfremdet Brecht selbst, öffnet ihn, bleibt aber, was man muss, dem Original treu.
Heller gibt der Szene Subtexte, die man nur spüren, nicht aber wissen kann. Es gibt eine weitere Ebene, die irritiert und befreit. Sozusagen einen neuen V-Effekt. Ganz nebenbei zeigt sich so, dass vielleicht fast alles Theater seit Brecht episches Theater ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
Heller selbst sagt, so sei Theater doch überhaupt. Man habe eine Rahmung, das ist die Unterhaltung, und darin könne man mit tödlichem Ernst herumspielen. Sie schwärmt von den spielerisch aufgelegten Dresdner Schauspielern, die daneben aber doch Interesse hatten, durch die Konstruktion hindurchzusteigen – und nicht nur in den Songs von Mackie Messer zu baden.
Heller ist tatsächlich fasziniert von Brecht. „Er macht mit seinen Figuren, Plots und Situationen starke Setzungen, er hat einen beherzten Ton, gleichzeitig ist das ein permanentes Infragestellen. Dieses Pendeln macht großen Spaß.“
„In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen“, zitiert Heller den Meister. „Das ist doch eine superspannende Grundvoraussetzung für einen Regisseur.“ Und es passe auch zum verspielten Ernst des Theaters. Heller mag es nicht, wenn das Theater im Kulturbetrieb immer noch als Wahrsprech-Instanz wahrgenommen wird. „Die Pole-Position des Theaters ist lange verloren. Es ist eine eigenartige Lage entstanden: Man meint es immer noch ernst, wenn man Theater macht, gleichzeitig wird es nicht mehr so wahrgenommen. Wenn man es da schafft, eine gute Setzung hinzubekommen, das ist der Spaß. Wenn der Funke fliegt, dann gehen im Kopf die Türen auf. Auf der Bühne und im Saal.“
Für die Arbeit bedeutet das, dass man irgendwann die Schauspieler auffordert, zu zeigen, dass sie zeigen. Das ist der klassische V-Effekt. „Das sagt sich leicht, ist aber maximal kompliziert. Der Schauspieler muss akzeptieren, dass das, was er behauptet, nur einen gewissen Grad von Realität hat, dass alle anderen genau das wissen und dieses Rollenspiel als solches angreifen können. Das ist schmerzlich real. Schauspieler leiden dann oft.“
Wenn man ihr entgegenhält, dass das Sich-selbst-Kommentieren und Mit-sich-selbst-Spielen seit der Volksbühne der 1990er-Jahre doch zum guten Ton im Theater gehört, gibt Heller eine überraschende Antwort: „Ja, schon. Aber viele Leute sind im Theater auf der Suche nach Realität. Es geht darum, den Flurschaden, den Castorf angerichtet hat, zu begrenzen.“ Damit meint sie nicht, das zurückzunehmen, sondern: in der Ambivalenz, die sich daraus ergibt, den Punkt zu finden, an dem es real wird.
Heller liebt die Ambivalenz, immer wieder spricht sie vom „Pendeln“, und wenn sie „Dialektik“ sagt, meint sie vor allem ein spielerisches, leichtes Hin und Her. Das Pendeln, könnte man sagen, bestimmt auch ihren Weg. Am Anfang ihrer Karriere, vor etwa zehn Jahren, war Handke, was Brecht heute ist. Das Burgtheater wollte, dass sie die zweite Aufführung von Handkes „Untertagblues“, ein Weltverachtungsdrama, inszeniert. Sie mochte den frühen Handke, dieses Stück aber mochte sie gar nicht. Handke hatte, so dachte sie, Witz und Biss verloren.
Sie machte das Stück trotzdem, entschied sich aber, es auf eine weniger verschwurbelte Situation als die in der U-Bahn herunterzubrechen. Den selbstmitleidigen Weltschmerzmonolog von Handkes „wildem Mann“ spielte dieser Mann nicht mit U-Bahn-Passagieren, sondern mit sich selbst und dem Publikum, und er musste sich dabei gegen Disco, Livemusik und Tanz durchsetzen. Von dieser überzeugenden Inszenierung an war Heller die bekannteste Zweitaufführungs- und für ein paar Jahre auch die wichtigste Handke-Regisseurin im deutschsprachigen Theater.
Spielerische Ironie und ein beherzter, intelligenter Zugriff auf den Text mischten sich. Heller machte zwei weitere Handke-Stücke und fand Gefallen an dem Autor, auch an seinen späteren Stücken, vor allem am „Pendeln“ in der Sprache, wie sie heute sagt. „Bis ich in Gefahr war, zur Handke-Tante abgestempelt zu werden. Da bewegte sich das Pendel von Handke weg.“
Holen wir hier, ganz undialektisch und unausgependelt, noch schnell ein paar Daten nach. Im Dresdner Theater in der Fabrik hat sie 2000, noch vor der Handke-Phase, ihre Karriere begonnen. In Hamburg hatte sie zuvor studiert, und 1974 ist sie geboren. Heute lebt sie in Berlin, wo sie herkommt, mit ihrem Mann, dem Regisseur Patrick Wengenroth, und zwei Kindern, fünf und sieben Jahre alt. In Dresden hat sie in den letzten Jahren Goethes „Wilhelm Meister“ und Peter Weiss’ „Marat/Sade“ inszeniert. Und sie unterrichtet in Hamburg und Berlin.
Nachdem die letzte Spielzeit mit „Black Rider“ (an der Schaubühne) und der „Dreigroschenoper“ für sie die „Showspielzeit“ war, will sie sich nun vom Selbstreferenziellen, das doch auch im Zeigen des Zeigens steckt, wegbewegen und gesellschaftlich relevanteren Themen folgen. „Wenn man es hart formuliert“, sagt sie, „geht es um die faschistoiden Tendenzen einer Gesellschaft, die selbst nicht glaubt, dass sie es sei. Ich sehe das im Umgang miteinander. Wie sehr in der Wirtschaft und in der Kunst geschummelt und betrogen wird, wie da die Willkür herrscht und wie kalt lächelnd man ignoriert, dass man ganz genau weiß, dass man das tut. Wir verkaufen uns alle und finden es auch noch ganz in Ordnung. Wir tun so, als sei alles in Ordnung, und in Wahrheit ist nichts in Ordnung.“
Im Frühling 2014 inszeniert Friederike Heller Dostojewskijs Roman „Dämonen“, in dem traditionelle Wertesysteme verschiedener Ideologien aufeinanderprallen.
Peter Michalzik ist Journalist, Theaterkritiker und Autor und arbeitet als Feuilletonredakteur bei der Frankfurter Rundschau. Zuletzt erschien 2011 seine Kleist-Biografie KLEIST – DICHTER, KRIEGER, SEELENSUCHER.
Sie machte das Stück trotzdem, entschied sich aber, es auf eine weniger verschwurbelte Situation als die in der U-Bahn herunterzubrechen. Den selbstmitleidigen Weltschmerzmonolog von Handkes „wildem Mann“ spielte dieser Mann nicht mit U-Bahn-Passagieren, sondern mit sich selbst und dem Publikum, und er musste sich dabei gegen Disco, Livemusik und Tanz durchsetzen. Von dieser überzeugenden Inszenierung an war Heller die bekannteste Zweitaufführungs- und für ein paar Jahre auch die wichtigste Handke-Regisseurin im deutschsprachigen Theater.
Spielerische Ironie und ein beherzter, intelligenter Zugriff auf den Text mischten sich. Heller machte zwei weitere Handke-Stücke und fand Gefallen an dem Autor, auch an seinen späteren Stücken, vor allem am „Pendeln“ in der Sprache, wie sie heute sagt. „Bis ich in Gefahr war, zur Handke-Tante abgestempelt zu werden. Da bewegte sich das Pendel von Handke weg.“
Holen wir hier, ganz undialektisch und unausgependelt, noch schnell ein paar Daten nach. Im Dresdner Theater in der Fabrik hat sie 2000, noch vor der Handke-Phase, ihre Karriere begonnen. In Hamburg hatte sie zuvor studiert, und 1974 ist sie geboren. Heute lebt sie in Berlin, wo sie herkommt, mit ihrem Mann, dem Regisseur Patrick Wengenroth, und zwei Kindern, fünf und sieben Jahre alt. In Dresden hat sie in den letzten Jahren Goethes „Wilhelm Meister“ und Peter Weiss’ „Marat/Sade“ inszeniert. Und sie unterrichtet in Hamburg und Berlin.
Nachdem die letzte Spielzeit mit „Black Rider“ (an der Schaubühne) und der „Dreigroschenoper“ für sie die „Showspielzeit“ war, will sie sich nun vom Selbstreferenziellen, das doch auch im Zeigen des Zeigens steckt, wegbewegen und gesellschaftlich relevanteren Themen folgen. „Wenn man es hart formuliert“, sagt sie, „geht es um die faschistoiden Tendenzen einer Gesellschaft, die selbst nicht glaubt, dass sie es sei. Ich sehe das im Umgang miteinander. Wie sehr in der Wirtschaft und in der Kunst geschummelt und betrogen wird, wie da die Willkür herrscht und wie kalt lächelnd man ignoriert, dass man ganz genau weiß, dass man das tut. Wir verkaufen uns alle und finden es auch noch ganz in Ordnung. Wir tun so, als sei alles in Ordnung, und in Wahrheit ist nichts in Ordnung.“
Im Frühling 2014 inszeniert Friederike Heller Dostojewskijs Roman „Dämonen“, in dem traditionelle Wertesysteme verschiedener Ideologien aufeinanderprallen.
Peter Michalzik ist Journalist, Theaterkritiker und Autor und arbeitet als Feuilletonredakteur bei der Frankfurter Rundschau. Zuletzt erschien 2011 seine Kleist-Biografie KLEIST – DICHTER, KRIEGER, SEELENSUCHER.