Uraufführung 28.03.2013
› Kleines Haus 3
Cash. Das Geldstück
Dresdner spekulieren
Ein Projekt von Melanie Hinz und Sinje Kuhn
Ein Projekt von Melanie Hinz und Sinje Kuhn
Handlung
Über Geld spricht man nicht. Damit ist jetzt Schluss. Zwölf Dresdnerinnen und Dresdner machen in „Cash. Das Geldstück“ öffentlich Kassensturz und lüften ihr Bankgeheimnis. Sie sagen, was sie haben und geben preis, was sie nicht haben. Sie bringen auf die Bühne, was es braucht, um – endlich mal – über Geld zu sprechen: ihre Sparbücher, Aktienzertifikate, Schuldscheine, Gehaltszettel, Kontoauszüge, den gestrigen Saldo und ihr letztes Hemd. Und sie werden Sie im Publikum konfrontieren mit Kontoständen, mit roten und schwarzen Zahlen, mit Summen, Bilanzen und monetären Werten.
Die Spur des Geldes führt die zwölf Spielerinnen und Spieler in einen Tresorraum. Diesen gilt es zu knacken und einzusteigen in den Erinnerungsspeicher des eigenen Geldlebens: Das erste Taschengeld, das erste selbstverdiente Lehrlingsgehalt, die ersten 100 Westmark, der erste Gehaltsbonus, der erste Tausender Gewinn auf dem Börsenparkett. Lebensgeschichten lassen sich auch als Geldgeschichten erzählen. Die Spieler und Spielerinnen auf der „Cash“-Bühne offenbaren ihre Geldbiographien. Sie beichten von Luxusurlauben und der verzockten Million. Sie erzählen von der wundersamen Vermehrung des Euros in der Einwanderer-Community, von reichen Russen und armen Schweinen. Sie berichten von Prostitution im kleinen und von Aktienhandel im großen Rahmen. Sie wissen um den üblen Geruch des Geldes und die schwarzen Spuren, die die Ostpfennige auf den Fingern hinterließen. Sie zählen Eins und Eins zusammen, schreiben rote Zahlen, rechnen, tauschen, spekulieren, demonstrieren und bilanzieren. Bezahlen lassen sie sich dafür mit der Aufmerksamkeit und der Gunst des Publikums: Was hat dieser Theaterabend eigentlich gekostet? Und, was ist Ihnen dieser Abend wert? „Cash“ setzt alles auf eine Karte. Folgen Sie der Spur des Geldes im Kleinen Haus 3.
Die Spur des Geldes führt die zwölf Spielerinnen und Spieler in einen Tresorraum. Diesen gilt es zu knacken und einzusteigen in den Erinnerungsspeicher des eigenen Geldlebens: Das erste Taschengeld, das erste selbstverdiente Lehrlingsgehalt, die ersten 100 Westmark, der erste Gehaltsbonus, der erste Tausender Gewinn auf dem Börsenparkett. Lebensgeschichten lassen sich auch als Geldgeschichten erzählen. Die Spieler und Spielerinnen auf der „Cash“-Bühne offenbaren ihre Geldbiographien. Sie beichten von Luxusurlauben und der verzockten Million. Sie erzählen von der wundersamen Vermehrung des Euros in der Einwanderer-Community, von reichen Russen und armen Schweinen. Sie berichten von Prostitution im kleinen und von Aktienhandel im großen Rahmen. Sie wissen um den üblen Geruch des Geldes und die schwarzen Spuren, die die Ostpfennige auf den Fingern hinterließen. Sie zählen Eins und Eins zusammen, schreiben rote Zahlen, rechnen, tauschen, spekulieren, demonstrieren und bilanzieren. Bezahlen lassen sie sich dafür mit der Aufmerksamkeit und der Gunst des Publikums: Was hat dieser Theaterabend eigentlich gekostet? Und, was ist Ihnen dieser Abend wert? „Cash“ setzt alles auf eine Karte. Folgen Sie der Spur des Geldes im Kleinen Haus 3.
Besetzung
Regie
Melanie Hinz
Co-Regie
Sinje Kuhn
Bühne und Kostüme
Tatjana Kautsch
Musik
Dramaturgie
Sinje Kuhn
Licht
Andreas Kunert
Mit
Ute Maria Buchmüller, Konstantin Burudshiew, Uwe Delkus, Guido Droth, Katharina Heider, Stefan Hintersatz, Helmut Hopfauf, Larissa Letz, Bernd Räder, Kornelia Schmidt, Andrea Schmitz, Eduard Zhukov
Video
Die Regisseure Clemens Bechtel, Melanie Hinz, Marc Prätsch und Miriam Tscholl reflektieren die Arbeit der Dresdner Bürgerbühne und ihren persönlichen künstlerischen Ansatz
Die Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden geht in ihre vierte Spielzeit. Zeit, über Ästhetiken und Zugänge, Unterschiede und Übereinstimmungen zu diskutieren. Denn die Qualität der Bürgerbühne liegt in ihrer künstlerischen und konzeptionellen Vielfalt. Der Dramaturg Ole Georg Graf hat mit vier Regisseuren, die in der kommenden Spielzeit an der Bürgerbühne inszenieren werden, über ihre Arbeit diskutiert.
Ole Georg Graf:Wie sind Sie zum Theater gekommen? Und wie kommt es dazu, dass man selber Projekte inszeniert?
Clemens Bechtel: Ich hatte eigentlich nie viel mit Theater zu tun. Nach dem Abitur wollte ich Journalist werden. Die Eingebung, Regisseur werden zu wollen, hing sicherlich – so würde ich es jedenfalls heute sagen – mit einer Lust am Spielraum zusammen und mit der Lust, Menschen auf eine Weise kennenzulernen, wie man sie in anderen Feldern nicht kennenlernen kann. Das zu organisieren und zu strukturieren und sehend zu erleben, ist ein Punkt, der mir in diesem Beruf sehr wichtig ist.
Melanie Hinz: Bei mir gab es ein markantes Ereignis: Beim Schultheater habe ich nie die Rolle bekommen, die ich wollte. Da kam die Idee auf, mit anderen selber ein Stück zu machen. Der Theaterlehrer war nie da, nur kurz vor der Premiere, und da hat er uns beschimpft, dass das alles große Scheiße wäre. Hinterher hatte das Stück großen Erfolg, und ich dachte: Mensch, ich brauch gar keinen Theaterlehrer, ich mach das einfach selber. Also habe ich mit 16 eine eigene Gruppe gegründet, selber auch Texte geschrieben und gespielt. Ich arbeite immer noch meistens im Kollektiv. Ich will die Macht über das, was man erzählen will, nicht aufteilen in Regie, Dramaturgie, Autorin, Darstellerin. Aber in einer kollektiven Arbeit macht man auch Kompromisse. Ausschließlich Regie führe ich nur am Staatsschauspiel Dresden. Besonders finde ich, dass ich ein Thema und einen Begegnungsraum stiften kann. Mein Theaterkontext ist extrem offen, und in der Arbeit werde ich dann mit den eigenen Wirklichkeiten von Menschen konfrontiert – das finde ich ein spannendes Feld, das ich in der Bürgerbühne installieren kann. In unserem Kollektiv sind wir dagegen auch eine Art geschlossener Zirkel. Außerdem finde ich es interessant, für verschiedene Publikumsgruppen zu arbeiten.
Marc Prätsch, Sie sind Schauspieler und Regisseur und arbeiten mit professionellen Schauspielern und jugendlichen Laien. Wie sind Sie vom Schauspiel zur Regie gekommen?
Marc Prätsch: Als Schauspieler habe ich mich unterfordert gefühlt. Ich wollte mehr mitbestimmen – wie man arbeitet, wie man miteinander umgeht, bis hin zu künstlerischen Fragen. Irgendwann musst du konsequent sein und nicht immer nur rumnörgeln. Irgendwann wurde mir klar, dass ich den Schritt vollziehen muss, Regie zu führen. Ich bin als Schauspieler vielleicht auch gar nicht so geeignet. Ich möchte gar nicht mehr jeden Tag auf der Bühne stehen. Die Arbeiten als Schauspieler mit den Regisseuren Johann Kresnik und Armin Petras waren für mich schließlich Impulsgeber, um zu sagen, ich will auch machen, was die machen.
Miriam Tscholl: Ich komme aus einem Dorf im Schwarzwald. Dort habe ich immer Dinge erfunden, die es noch nicht gab, weil es dort nichts gab. Und das exzessiv. Theaterstücke. Konzerte. Nach der Schule habe ich das ad acta gelegt und beschlossen, einen richtigen Beruf zu erlernen. Nach sechs Semestern Architektur musste ich mir eingestehen: Das kann ich nicht. Ich bin schlecht. Ich interessiere mich nicht für Häuser, sondern für Menschen und die Gesellschaft. Daraufhin habe ich angefangen, Angewandte Theaterwissenschaft und ästhetische Praxis in Hildesheim zu studieren, ohne zu wissen, was das werden könnte. In der praktischen Arbeit dort habe ich gemerkt: Ich möchte das in die Hand nehmen, gestalten, meine Ideen reinbringen – und dort, beim Regieführen, hat sich vieles, was ich bis dahin gemacht habe, zusammengefügt.
Was macht einen professionellen Künstler aus? Und was ist der Vorteil eines Nichtprofis in der künstlerischen Arbeit?
Clemens Bechtel: Was ich toll finde an der Arbeit mit Nichtschauspielern, ist die Art, wie Menschen den ihnen fremden Raum Theater betreten – das hat etwas zu tun mit dem Impuls, den auch ich anfangs hatte. Und jenseits der Frage „professioneller Künstler“ oder „nichtprofessioneller Künstler“ bewege ich mich nach 15 Jahren im Beruf über das dokumentarische Theater, das ich auch mache, plötzlich auch außerhalb des Theaters. Auf einmal bewege ich mich aus dem Probebühnen- und Kantinenkontext hinaus. Auf einmal sitze ich während einer Recherche im Bundestag oder bei Leuten zu Hause. Ich komme woandershin – und es freut mich, diese Menschen, diese Themen und diese Welt umgekehrt wieder in das Theater einzuladen.
Melanie Hinz: Ich bringe in die Arbeit mit Laien die Professionalität ein, wie man etwas rahmen kann. Dieser Schutzraum, in dem eine Darstellung überhaupt funktionieren kann, den setze ich. Aber der Prozess ist von meinem Interesse an den Darstellerinnen und Darstellern geleitet. Und die wiederum haben unter Umständen ein ganz anderes Verständnis davon, was Theater ist, als ich.
Miriam Tscholl: Es ist ein anstrengender und schwieriger Prozess. Denn man steht am Anfang mit leeren Händen da. In der Arbeit mit Nichtprofis ist von uns Regisseuren Beobachtung, aber auch Empathie gefragt. Theater entwickeln heißt eben auch Leben entdecken und Menschen erforschen.
Ole Georg Graf:Wie sind Sie zum Theater gekommen? Und wie kommt es dazu, dass man selber Projekte inszeniert?
Clemens Bechtel: Ich hatte eigentlich nie viel mit Theater zu tun. Nach dem Abitur wollte ich Journalist werden. Die Eingebung, Regisseur werden zu wollen, hing sicherlich – so würde ich es jedenfalls heute sagen – mit einer Lust am Spielraum zusammen und mit der Lust, Menschen auf eine Weise kennenzulernen, wie man sie in anderen Feldern nicht kennenlernen kann. Das zu organisieren und zu strukturieren und sehend zu erleben, ist ein Punkt, der mir in diesem Beruf sehr wichtig ist.
Melanie Hinz: Bei mir gab es ein markantes Ereignis: Beim Schultheater habe ich nie die Rolle bekommen, die ich wollte. Da kam die Idee auf, mit anderen selber ein Stück zu machen. Der Theaterlehrer war nie da, nur kurz vor der Premiere, und da hat er uns beschimpft, dass das alles große Scheiße wäre. Hinterher hatte das Stück großen Erfolg, und ich dachte: Mensch, ich brauch gar keinen Theaterlehrer, ich mach das einfach selber. Also habe ich mit 16 eine eigene Gruppe gegründet, selber auch Texte geschrieben und gespielt. Ich arbeite immer noch meistens im Kollektiv. Ich will die Macht über das, was man erzählen will, nicht aufteilen in Regie, Dramaturgie, Autorin, Darstellerin. Aber in einer kollektiven Arbeit macht man auch Kompromisse. Ausschließlich Regie führe ich nur am Staatsschauspiel Dresden. Besonders finde ich, dass ich ein Thema und einen Begegnungsraum stiften kann. Mein Theaterkontext ist extrem offen, und in der Arbeit werde ich dann mit den eigenen Wirklichkeiten von Menschen konfrontiert – das finde ich ein spannendes Feld, das ich in der Bürgerbühne installieren kann. In unserem Kollektiv sind wir dagegen auch eine Art geschlossener Zirkel. Außerdem finde ich es interessant, für verschiedene Publikumsgruppen zu arbeiten.
Marc Prätsch, Sie sind Schauspieler und Regisseur und arbeiten mit professionellen Schauspielern und jugendlichen Laien. Wie sind Sie vom Schauspiel zur Regie gekommen?
Marc Prätsch: Als Schauspieler habe ich mich unterfordert gefühlt. Ich wollte mehr mitbestimmen – wie man arbeitet, wie man miteinander umgeht, bis hin zu künstlerischen Fragen. Irgendwann musst du konsequent sein und nicht immer nur rumnörgeln. Irgendwann wurde mir klar, dass ich den Schritt vollziehen muss, Regie zu führen. Ich bin als Schauspieler vielleicht auch gar nicht so geeignet. Ich möchte gar nicht mehr jeden Tag auf der Bühne stehen. Die Arbeiten als Schauspieler mit den Regisseuren Johann Kresnik und Armin Petras waren für mich schließlich Impulsgeber, um zu sagen, ich will auch machen, was die machen.
Miriam Tscholl: Ich komme aus einem Dorf im Schwarzwald. Dort habe ich immer Dinge erfunden, die es noch nicht gab, weil es dort nichts gab. Und das exzessiv. Theaterstücke. Konzerte. Nach der Schule habe ich das ad acta gelegt und beschlossen, einen richtigen Beruf zu erlernen. Nach sechs Semestern Architektur musste ich mir eingestehen: Das kann ich nicht. Ich bin schlecht. Ich interessiere mich nicht für Häuser, sondern für Menschen und die Gesellschaft. Daraufhin habe ich angefangen, Angewandte Theaterwissenschaft und ästhetische Praxis in Hildesheim zu studieren, ohne zu wissen, was das werden könnte. In der praktischen Arbeit dort habe ich gemerkt: Ich möchte das in die Hand nehmen, gestalten, meine Ideen reinbringen – und dort, beim Regieführen, hat sich vieles, was ich bis dahin gemacht habe, zusammengefügt.
Was macht einen professionellen Künstler aus? Und was ist der Vorteil eines Nichtprofis in der künstlerischen Arbeit?
Clemens Bechtel: Was ich toll finde an der Arbeit mit Nichtschauspielern, ist die Art, wie Menschen den ihnen fremden Raum Theater betreten – das hat etwas zu tun mit dem Impuls, den auch ich anfangs hatte. Und jenseits der Frage „professioneller Künstler“ oder „nichtprofessioneller Künstler“ bewege ich mich nach 15 Jahren im Beruf über das dokumentarische Theater, das ich auch mache, plötzlich auch außerhalb des Theaters. Auf einmal bewege ich mich aus dem Probebühnen- und Kantinenkontext hinaus. Auf einmal sitze ich während einer Recherche im Bundestag oder bei Leuten zu Hause. Ich komme woandershin – und es freut mich, diese Menschen, diese Themen und diese Welt umgekehrt wieder in das Theater einzuladen.
Melanie Hinz: Ich bringe in die Arbeit mit Laien die Professionalität ein, wie man etwas rahmen kann. Dieser Schutzraum, in dem eine Darstellung überhaupt funktionieren kann, den setze ich. Aber der Prozess ist von meinem Interesse an den Darstellerinnen und Darstellern geleitet. Und die wiederum haben unter Umständen ein ganz anderes Verständnis davon, was Theater ist, als ich.
Miriam Tscholl: Es ist ein anstrengender und schwieriger Prozess. Denn man steht am Anfang mit leeren Händen da. In der Arbeit mit Nichtprofis ist von uns Regisseuren Beobachtung, aber auch Empathie gefragt. Theater entwickeln heißt eben auch Leben entdecken und Menschen erforschen.
Marc Prätsch, was unterscheidet die Arbeit mit Theaterprofis von der mit Nichtschauspielern?
Marc Prätsch: Ich wünsche mir, immer weniger in den Kategorien von Schauspieler und Nichtschauspieler zu denken. Es gibt schlechte Produktionen mit Profis und schlechte Produktionen mit Laien. Als Schauspieler weiß ich, dass es ein Handwerk gibt. Aber das Erste ist für mich immer ein Blick auf Menschen – und ich begegne 20-, 30-mal am Tag Menschen, bei denen ich denke, mit dem oder der würde ich gerne ein Stück machen. Das hat etwas mit meiner Kunstauffassung zu tun. Bei professionellen Schauspielern ist es kein anderes Herangehen. Das Theatersystem ist eine Art Clubsystem. Und die Bürgerbühne ist eine Art, den Club zu erweitern. Wenn ich zu einer Schauspielschule gehe, bekomme ich so etwas wie einen Clubausweis.
Wie beim Golfen …
Marc Prätsch: … und da bin ich als Regisseur aus künstlerischen Gründen dagegen. Ich will die Freiheit haben, mit jedem zu arbeiten, den ich sehe und der mich für das Thema, das ich auf die Bühne bringen will, interessiert.
Melanie Hinz: Von dort aus, wo ich herkomme, würde ich sagen: Ich bin ja selber Spezialistin für das Nichtprofessionelle. Ich will etwas wissen, was ich noch nicht weiß. In der Arbeit an Projekten entwickle ich eine Frage, die uns alle betrifft.
Miriam Tscholl: Es geht bei der Arbeit an den Projekten als Darsteller darum, Möglichkeiten zu entdecken, die man vorher nicht hatte – sich loszulösen von dem, was man ist, sich zu emanzipieren –, aber auch auf der Bühne Dinge zu tun, die man zwar innerhalb seiner Erfahrungen und Möglichkeiten hat, aber sonst nicht praktiziert.
Marc Prätsch: Es geht ums Spielen – alles andere ist wieder nur eine Frage des Clubausweises. Ich sehe mich als einer, der unter dem Tresen den Ausweis weiterreicht. Das Ziel der Bürgerbühne muss doch sein, dass es die Bürgerbühne in fünf Jahren nicht mehr gibt, weil das ganze Theater von der Bürgerbühne übernommen wird. Es geht doch um eine Erweiterung des Kunstbegriffs, um eine erweiterte Teilhabe und um eine Infragestellung des Kunstbegriffs. Im Kern geht es um ein anderes Kunstverständnis.
Diese Spielzeit ist die 100. Spielzeit des Staatsschauspiels Dresden. Wie sehen Sie die Zukunft der Theaterform, wie Sie sie betreiben, jedenfalls mittelfristig?
Clemens Bechtel: Theater muss sich seine Existenzberechtigung immer wieder neu erarbeiten, und das Theater als Spielraum für seine Bürger, wie hier in der Bürgerbühne, wird ein wichtiges Feld dieser Erarbeitung sein. Die Benennung ist am Schluss vielleicht gar nicht so interessant. Inhaltlich-ästhetisch muss die Arbeit weitergehen. Wie geht es weiter? Ich fände es toll, wenn das Beispiel Dresden an vielen Häusern Schule machen würde.
Miriam Tscholl: In allen Bereichen der Gesellschaft und der Kunst wird man sich mit der Arbeit, wie sie hier an der Bürgerbühne stattfindet, ernsthaft auseinandersetzen müssen. Es braucht einen Diskurs. Die Arbeit muss im Journalismus reflektiert, in Regieschulen unterrichtet, in der Schauspielausbildung thematisiert werden. Noch fehlen allzu oft die Gesprächspartner über diese Theaterarbeit. Es muss nicht jeder alles können oder machen, aber die Skills und die Möglichkeiten müssen wachsen. Dafür müssen Räume entstehen, auch Freiräume – in der Ausbildung und in den Theatern.
Clemens Bechtel, geboren 1964 in Heidelberg, arbeitet seit 15 Jahren als Regisseur.
Melanie Hinz inszenierte 2009.2010 an der Bürgerbühne „FKK. Eine Frauenkörperkomödie“.
Unter der Regie von Marc Prätsch entstanden die Bürgerbühnen-Produktionen „Die Nibelungen“ nach Hebbel sowie „Jugend ohne Gott“ nach Horváth.
Miriam Tscholl ist seit 2009 Leiterin der Dresdner Bürgerbühne, wo sie zuletzt „Ja, ich will!“, ein Spiel mit Verheirateten, inszenierte.
Marc Prätsch: Ich wünsche mir, immer weniger in den Kategorien von Schauspieler und Nichtschauspieler zu denken. Es gibt schlechte Produktionen mit Profis und schlechte Produktionen mit Laien. Als Schauspieler weiß ich, dass es ein Handwerk gibt. Aber das Erste ist für mich immer ein Blick auf Menschen – und ich begegne 20-, 30-mal am Tag Menschen, bei denen ich denke, mit dem oder der würde ich gerne ein Stück machen. Das hat etwas mit meiner Kunstauffassung zu tun. Bei professionellen Schauspielern ist es kein anderes Herangehen. Das Theatersystem ist eine Art Clubsystem. Und die Bürgerbühne ist eine Art, den Club zu erweitern. Wenn ich zu einer Schauspielschule gehe, bekomme ich so etwas wie einen Clubausweis.
Wie beim Golfen …
Marc Prätsch: … und da bin ich als Regisseur aus künstlerischen Gründen dagegen. Ich will die Freiheit haben, mit jedem zu arbeiten, den ich sehe und der mich für das Thema, das ich auf die Bühne bringen will, interessiert.
Melanie Hinz: Von dort aus, wo ich herkomme, würde ich sagen: Ich bin ja selber Spezialistin für das Nichtprofessionelle. Ich will etwas wissen, was ich noch nicht weiß. In der Arbeit an Projekten entwickle ich eine Frage, die uns alle betrifft.
Miriam Tscholl: Es geht bei der Arbeit an den Projekten als Darsteller darum, Möglichkeiten zu entdecken, die man vorher nicht hatte – sich loszulösen von dem, was man ist, sich zu emanzipieren –, aber auch auf der Bühne Dinge zu tun, die man zwar innerhalb seiner Erfahrungen und Möglichkeiten hat, aber sonst nicht praktiziert.
Marc Prätsch: Es geht ums Spielen – alles andere ist wieder nur eine Frage des Clubausweises. Ich sehe mich als einer, der unter dem Tresen den Ausweis weiterreicht. Das Ziel der Bürgerbühne muss doch sein, dass es die Bürgerbühne in fünf Jahren nicht mehr gibt, weil das ganze Theater von der Bürgerbühne übernommen wird. Es geht doch um eine Erweiterung des Kunstbegriffs, um eine erweiterte Teilhabe und um eine Infragestellung des Kunstbegriffs. Im Kern geht es um ein anderes Kunstverständnis.
Diese Spielzeit ist die 100. Spielzeit des Staatsschauspiels Dresden. Wie sehen Sie die Zukunft der Theaterform, wie Sie sie betreiben, jedenfalls mittelfristig?
Clemens Bechtel: Theater muss sich seine Existenzberechtigung immer wieder neu erarbeiten, und das Theater als Spielraum für seine Bürger, wie hier in der Bürgerbühne, wird ein wichtiges Feld dieser Erarbeitung sein. Die Benennung ist am Schluss vielleicht gar nicht so interessant. Inhaltlich-ästhetisch muss die Arbeit weitergehen. Wie geht es weiter? Ich fände es toll, wenn das Beispiel Dresden an vielen Häusern Schule machen würde.
Miriam Tscholl: In allen Bereichen der Gesellschaft und der Kunst wird man sich mit der Arbeit, wie sie hier an der Bürgerbühne stattfindet, ernsthaft auseinandersetzen müssen. Es braucht einen Diskurs. Die Arbeit muss im Journalismus reflektiert, in Regieschulen unterrichtet, in der Schauspielausbildung thematisiert werden. Noch fehlen allzu oft die Gesprächspartner über diese Theaterarbeit. Es muss nicht jeder alles können oder machen, aber die Skills und die Möglichkeiten müssen wachsen. Dafür müssen Räume entstehen, auch Freiräume – in der Ausbildung und in den Theatern.
Clemens Bechtel, geboren 1964 in Heidelberg, arbeitet seit 15 Jahren als Regisseur.
Melanie Hinz inszenierte 2009.2010 an der Bürgerbühne „FKK. Eine Frauenkörperkomödie“.
Unter der Regie von Marc Prätsch entstanden die Bürgerbühnen-Produktionen „Die Nibelungen“ nach Hebbel sowie „Jugend ohne Gott“ nach Horváth.
Miriam Tscholl ist seit 2009 Leiterin der Dresdner Bürgerbühne, wo sie zuletzt „Ja, ich will!“, ein Spiel mit Verheirateten, inszenierte.
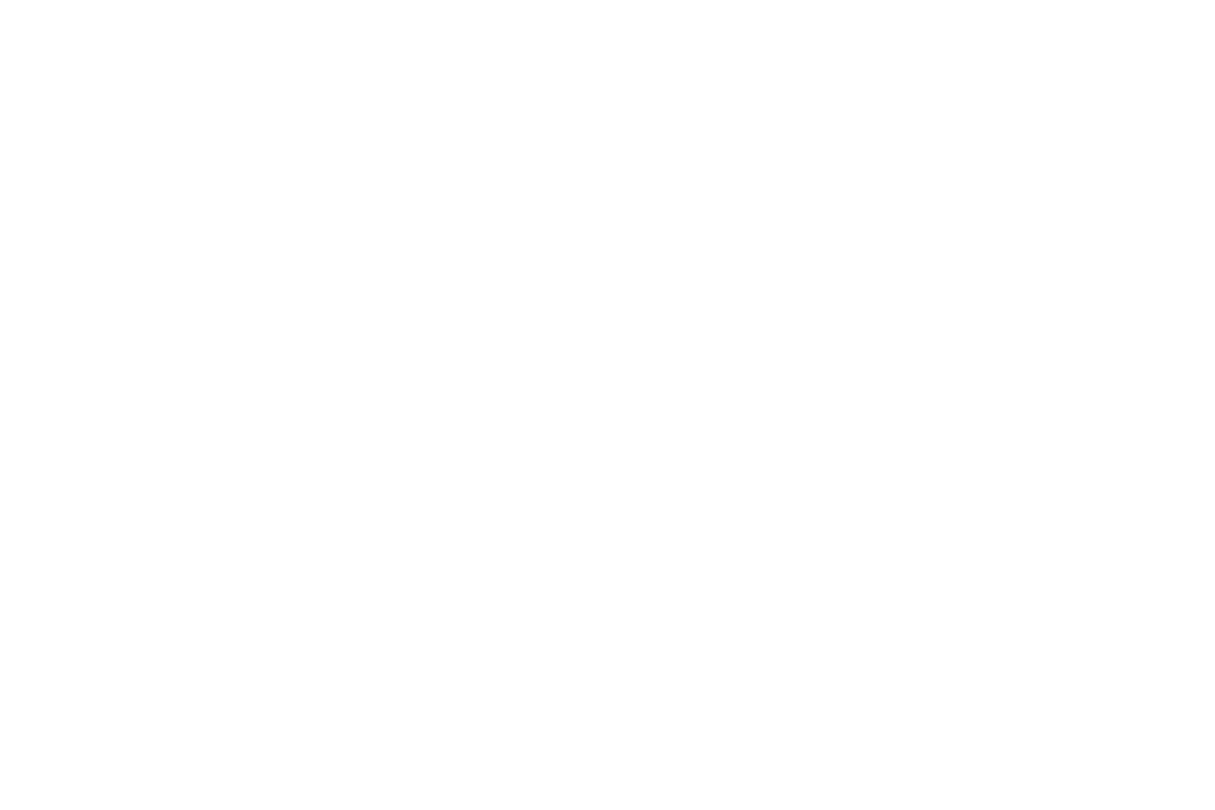

Die Regie spielt mit den Biografien der zwölf, lässt die Akteure gern mal flunkern, setzt das Spiel fantasievoll um.
Die Bühne (Tatjana Kautsch) wandelt sich vom nackten Tresorraum zum gefüllten Verkaufstempel, ist hektische Börse, kubanischer Urlaubsort, stiller Ruheplatz. Zum ‚Sterntaler‘-Märchen regnet es Münzen, Demonstranten halten Schilder in die Höhe, fordern ‚Menschwert statt Geldwert‘, ‚Empört euch‘ und ‚Wir brauchen eine ethische Revolution‘. Am Ende sitzen die zwölf sympathischen Spielerinnen und Spieler solidarisch im Kreis, wie gute Freunde, und singen ‚Vorbei, vorbei‘. Ein Lied über eine Welt ohne Aktien, ohne Spekulanten, ohne Angst vor dem nächsten Tag. Ein Lied ‚vom Ende des Kapitalismus‘. Ein bisschen Utopie muss sein. Wenn schon nicht im Leben, dann wenigstens im Theater.“
Diese Selbst-Spieler kommen dem Publikum deshalb so nah, weil sie über eine meist schmerzhaft erlernte Lebenskunst, die sie den Gierigen voraus haben, zu einer reiferen Lebensfreude gelangt sind. Hübsche Show-Ausflüge wirken deshalb überhaupt nicht aufgesetzt.“