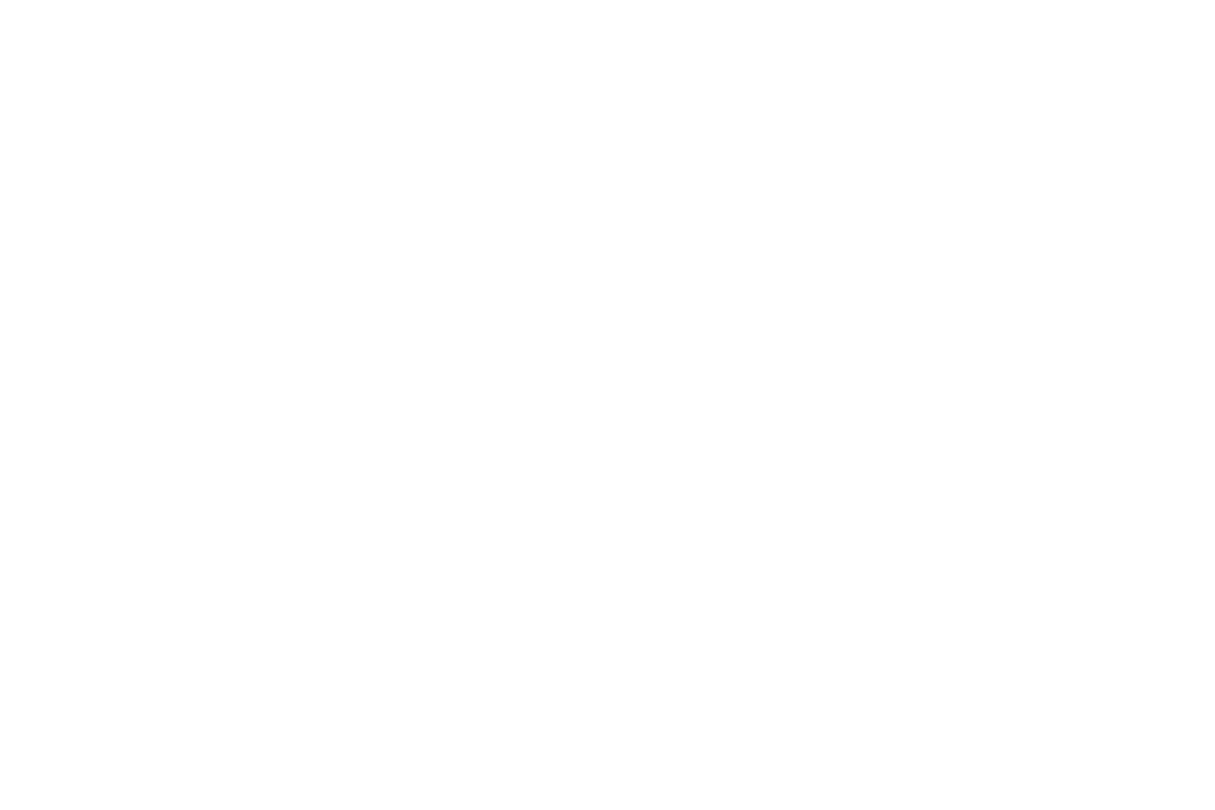Premiere am 15.10.2011
› Kleines Haus 1
Andorra
von Max Frisch
Handlung
„In Andorra lebte ein junger Mann, den man für einen Juden hielt“, so beginnt Max Frisch seine berühmte Parabel über Vorurteile, welche die Wirklichkeit erst schaffen, die sie angeblich beschreiben. Ein andorranischer Lehrer gibt seinen unehelichen Sohn, den Tischlerlehrling Andri, als „gerettetes Judenkind“ aus – und eine ganze Stadt erkennt in ihm „Jüdisches“, die „jüdische Intelligenz“, die „Heimatlosigkeit“ – bis auf Barblin, Andris Halbschwester, die ihn liebt. Andri selbst wiederum erkennt in sich schließlich kein Talent mehr zur Tischlerei, muss aber ständig ans Geld denken – und reibt sich schließlich die Hände. Das ist doch „jüdisch“? Schließlich wird Andri ermordet. Schuld hat – das versteht sich von selbst – niemand. – Bei Max Frisch heißt es, der Kleinstaat Andorra im Stück habe „nichts zu tun mit dem wirklichen Kleinstaat dieses Namens“. In der Inszenierung von Miriam Tscholl spielt eine Doktorin den Doktor, ein Tischler den Tischler, eine Mutter die Mutter – aber machen Sie sich nicht vorschnell ein Bild!
Besetzung
Regie
Bühne und Kostüme
Katrin Hieronimus
Musik
Roman Keller
Dramaturgie
Ole Georg Graf
Licht
Andri
Christian Leonhardt
Barblin
Nancy Pönitz
Der Lehrer (Can)
Markus Lipsz
Die Mutter
Heike Sperling
Die Senora
Hella Leske
Der Pater (Benedikt)
Berndt Fröbel
Der Soldat (Peider)
Ashok Khan
Die Wirtin
Verena Müller
Der Tischler (Prader)
Veit Grasreiner
Die Doktorin (Ferrer)
Elke Haufe
Der Geselle (Fedri)
Benjamin Bruch
Der Jemand
Die Nachbarin
Lilian Ackermann
Video
Pressestimmen
Barbara Behrendt über die Bürgerbühne
von Barbara Behrendt
Seit zwei Jahren gibt es die Bürgerbühne nun. In dieser Zeit standen über 800 Dresdner in gut 160 Aufführungen auf der Bühne – man muss in dieser Stadt also keine großen Worte mehr darüber verlieren, warum Theaterspielen zum Sog werden kann: wie es gelingt, sich freizuspielen; wie man sich im Spiel äußert, entäußert und dabei neu erfährt; und wie man entdeckt, warum man sich vor anderen Menschen am liebsten so und nicht anders darstellen will. Die Dresdner haben das alles am eigenen Leib kennengelernt. „Hier geht es mal nicht um Gewinnen oder Verlieren“, resümiert der 12-jährige Dominik Flick seine Erfahrungen. Und ganz einfach drückt es der 74-jährige Fritz Rösler aus: „Man kann sich noch einmal anders erleben.“
In der Bürgerbühne werden die Grundvereinbarungen des Theaters für jeden sicht- und erfahrbar: spielen, erproben, verwerfen, Alternativen entwickeln, Perspektiven wechseln – das, was man in seinen Alltagsrollen unbewusst anwendet, ins Bewusstsein holen und auf der Bühne noch einmal ganz anders ausprobieren. Es ist die Rückbesinnung auf den menschlichen Urtrieb des Spielens – und so auch auf die Ursprünge des Theaters: In der Antike war es Tradition, dass im Theater normale Bürger die Chorpassagen sangen und spielten.
Unsere Sehweise ist heute jedoch eine andere. Ein Laie, der sich auf der Bühne versucht, wird einen Zuschauer im Normalfall nie so in seinen Bann ziehen, wie es ein professioneller, talentierter Schauspieler vermag. Für einen Zuschauer (wenn er nicht gerade ein Freund oder Verwandter des Darstellers ist) wird das Spiel eines Laien erst spannungsvoll, wenn er etwas anderes anzubieten hat als nur den Versuch, professionell zu wirken: wenn er seine persönliche Prägung, möglicherweise sogar ganz unbedarft, ins Spiel einbringt. Die Dokumentartheatergruppe Rimini Protokoll spricht bei ihren mitwirkenden Laien deshalb von „Experten des Alltags“.
Es liegt auf der Hand, dass solche Identifikationsmöglichkeiten dort besonders stark sind, wo Laien ein Stück ihrer eigenen Lebensgeschichte preisgeben. Bei einem Besuch der Bürgerbühne konnte man das zum Beispiel in der Produktion „FKK. Eine Frauenkörperkomödie“ beobachten, die Melanie Hinz mit 17 Dresdnerinnen erarbeitete. Diese erzählen darin vom Frausein gestern und heute und machen ganz persönliche Bekenntnisse über ihren Körper, über Lust und Tabus.
Aber auch einen bekannten Broadway-Stoff sah man mit Laien gelingen: Der Musical-Klassiker „Anatevka“ wurde für die Bürgerbühne zum Erfolg, weil die nicht perfekte Darstellung der Laien in ihrer Brüchigkeit charmant wirkte. „Das könnte ich sein, der dort singt und tanzt“, war das überzeugende Moment fürs Publikum.
In der Bürgerbühne werden die Grundvereinbarungen des Theaters für jeden sicht- und erfahrbar: spielen, erproben, verwerfen, Alternativen entwickeln, Perspektiven wechseln – das, was man in seinen Alltagsrollen unbewusst anwendet, ins Bewusstsein holen und auf der Bühne noch einmal ganz anders ausprobieren. Es ist die Rückbesinnung auf den menschlichen Urtrieb des Spielens – und so auch auf die Ursprünge des Theaters: In der Antike war es Tradition, dass im Theater normale Bürger die Chorpassagen sangen und spielten.
Unsere Sehweise ist heute jedoch eine andere. Ein Laie, der sich auf der Bühne versucht, wird einen Zuschauer im Normalfall nie so in seinen Bann ziehen, wie es ein professioneller, talentierter Schauspieler vermag. Für einen Zuschauer (wenn er nicht gerade ein Freund oder Verwandter des Darstellers ist) wird das Spiel eines Laien erst spannungsvoll, wenn er etwas anderes anzubieten hat als nur den Versuch, professionell zu wirken: wenn er seine persönliche Prägung, möglicherweise sogar ganz unbedarft, ins Spiel einbringt. Die Dokumentartheatergruppe Rimini Protokoll spricht bei ihren mitwirkenden Laien deshalb von „Experten des Alltags“.
Es liegt auf der Hand, dass solche Identifikationsmöglichkeiten dort besonders stark sind, wo Laien ein Stück ihrer eigenen Lebensgeschichte preisgeben. Bei einem Besuch der Bürgerbühne konnte man das zum Beispiel in der Produktion „FKK. Eine Frauenkörperkomödie“ beobachten, die Melanie Hinz mit 17 Dresdnerinnen erarbeitete. Diese erzählen darin vom Frausein gestern und heute und machen ganz persönliche Bekenntnisse über ihren Körper, über Lust und Tabus.
Aber auch einen bekannten Broadway-Stoff sah man mit Laien gelingen: Der Musical-Klassiker „Anatevka“ wurde für die Bürgerbühne zum Erfolg, weil die nicht perfekte Darstellung der Laien in ihrer Brüchigkeit charmant wirkte. „Das könnte ich sein, der dort singt und tanzt“, war das überzeugende Moment fürs Publikum.
Dennoch könnten Aufführungen wie diese das Programm der Bürgerbühne nicht allein tragen, das Abarbeiten an den großen Vorbildern würde womöglich auf die Dauer seinen Reiz verlieren. Ein „Gegengewicht“ durch genuine Projektarbeiten wie „FKK“ gehört daher zwingend auf den Spielplan.
Jedes Projekt der Bürgerbühne muss der Frage standhalten: Warum soll ausgerechnet dieser Stoff mit Laien realisiert werden? Was geben sie der Geschichte, was ihr professionelle Schauspieler nicht geben können? Bei „Eins, zwei, drei und schon vorbei“ von Uli Jäckle ist die Antwort klar, denn auch dieses Stück wurde mit Kindern und Senioren erst während der Proben entwickelt. Die Texte sind aus Interviews mit den Mitwirkenden entstanden und leben von deren persönlichen Erlebnissen. Natürlich: Man hört den Darstellern mit anderer Aufmerksamkeit zu, wenn klar ist, dass die Wahrhaftigkeit, mit der sie erzählen, nicht nur behauptet ist. Und wenn über dieses Individuelle plötzlich auch etwas von dem spürbar wird, was jeden angeht.
Aber nicht alles Authentische muss gleichermaßen interessant sein. Das Wagnis bei einer Arbeitsweise wie der von Uli Jäckle und Melanie Hinz ist: Man hat zu Probenbeginn keinen Schimmer, was dabei herauskommt. Fokus, Inhalt, Darsteller – alles liegt im Dunkeln und im extrem schutzbedürftigen Raum. Immer muss eine Übereinkunft aus dem getroffen werden, was Theater und Regisseur vorhaben – und was die freiwilligen Darsteller wollen und mitbringen.
Im Idealfall hat nicht nur der Mitspieler „ein befreiendes Erlebnis, das er nie wieder vergisst“, wie Uli Jäckle es ausdrückt. Im Idealfall wird auch der Zuschauer zum Spieler: in der Einfühlung, im Bewerten und im Bauen imaginärer Welten. Bei den Mitspielern, das kann man nach zwei Jahren Bürgerbühne sagen, setzt sich jedenfalls etwas in Gang. Wer bei einer Produktion mitgemacht hat, geht danach dreimal so oft ins Theater, sagen die Laiendarsteller selbst. Das ist, ganz nebenbei, eine intelligente Art, sich das eigene Publikum heranzuziehen.
Miriam Tscholl hat ganz recht, wenn sie sagt: „Theater ist eine soziale Kunst.“ Bei der Bürgerbühne sollen sich Soziales und Kunst die Waage halten. Ein stetes Probieren – mal neigt sich die Waagschale mehr zur einen, mal mehr zur anderen Seite. Je nachdem wie viel Gewicht der Regisseur dem künstlerischen oder dem pädagogischen Aspekt gibt und welche Bürger in der „Schale“ liegen.
Barbara Behrendt lebt als freie Journalistin in Berlin. Sie schreibt für die Kulturseiten der taz und für die Onlineplattform von Theater heute www.kultiversum.de. Dieser Text ist ein Originalbeitrag für das Spielzeitheft 2011.2012.
Jedes Projekt der Bürgerbühne muss der Frage standhalten: Warum soll ausgerechnet dieser Stoff mit Laien realisiert werden? Was geben sie der Geschichte, was ihr professionelle Schauspieler nicht geben können? Bei „Eins, zwei, drei und schon vorbei“ von Uli Jäckle ist die Antwort klar, denn auch dieses Stück wurde mit Kindern und Senioren erst während der Proben entwickelt. Die Texte sind aus Interviews mit den Mitwirkenden entstanden und leben von deren persönlichen Erlebnissen. Natürlich: Man hört den Darstellern mit anderer Aufmerksamkeit zu, wenn klar ist, dass die Wahrhaftigkeit, mit der sie erzählen, nicht nur behauptet ist. Und wenn über dieses Individuelle plötzlich auch etwas von dem spürbar wird, was jeden angeht.
Aber nicht alles Authentische muss gleichermaßen interessant sein. Das Wagnis bei einer Arbeitsweise wie der von Uli Jäckle und Melanie Hinz ist: Man hat zu Probenbeginn keinen Schimmer, was dabei herauskommt. Fokus, Inhalt, Darsteller – alles liegt im Dunkeln und im extrem schutzbedürftigen Raum. Immer muss eine Übereinkunft aus dem getroffen werden, was Theater und Regisseur vorhaben – und was die freiwilligen Darsteller wollen und mitbringen.
Im Idealfall hat nicht nur der Mitspieler „ein befreiendes Erlebnis, das er nie wieder vergisst“, wie Uli Jäckle es ausdrückt. Im Idealfall wird auch der Zuschauer zum Spieler: in der Einfühlung, im Bewerten und im Bauen imaginärer Welten. Bei den Mitspielern, das kann man nach zwei Jahren Bürgerbühne sagen, setzt sich jedenfalls etwas in Gang. Wer bei einer Produktion mitgemacht hat, geht danach dreimal so oft ins Theater, sagen die Laiendarsteller selbst. Das ist, ganz nebenbei, eine intelligente Art, sich das eigene Publikum heranzuziehen.
Miriam Tscholl hat ganz recht, wenn sie sagt: „Theater ist eine soziale Kunst.“ Bei der Bürgerbühne sollen sich Soziales und Kunst die Waage halten. Ein stetes Probieren – mal neigt sich die Waagschale mehr zur einen, mal mehr zur anderen Seite. Je nachdem wie viel Gewicht der Regisseur dem künstlerischen oder dem pädagogischen Aspekt gibt und welche Bürger in der „Schale“ liegen.
Barbara Behrendt lebt als freie Journalistin in Berlin. Sie schreibt für die Kulturseiten der taz und für die Onlineplattform von Theater heute www.kultiversum.de. Dieser Text ist ein Originalbeitrag für das Spielzeitheft 2011.2012.